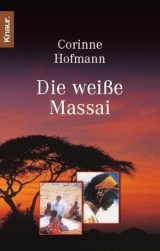
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Wir verlassen den Schlafraum und spazieren durch Maralal in der Hoffnung, daß inzwischen der Benzinnachschub eingetroffen ist. Aber es gibt nach wie vor keines.
Dafür treffen wir auf meinen ewigen Retter Tom und seine junge Frau. Sie ist noch fast ein Kind und blickt scheu auf den Boden. Glücklich ist dieses Mädchen nicht. Wir erwähnen, daß wir schon vier Tage auf Benzin warten. Unser Freund fragt, warum wir nicht an den Lake Baringo führen, das sei nur etwa zwei Stunden von hier entfernt, und dort gäbe es immer Benzin.
Von diesem Vorschlag bin ich begeistert, da mir die Rumhängerei zuwider ist. Ich schlage ihm vor, mit seiner Frau mitzukommen, da ich ihm ja noch eine Safari schuldig bin. Er bespricht sich kurz mit ihr, doch das Mädchen fürchtet sich vor dem Auto. Lketinga lacht und kann sie schließlich überzeugen. Wir nehmen uns vor, gleich am Morgen loszufahren.
Nun suchen wir die hiesige Garage auf, deren Besitzer ebenfalls ein Somali ist. Bei ihm kann ich zwei leere Fässer kaufen, die gut hinten im Landrover Platz finden. Als wir sie mit Seilen befestigt haben, fühle ich mich für zukünftige Fahrten bestens gerüstet, und wir sind glücklich, daß es endlich losgeht. Nur das Mädchen ist noch kleiner und schweigsamer geworden. Ängstlich hält sie sich an den Fässern fest.
Endlos fahren wir auf der staubigen, holprigen Straße dahin, ohne jeglichen Gegenverkehr. Ab und zu sehen wir Zebraherden oder Giraffen, aber weit und breit ist kein Hinweisschild oder menschliches Leben zu sichten. Plötzlich kippt der Landrover vorne ab, und das Steuern wird schwierig, wir haben einen Platten. Vom Radwechsel verstehe ich nicht viel. Das ist mir in meiner zehnjährigen Fahrpraxis noch nie passiert. „No problem“,
meint Tom. Wir ziehen den Ersatzreifen, den Kreuzschlüssel und den uralten Wagenheber hervor. Tom kriecht unter den Landrover, um den Wagenheber richtig zu plazieren. Mit dem Kreuzschlüssel will er die Radmuttern lösen. Doch die Kanten des Werkzeugs sind abgeschliffen, so daß der Schlüssel an der Schraube keinen Halt findet. Deshalb versuchen wir, mit Sand, Hölzchen und Tüchern den Schlüssel zu fixieren. Bei drei Muttern klappt es, aber die anderen sitzen fest. Wir müssen aufgeben. Toms Frau beginnt zu weinen und rennt in die Steppe hinaus.
Tom beruhigt uns, wir sollten sie lassen, sie käme wieder, doch Lketinga holt sie zurück, da wir nun in einem anderen District, den Baringos, sind. Wir sind verschwitzt, dreckig und sehr durstig. Zwar haben wir genügend Benzin, aber nichts zum Trinken dabei, weil wir mit einer kurzen Fahrzeit gerechnet haben. So setzen wir uns in den Schatten und hoffen, daß bald ein Fahrzeug vorbeikommt, schließlich sieht die Straße befahrener aus als die nach Barsaloi.
Als nach Stunden nichts passiert und auch Lketinga nach einer Besichtigungstour zurückkommt, ohne den Baringo-See oder Hütten gefunden zu haben, beschließen wir, die Nacht im Landrover zu verbringen. Diese Nacht scheint unendlich lang. Wir schlafen kaum vor Hunger, Durst und Kälte. Am Morgen probieren es die Männer vergeblich noch einmal. Bis Mittag wollen wir noch warten, ob vielleicht doch Hilfe kommt. Meine Kehle ist ausgetrocknet, und die Lippen sind spröde. Das Mädchen weint schon wieder, und Tom verliert allmählich die Geduld.
Plötzlich lauscht Lketinga angestrengt und glaubt ein Fahrzeug zu hören. Es dauert noch Minuten, bevor auch ich Motorengeräusche wahrnehmen kann. Zu unserer großen Erleichterung sehen wir einen Safari-Bus. Der afrikanische Fahrer hält und läßt die Scheibe herunter. Die italienischen Touristen mustern uns neugierig.
Tom schildert dem Driver unser Problem, doch der bedauert, er dürfe keine Fremden aufnehmen. Er reicht uns seinen Kreuzschlüssel. Leider paßt er nicht, er ist zu klein.
Nun versuche ich, den Fahrer zu erweichen und biete sogar Geld an. Aber er kurbelt die Scheibe hoch und fährt einfach weiter. Die Italiener sagen die ganze Zeit nichts, mustern mich aber ziemlich distanziert. Anscheinend bin ich ihnen zu dreckig und die anderen zu wild. Wütend schreie ich dem davonfahrenden Bus die gräßlichsten Schimpfwörter hinterher. Ich schäme mich für die Weißen, weil sich nicht einer bemüht hat, den Fahrer zu überreden.
Tom ist überzeugt, daß wir wenigstens auf der richtigen Straße sind, und will gerade zu Fuß aufbrechen, als wir erneut Motorengeräusche vernehmen. Diesmal bin ich wild entschlossen, das Fahrzeug nicht ohne einen von uns weiterfahren zu lassen. Es ist ein ähnlicher Safari-Bus, ebenfal s mit Italienern besetzt.
Während Tom und Lketinga mit dem abweisenden Fahrer verhandeln und wieder nur Kopfschütteln ernten, reiße ich die hintere Bustüre auf und rufe verzweifelt hinein: „Do you speak English?“ „No, solo italiano“, tönt es zurück. Nur ein jüngerer Mann sagt: „Yes, just a little bit, what's your problem?“
Ich erkläre, daß wir schon seit gestern morgen hier stehen, ohne Wasser und Essen, und dringend Hilfe brauchen. Der Fahrer sagt: „It's not allowed“, und will die Türe schließen. Doch Gott sei Dank setzt sich der junge Italiener für uns ein und sagt, daß sie diesen Bus bezahlen und deshalb bestimmen können, ob jemand von uns mitfährt. Tom steigt vorne beim Fahrer ein, ob dieser wil oder nicht.
Erleichtert bedanke ich mich bei den Touristen. Wir müssen noch fast drei Stunden ausharren, bis wir in der Ferne eine Staubwolke sichten. Endlich kommt Tom in einem Landrover mit dessen Besitzer zurück. Zu unserem großen Glück bringt er Cola und Brot mit. Ich will mich gleich auf das Getränk stürzen, aber er mahnt mich, nur kleine Schlucke zu nehmen, sonst würde mir schlecht. Wie neu geboren schwöre ich mir, mit diesem Fahrzeug nie mehr ohne Trinkwasser loszufahren.
Tom kann die letzte Radmutter nur lösen, indem er sie mit Hammer und Meißel entzweischlägt. Dann geht der Radwechsel zügig vonstatten, und bald darauf fahren wir, mit einer Schraube weniger weiter. Nach gut eineinhalb Stunden erreichen wir endlich den Lake Baringo. Die Tankstelle befindet sich direkt neben einem pompösen Touristen-Gartenrestaurant. Nach den überstandenen Strapazen lade ich alle ins Restaurant ein. Das Mädchen staunt über diese neue Welt, fühlt sich aber nicht wohl. Wir setzen uns an einen schönen Tisch mit Blick auf den See, in dem sich Tausende rosa Flamingos tummeln. Als ich in die staunenden Gesichter meiner Begleiter sehe, bin ich doch stolz, ihnen außer Mühsal auch etwas Außergewöhnliches bieten zu können.
Zwei Kellner kommen an unseren Tisch, aber nicht etwa für die Bestel ung, sondern um uns mitzuteilen, daß wir hier nichts bekommen, weil dies nur für Touristen sei. Entsetzt antworte ich: „Ich bin Touristin und lade meine Freunde ein.“
Der schwarze Kellner beruhigt mich, ich könne bleiben, aber die Massai müßten das Gelände verlassen. Wir stehen auf und gehen. Fast körperlich spüre ich, wie gedemütigt sich diese sonst so stolzen Menschen fühlen.
Wenigstens bekommen wir Benzin. Als der Tankstellenbesitzer al erdings sieht, daß ich die zwei großen Fässer füllen wil, muß ich ihm zuerst mein Geld zeigen.
Lketinga hält den Schlauch in das Faß, und ich entferne mich einige Meter, um nach dem Ärger eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich schreit er auf, und entsetzt sehe ich das Benzin wie aus einem Wasserschlauch in der Gegend herumspritzen. Schnell bin ich beim Wagen und hebe den weggeworfenen Hahn auf, um ihn abzustel en.
Der Riegel war eingehängt, und das Benzin floß weiter, als das Faß schon vol war.
Einige Liter sind auf den Platz und ein Teil ins Fahrzeug gelaufen. Als ich sehe, wie schlecht sich Lketinga fühlt, versuche ich mich zu beherrschen, während Tom mit seiner Frau abseits steht und vor Scham im Boden versinken möchte. Das zweite Faß dürfen wir nicht mehr füllen, wir müssen zahlen und verschwinden. Ich wäre am liebsten zu Hause in der Manyatta, und zwar ohne Auto. Bis jetzt hat es mir nur Ärger gebracht.
Im Dorf trinken wir schweigend Tee und brechen dann auf. Im Auto stinkt es fürchterlich nach Benzin, und es dauert nicht lange, bis sich das Mädchen übergeben muß. Dann wil sie nicht mehr in den Wagen steigen, sondern nach Hause laufen.
Tom wird wütend und droht ihr, sie in Mara-lal wieder zu ihren Eltern zu schicken und sich eine andere Frau zu nehmen. Das muß eine große Schande sein, denn sie steigt wieder ein. Lketinga hat noch nichts gesprochen. Er tut mir leid, und ich versuche ihn zu trösten. Es ist dunkel, als wir Maralal erreichen.
Die zwei verabschieden sich ziemlich schnel, und wir beziehen unser Lodging.
Obwohl es kühl ist, gehe ich noch unter die spärlich plätschernde Dusche, weil ich vor Dreck und Staub förmlich klebe. Auch Lketinga geht sich waschen. Dann verspeisen wir noch eine große Portion Fleisch im Zimmer. Diesmal schmeckt sogar mir das Fleisch ausgezeichnet, das wir mit Bier herunterspülen. Danach fühle ich mich richtig wohl, und wir verbringen eine schöne Liebesnacht, wobei ich zum ersten Mal mit ihm den Höhepunkt erreiche. Da dies nicht ganz geräuschlos abläuft, hält er mir erschrocken den Mund zu und fragt: „Corinne, what's the problem?“
Als ich wieder ruhiger atmen kann, versuche ich, ihm meinen Orgasmus zu erklären. Doch er versteht das nicht und lacht nur ungläubig. So etwas gibt es nur bei den Weißen, ist seine Erkenntnis. Glücklich und müde schlafe ich schließlich ein.
Am frühen Morgen kaufen wir richtig ein: Reis, Kartoffeln, Gemüse, Früchte, sogar Ananas. Auch das zweite Benzinfaß können wir auffül en, da es wie zum Hohn in Maralal wieder Benzin gibt. Voll beladen machen wir uns auf die Heimreise. Zwei Samburu-Männer nehmen wir auch noch mit.
Lketinga will den kürzeren Weg durch den Busch fahren. Ich habe meine Zweifel, doch in seiner Gegenwart schwinden sie schnell. Die Fahrt verläuft gut, bis wir an den schrägen Teil gelangen. Da die gefüllten Fässer das Schaukeln des Fahrzeugs verstärken, bitte ich die beiden Mitfahrenden, al es Eingekaufte und sich selber auf der Bergseite zu plazieren, denn ich habe Angst, der Wagen könnte kippen. Keiner spricht, als ich die zweihundert Meter in Angriff nehme. Wir schaffen es, und das Geschnatter im Auto geht weiter. Bei den Felsen müssen al e aussteigen, und Lketinga lotst mich gut über die großen Brocken. Als das ebenfalls gelungen ist, fühle ich mich erleichtert und stolz. Problemlos erreichen wir Barsaloi.
Alltagsleben
Die nächsten Tage können wir richtig genießen. Es ist genug Eßbares da und Benzin in Hülle und Fülle. Täglich besuchen wir Verwandte mit dem Auto oder gehen Feuerholz schlagen, das wir mit dem Wagen nach Hause bringen. Ab und zu fahren wir zum River, vol ziehen unser Waschritual und bringen für halb Barsaloi die Wasserkanister mit hoch, manchmal bis zu zwanzig Stück. Diese kleineren Ausflüge verbrauchen viel von unserem kostbaren Benzin, so daß ich Einspruch erhebe. Doch es entsteht jedesmal eine große Debatte.
Heute morgen, berichtet ein Moran, habe eine seiner Kühe gekalbt. Dieses Ereignis müssen wir besichtigen. Wir fahren nach Sitedi. Da dies keine offiziel e Straße ist, muß ich ständig aufpassen, daß wir nicht über Dornen fahren. Wir besuchen im Kral seinen Halbbruder. Hier sind die Kühe abends versammelt.
Deshalb stapfen wir durch Mengen von Kuhfladen, die Tausende von Fliegen anziehen. Lketingas Halbbruder zeigt uns das neugeborene Kalb. Die Mutterkuh bleibt am ersten Tag zu Hause. Lketinga strahlt, während ich mit den Fliegen kämpfe. Meine Plastiksandalen versinken im Kuhmist. Jetzt sehe ich den Unterschied zwischen unserem Kral ohne Kühe und diesem. Nein, hier wil ich nicht lange bleiben.
Wir werden zu Chai eingeladen, und Lketinga führt mich in die Hütte seines Halbbruders und dessen junger Frau, die ein zwei Wochen altes Baby hat. Sie scheint erfreut über unseren Besuch. Es wird viel geschwatzt, aber ich verstehe kein Wort. Die Scharen von Fliegen machen mich völlig fertig. Während des Teetrinkens halte ich ständig die Hand über den heißen Becher, damit ich wenigstens keine verschlucke. Das Baby hängt nackt in einem Kanga an der Mutter. Als ich mit der Hand auf den Kanga deute, da das Baby unbemerkt sein Geschäftchen erledigt, lacht die Frau, nimmt das Kind heraus und putzt es, indem sie auf den Po spuckt und ihn abreibt. Kanga und Rock werden ausgeschüttelt und mit Sand trocken gerieben.
Mich würgt es bei der Vorstellung, daß dies täglich mehrmals passiert und so das Säuberungsritual vor sich geht. Ich spreche Lketinga darauf an, doch er meint, das sei normal. Jedenfalls helfen die Fliegen mit, die Überreste verschwinden zu lassen.
Als ich nun endlich nach Hause will, teilt Lketinga mir mit: „Das geht nicht, heute schlafen wir hier!“ Er will bei der Kuh bleiben, und sein Halbbruder möchte für uns eine Ziege schlachten, da auch seine Frau dringend Fleisch benötige nach der Geburt. Der Gedanke, hier zu übernachten, läßt mich fast in Panik geraten.
Einerseits darf ich die Gastfreundschaft nicht verletzen, andererseits fühle ich mich hier wirklich verloren.
Lketinga ist die meiste Zeit mit anderen Kriegern bei den Kühen, und ich sitze währenddessen mit drei Frauen in der dunklen Hütte und kann kein Wort sprechen.
Sie reden ganz offensichtlich über mich oder kichern komisch. Eine prüft meine weiße Haut am Arm, die andere greift mir in die Haare. Die langen, hellen Haare verunsichern sie sehr. Alle haben rasierte Schädel, dafür sind sie geschmückt mit farbigen Perlenstirnbändern und langen Ohrringen.
Die Frau stil t wieder ihr Baby und hält es mir kurz darauf entgegen. Ich nehme es in den Arm, kann mich aber nicht recht erwärmen, da ich befürchte, daß es mir bald ähnlich ergehen wird wie vorher der Mama. Es ist mir schon klar, daß es hier keine Windeln gibt, doch kann ich mich im Moment noch nicht daran gewöhnen. Nachdem ich es eine Weile bestaunt habe, reiche ich es erleichtert zurück.
Lketinga schaut in die Hütte. Ich frage ihn, wo er so lange war. Lachend erklärt er mir, er trinke mit den Kriegern Milch. Nachher wol en sie die Ziege töten und uns gute Stücke bringen. Er muß wieder im Busch essen. Ich will mitkommen, doch diesmal geht es nicht. Der Kral ist riesig, und es sind zu viele Frauen und Krieger hier. Also warten wir ungefähr zwei Stunden, bis unser Fleischanteil gebracht wird.
Mittlerweile ist es dunkel, und die Frau kocht unser Fleisch. Wir sind drei Frauen und vier Kinder, die sich eine halbe Ziege teilen. Die andere Hälfte hat Lketinga mit seinem Halbbruder verzehrt. Als ich satt bin, krieche ich aus der Hütte und geselle mich zu meinem Massai und den anderen Kriegern, die abseits bei den Kühen hocken. Ich frage Lketinga, wann er schlafen kommt. Er lacht: „O no, Corinne, here I cannot sleep in this house together with ladies, I sleep here with friends and the cows.“
Mir bleibt nichts anderes übrig, als zurück zu den fremden Frauen zu kriechen. Es ist die erste Nacht ohne Lketinga, und seine Wärme fehlt mir sehr. An meinem Kopfende in der Hütte sind drei kleine neugeborene Ziegen befestigt, die immer wieder meckern. In dieser Nacht schlafe ich nicht. Am frühen Morgen ist das Treiben viel größer als bei uns in Barsaloi. Hier müssen nicht nur die Ziegen gemolken werden, sondern auch die Kühe. Überal meckert und muht es ungeduldig. Das Melken besorgen die Frauen oder Mädchen. Nach dem Chai brechen wir endlich auf.
Mich überkommt geradezu ein Hochgefühl, wenn ich an unsere saubere Manyatta mit dem vielen Essen und an den River denke. Unser Landrover ist voll besetzt mit Frauen, die ihre Milch in Barsaloi verkaufen wollen. Sie sind froh, daß sie heute nicht den weiten Weg laufen müssen. Es dauert nicht lange, bis Lketinga drängt, er wolle auch mal steuern. Mit allen Mitteln versuche ich ihn davon abzubringen. Bald finde ich keine überzeugenden Worte mehr, da die Frauen Lketinga anscheinend anstacheln. Er greift mir ständig ins Steuer, bis ich entnervt anhalte. Stolz steigt er auf den Fahrersitz, und al e Frauen klatschen. Mir ist elend zumute, und verzweifelt versuche ich, ihm wenigstens noch Gas und Bremse zu erklären. Er wehrt ab: „I know, I know“,
rumpelt los und strahlt vor Glück. Ich kann dieses Glück nur für Sekunden teilen, denn schon nach etwa hundert Metern rufe ich: „Slowly, slowly!“
Lketinga jedoch wird schnel er statt langsamer und steuert geradewegs auf einen Baum zu. Er scheint alles zu verwechseln. Ich schreie: „Langsam, mehr links!“ In meiner Panik reiße ich kurz vor dem Baum das Steuer nach links. So entkommen wir zwar einer Frontalkol ision, aber der Wagen hängt mit dem Kotflügel am Baum, der Motor stirbt ab.
Jetzt kann ich mich nicht mehr beherrschen. Ich steige aus, schaue mir den Schaden an und schlage auf das verdammte Fahrzeug ein. Die Frauen kreischen, aber nicht wegen des Unfalls, sondern weil ich einen Mann anschreie. Lketinga steht neben mir und ist völlig fertig. Das wollte er nicht. Verstört packt er seine Speere und wil zu Fuß nach Hause. Nie mehr will er in dieses Auto steigen. Als ich ihn so sehe, nachdem er zwei Minuten zuvor noch so lustig war, tut er mir leid. Ich fahre den Landrover rückwärts, und da al es noch funktioniert, bringe ich Lketinga soweit, daß er wieder einsteigt. Der Rest der Fahrt verläuft schweigend, und ich male mir schon jetzt die Blamage in Maralal aus, wenn die Mzungu mit dem verbeulten Fahrzeug ankommt.
In Barsaloi wartet die Mama schon freudig auf uns. Sogar Saguna begrüßt mich fröhlich. Lketinga legt sich in unsere Hütte. Ihm ist schlecht, und er macht sich Gedanken wegen der Polizei, da er ja nicht fahren darf. Er ist in einem so schlimmen Zustand, daß ich Angst habe, er könnte wieder verrückt werden. Ich beruhige ihn und verspreche, niemandem etwas zu sagen. Es sei mir passiert, und wir würden es in Maralal reparieren.
Ich wil an den River, um mich zu waschen. Lketinga kommt nicht mit, er will die Hütte nicht verlassen. So gehe ich al ein, obwohl die Mama schimpft. Sie hat Angst, mich ohne Begleitung zum River zu lassen. Sie selbst ist schon jahrelang nicht mehr dort gewesen. Trotzdem mache ich mich auf den Weg und nehme den Wasserkanister mit. An unserer üblichen Stelle wasche ich mich. Doch allein fühle ich mich nicht so wohl und wage nicht, mich ganz auszuziehen. Ich beeile mich. Als ich zurück bin und in die Hütte krieche, fragt er mich neugierig, was ich so lange am River gemacht und wen ich getroffen hätte. Überrascht antworte ich, daß ich die Leute gar nicht kenne und mich sehr beeilt habe. Er erwidert nichts.
Mit ihm und der Mama bespreche ich meine Heimreise, da mein Visum bald abläuft und ich in zwei Wochen Kenia verlassen muß. Die beiden sind nicht gerade glücklich. Lketinga fragt ängstlich, was denn passiert, falls ich nicht wiederkomme, wo wir doch bereits auf dem Office unsere Heiratsabsichten bekannt gegeben haben.
„I come back, no problem!“
antworte ich. Weil ich kein gültiges Ticket habe und keinen reservierten Flug, plane ich, in einer Woche loszufahren. Die Tage verfliegen. Abgesehen von unseren täglichen Waschzeremonien bleiben wir zu Hause und besprechen unsere Zukunft.
Am vorletzten Tag liegen wir faul in der Hütte, als draußen lautes Frauengeschrei zu hören ist. „What's that?“
frage ich erstaunt. Lketinga lauscht angespannt nach draußen. Sein Gesicht verfinstert sich. „What's the problem?“
frage ich nochmals und spüre, daß etwas nicht in Ordnung ist. Kurz darauf kommt Mama aufgebracht in die Hütte. Sie schaut Lketinga verärgert an, während sie zwei oder drei Sätze mit ihm wechselt. Er geht nach draußen, und ich höre eine laute Auseinandersetzung. Ich will ebenfalls hinauskriechen, doch Mama hält mich kopfschüttelnd zurück. Während ich mich wieder hinsetze, klopft mein Herz wie verrückt. Es muß etwas Schlimmes sein. Endlich kommt Lketinga zurück und setzt sich noch ganz aufgewühlt neben mich. Draußen wird es ruhiger. Nun will ich wissen, was passiert ist. Nach längerem Schweigen erfahre ich, daß die Mutter seiner langjährigen Freundin mit zwei Begleiterinnen vor der Hütte steht.
Mir wird elend vor Angst. Daß eine Freundin existiert, höre ich zum ersten Mal. In zwei Tagen reise ich ab, ich will Klarheit, und zwar jetzt: „Lketinga, you have a girlfriend, maybe you must marry this girl?“
Lketinga lacht gequält und sagt: „Yes, many years I have a little girlfriend, but I cannot marry this girl!“
Ich verstehe nichts. „Why?“ Nun erfahre ich, daß fast jeder Krieger eine Freundin hat. Er schmückt sie mit Perlen und ist bedacht, ihr im Laufe der Jahre viel Schmuck zu kaufen, damit sie möglichst schön aussieht, wenn sie heiratet. Doch heiraten darf ein Krieger seine Freundin niemals. Sie dürfen freie Liebe machen bis einen Tag vor ihrer Hochzeit, dann wird sie von den Eltern an einen anderen verkauft. Das Mädchen erfährt erst an ihrem Hochzeitstag, wer ihr Ehemann sein sol.
Erschüttert über das soeben Erfahrene, sage ich, daß das sehr schlimm sein muß.
„Why?“ fragt mich Lketinga. „This is normal for everybody!“
Er erzählt mir, das Mädchen habe sich den ganzen Schmuck vom Hals gerissen, als es erfuhr, daß ich bei ihm lebe, noch bevor sie geheiratet wurde. Es sei schlimm für sie. Langsam steigt in mir die Eifersucht hoch, und ich frage ihn, wann er sie zuletzt besucht habe und wo sie überhaupt wohne. Weit weg von hier in Richtung Baragoi, und seit ich hier bin, habe er sie nicht mehr gesehen, ist seine Antwort. Ich überlege hin und her und schlage ihm vor, wenn ich weg bin, zu ihr zu gehen, um alles zu klären. Falls nötig soll er ihr Schmuck kaufen, doch wenn ich zurück bin, sollte diese Angelegenheit erledigt sein. Er antwortet nicht, und so weiß ich auch am Tag meines Aufbruchs nicht, was er tun wird. Doch ich vertraue ihm und unserer Liebe.
Ich verabschiede mich von der Mama und von Saguna, die mich offensichtlich ins Herz geschlossen haben. „Hakuna, matata, keine Probleme“, lache ich ihnen entgegen, und dann fahren wir mit unserem Landrover nach Maralal, weil ich ihn in der Garage zwischenzeitlich reparieren lassen möchte. Lketinga will zu Fuß zurückgehen. Im Busch treffen wir auf eine kleine Gruppe von Büffeln, die aber sofort das Weite suchen, als sie den Motor hören. Trotzdem nimmt Lketinga sofort seine Speere zur Hand und gibt ein grunzendes Geräusch von sich. Lachend schaue ich ihn an, und er beruhigt sich wieder.
Wir parken gleich in der Garage, damit nicht noch mehr Leute auf den verbeulten Kotflügel aufmerksam werden. Der Chef-Somali kommt und schaut sich den Schaden an.
Etwa sechshundert Franken würde es schon kosten, sagt er. Ich bin bestürzt, daß dieser Schaden ein Viertel des Kaufpreises kosten soll. Hartnäckig verhandle ich, und schließlich bleibt es bei dreihundertfünfzig Franken, was immer noch viel zu hoch ist. Die Nacht verbringen wir in unserem Stamm-Lodging. Geschlafen wird nicht viel, zum einen wegen meiner Abreise, zum anderen wegen der vielen Moskitos. Der Abschied ist schwer, und Lketinga steht etwas verloren neben dem abfahrenden Bus. Ich vermumme mein Gesicht, um nicht völ ig verstaubt in Nairobi anzukommen.
Fremde Schweiz
Im Rucksack-Hotel Igbol finde ich ein Zimmer und esse mich erst einmal richtig satt. Ich checke jede Fluggesel schaft durch, bis ich endlich bei Allitalia einen Flug bekomme. Nach mehreren Monaten telefoniere ich wieder nach Hause. Die Aufregung ist groß, als ich meiner Mutter mitteile, daß ich für kurze Zeit nach Hause komme. Die bis zum Abflug verbleibenden zwei Tage in Nairobi empfinde ich als Plage. Kreuz und quer streune ich durch die Straßen, um die Zeit totzuschlagen. An jeder Ecke stehen Krüppel und Bettler, denen ich mein Kleingeld gebe. Abends im Igbol unterhalte ich mich mit Weltenbummlern oder halte mir mühsam Inder und Afrikaner vom Leib, die mir ihre Dienste als Boyfriend offerieren.
Endlich sitze ich im Taxi zum Flughafen. Als das Flugzeug abhebt, kann ich mich nicht so recht freuen auf „zu Hause“, weil ich weiß, wie verzweifelt Lketinga und der Rest der Familie auf meine Rückkehr warten.
In Meiringen im Berner Oberland, wo meine Mutter mit ihrem Mann lebt, fühle ich mich nach der ersten Wiedersehensfreude nicht wohl. Alles läuft wieder nach europäischem Zeitplan. In den Lebensmittelgeschäften wird es mir bei all dem Überfluß fast schlecht, und auch die Kühlschrankkost bekommt mir nicht mehr.
Ständig habe ich Magenbeschwerden.
Bei der Gemeinde besorge ich mir eine Bescheinigung auf Deutsch und Englisch, daß ich noch ledig bin. Wenigstens sind nun meine Papiere in Ordnung. Meine Mutter kauft für „meinen Krieger“ als Hochzeitsgeschenk eine wunderschöne Kuhglocke. Auch ich besorge einige kleinere Glöckchen für meine Ziegen. Immerhin besitze ich schon vier eigene. Für Mama und Saguna nähe ich je zwei neue Röcke und erwerbe für Lketinga und mich zwei wunderschöne Wolldecken, eine knallrote für ihn, eine gestreifte für uns beide zum Zudecken.
Das Packen gestaltet sich nicht einfach. Ganz unten in der Reisetasche verstaue ich mein langes, weißes Hochzeitskleid, das ich zum Abschluß meiner Geschäftstätigkeit von einem Lieferanten geschenkt bekam. Damals versprach ich ihm, fal s ich jemals heiraten sollte, es zu tragen, also muß es unbedingt mit, samt dem dazugehörigen Kopfschmuck. Auf das Brautkleid packe ich Puddingbeutel, Saucen und Suppen. Darauf lege ich die Geschenke. Die Zwischenräume fül e ich mit Arzneimitteln, Pflaster, Verband, Wundsalben und Vitamintabletten. Obenauf kommen die Decken. Beide Taschen sind gestopft vol.
Die Abreise rückt näher. Meine gesamte Familie bespricht eine Kassette für Lketinga zu unserer Hochzeit. Deshalb muß auch noch ein kleines Radio-Kassettengerät in die Reisetasche. Mit zweiunddreißig Kilo Gepäck stehe ich am Flughafen Kloten zum Abflug bereit. Ich freue mich riesig auf die Heimreise. Ja, wenn ich in mein Innerstes horche, weiß ich jetzt, wo mein wirkliches Zuhause ist. Natürlich fäl t mir der Abschied von meiner Mutter schwer, doch mein Herz gehört bereits Afrika. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme.
Heimat Afrika
In Nairobi fahre ich mit einem Taxi zum Igbol-Hotel. Der Fahrer bemerkt den Massai-Schmuck an meinen Armen und fragt, ob ich die Massai gut kenne. „Yes, I go to marry a Samburu-man“,
ist meine Antwort. Der Driver schüttelt den Kopf und versteht anscheinend nicht, warum eine Weiße ausgerechnet einen Mann aus der, wie er es nennt, primitiven Volksgruppe heiraten will. Ich verzichte auf ein weiteres Gespräch und bin froh, endlich im Igbol angekommen zu sein. Doch heute habe ich kein Glück. Alle Zimmer sind besetzt. Ich suche nach einem anderen, günstigen Lodging und finde zwei Straßen weiter eine Möglichkeit.
Das Schleppen meiner Tasche bereitet mir trotz der kurzen Strecke enorme Mühe.
Dann muß ich noch drei Stockwerke hoch, bis ich in meinem Verschlag bin. Es ist bei weitem nicht so gemütlich wie im Igbol, und ich bin hier die einzige Weiße. Das Bett hängt durch, und unter dem Bettgestell liegen zwei gebrauchte Kondome.
Wenigstens sind die Bettlaken sauber. Ich gehe noch schnel ins Igbol, weil ich nach Maralal in die Mission telefonieren möchte. Von dort könnten sie morgen beim üblichen Radio-Funk in der Barsaloi-Mission melden, daß ich in zwei Tagen in Maralal eintreffe. Somit wüßte auch Lketinga von meiner Ankunft. Diese Idee kam mir im Flugzeug, und ich wil es ausprobieren, obwohl ich die Maralal-Missionare nicht kenne. Ob es gelingt, weiß ich nach dem Gespräch nicht. Mein Englisch ist besser geworden, doch gab es während des Gesprächs mehrere Mißverständnisse, denn der gute Missionar begriff meine Botschaft nur zögernd.
In der Nacht schlafe ich schlecht. Anscheinend bin ich in einem Stundenhotel der Einheimischen gelandet, denn links und rechts in den Räumen wird gequietscht, gestöhnt oder gelacht. Türen schlagen auf und zu. Aber auch diese Nacht geht vorüber.
Die Busfahrt nach Nyahururu verläuft ohne Hindernisse. Ich schaue aus dem Fenster und erfreue mich an der Landschaft. Mein Zuhause rückt immer näher. In Nyahururu regnet es, und es ist kalt. Ich muß noch einmal übernachten, bevor ich am nächsten Morgen den vergammelten Bus nach Maralal nehmen kann. Die Abfahrt verzögert sich um anderthalb Stunden, weil das Gepäck auf dem Busdach mit Plastikplanen zugedeckt werden muß. Auch meine große, schwarze Reisetasche befindet sich dort oben. Die kleinere behalte ich bei mir.
Nach der kurzen Asphaltstraße biegen wir in die Naturstraße ein. Aus rotem Staub ist rotbrauner Schlamm geworden. Der Bus fährt noch langsamer als sonst, um ja nicht in die großen Löcher zu geraten, die jetzt mit Wasser gefüllt sind. Er schlängelt sich vorwärts, steht manchmal fast quer und spult sich wieder auf die Fahrbahn. Wir werden die doppelte Fahrzeit benötigen. Die Straße wird immer schlimmer. Ab und zu steckt ein Fahrzeug im Schlamm fest, und verschiedene Menschen versuchen es wieder flott zu kriegen. Zum Teil liegt die Fahrspur dreißig Zentimeter tiefer als der Schlamm daneben. Durch die Fenster sieht man kaum etwas, so verspritzt sind sie.
Nach etwa der Hälfte der Strecke gerät der Bus ins Wanken und dreht mit dem Hinterteil so ab, daß er quer steht. Die hinteren Räder stecken im Straßengraben.
Nichts geht mehr, die Räder drehen durch. Zuerst müssen alle Männer raus. Der Bus rutscht zwei Meter zur Seite und steckt wieder fest. Nun müssen al e aussteigen.
Kaum habe ich den Bus verlassen, stecke ich bis zu den Knöcheln im Schlamm. Wir stehen auf einer erhöhten Wiese und beobachten die vergeblichen Bemühungen.
Viele, auch ich, schlagen Äste von den Büschen, die dann unter die Räder geschoben werden. Aber es nützt al es nichts. Der Bus steht immer noch quer.
Einige packen ihre Habseligkeiten und gehen zu Fuß weiter. Ich frage den Fahrer, was jetzt passiert. Er zuckt mit den Schultern und meint, wir müßten bis morgen warten. Viel eicht höre es auf zu regnen, dann trockne die Straße schnel.
Verzweifelt stecke ich wieder einmal mitten im Busch fest ohne Wasser und Eßwaren, nur mit Puddingpulver, das mir nichts nützt. Es wird schnell kalt, und ich friere in meinen nassen Sachen. Ich begebe mich wieder zu meinem Sitz.
Wenigstens habe ich eine warme Wol decke bei mir. Falls Lketinga die Nachricht überhaupt bekommen hat, wartet er jetzt vergebens in Maralal. Vereinzelt packen die Leute Eßbares aus. Jeder, der etwas hat, teilt es mit seinen Nachbarn. Auch mir werden Brot und Früchte angeboten. Ich nehme dankend, aber beschämt an, denn ich habe nichts anzubieten, obwohl ich am meisten Gepäck dabei habe. Alle richten sich im Sitzen zum Schlafen ein, so gut es geht. Die wenigen freien Plätze gehören den Frauen mit Kindern. In der Nacht kommt nur noch ein Landrover vorbei, der jedoch nicht hält.








