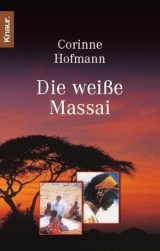
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Allein sitze ich auf dem Bett und verfal e in einen schlimmen Weinkrampf. Natürlich könnte ich den Wagen nehmen und das Dorf verlassen, aber ohne mein Kind kommt diese Möglichkeit nicht in Frage. Draußen höre ich Stimmen und Gelächter. Einige Leute scheinen sich über den Vorfal zu freuen. Nach einer Weile erscheint der Veterinär mit seiner Frau, um nach mir zu sehen. Sie haben alles mitangehört und versuchen, mich zu beruhigen. In dieser Nacht schließe ich kein Auge, sondern bete, daß wir eines Tages von hier wegkommen. Von meiner Liebe ist im Moment nur blanker Haß geblieben. Wie sich alles in der kurzen Zeit so wandeln konnte, kann ich nicht begreifen.
Am frühen Morgen gehe ich schnel in den hinteren Teil des Shops, um den Boys mitzuteilen, daß Lketinga Rachepläne gegen den einen von ihnen hegt. Dann eile ich zur Mama, da ich Napirai immer noch stillen muß. Mama sitzt mit ihr vor der Hütte.
Mein Mann schläft noch. Ich nehme mein Kind, stil e es, und Mama fragt mich doch tatsächlich, ob Lketinga der Vater sei. Mit Tränen in den Augen antworte ich nur:
„Yes.“
Ohnmacht und Wut
Mein Mann kriecht aus der Manyatta und befiehlt mir, in unsere Blockhütte zu kommen. Auch die Boys holt er zu uns. Wie so häufig stehen einige Neugierige herum. Mir klopft das Herz bis zum Hals, ich weiß nicht, was passieren wird. Erregt redet er auf mich ein und fragt vor al en Anwesenden, ob ich mit diesem Boy geschlafen habe. Er wil es jetzt wissen. Ich schäme mich sehr, und gleichzeitig überkommt mich eine Riesenwut. Wie ein Richter führt er sich auf und merkt gar nicht, wie lächerlich er uns macht. „No“, schreie ich ihn an, „you are crazy!“
Noch bevor ich mehr sagen kann, bekomme ich die erste Ohrfeige. Wütend schleudere ich ihm mein Zigarettenpaket an den Kopf. Da dreht er sich um und richtet seinen Rungu gegen mich. Doch bevor er ihn benutzen kann, reagieren die Boys und der Veterinär. Sie halten ihn fest, reden empört auf ihn ein und meinen, es wäre besser, wenn er für einige Zeit in den Busch ginge, bis er wieder einen klaren Kopf hat. Daraufhin nimmt er seine Speere und zieht ab. Ich stürze in mein Haus und wil niemand mehr sehen.
Zwei Tage bleibt er weg, während ich das Haus nicht verlasse. Wegfahren könnte ich nicht, da mir auch gegen Bezahlung niemand helfen würde. Den ganzen Tag höre ich deutsche Musik oder lese Gedichte, die mir helfen, meine Gedanken zu sammeln. Gerade bin ich dabei, einen Brief nach Hause zu schreiben, als unvermutet mein Mann erscheint. Er stellt die Musik ab und fragt, warum bei uns gesungen werde und woher ich diese Kassette habe. Natürlich hatte ich sie schon immer, was ich möglichst ruhig vorbringe. Er glaubt es nicht. Dann entdeckt er den Brief an meine Mutter. Ich muß ihn vorlesen, aber er bezweifelt, daß ich den Inhalt richtig wiedergebe. Also zerreiße ich den Brief und verbrenne ihn. Zu Napirai sagt er kein Wort, als wäre sie gar nicht hier. Er ist relativ ruhig, und so versuche ich, ihn nicht zu reizen. Letztlich muß ich mich mit ihm versöhnen, wenn ich hier eines Tages wegkommen wil.
Die Tage verstreichen ruhig, da auch der Boy nicht mehr in Barsaloi wohnt. Von James erfahre ich, daß er zu Verwandten gezogen ist. Der Shop bleibt geschlossen, und nach vierzehn Tagen haben wir kein Essen mehr. Ich will nach Maralal, aber mein Mann verbietet es. Er erklärt, andere Frauen leben auch nur von Milch und Fleisch.
Immer wieder spreche ich von Mombasa. Falls wir dorthin ziehen, würde mich meine Familie sicher unterstützen. Für hier oben gibt es kein Geld mehr. Wir könnten auch jederzeit hierher zurückkommen, wenn es mit dem Geschäft nicht klappen sollte. Als eines Tages auch James sagt, er müsse Barsaloi verlassen, um einen Job zu finden, fragt Lketinga zum ersten Mal, was wir denn in Mombasa machen würden.
Sein Widerstand läßt offensichtlich nach. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben.
Meine Musik und die Bücher habe ich vernichtet. Briefe schreibe ich keine mehr.
Sogar im Intimen lasse ich ihn gewähren, wenn auch widerwil ig. Ich habe nur ein Ziel: Weg von hier, und zwar mit Napirai!
Ich schwärme von einem schönen Massai-Shop mit vielen Souvenirs. Für die Reise nach Mombasa könnten wir alles im Shop an die Somalis verkaufen. Selbst die Wohnungseinrichtung bringt noch Geld, da hier sonst keine Möglichkeit besteht, zu Bett, Stuhl oder Tisch zu kommen. Wir könnten auch eine Abschiedsdisco veranstalten, um Geld zu verdienen und uns gleichzeitig von den Menschen zu verabschieden. James könnte uns begleiten und beim Aufbau des Geschäftes helfen. Ich rede und rede und versuche, meine Nervosität zu verbergen. Er darf nicht merken, wie wichtig sein Einverständnis für mich ist.
Schließlich meint er gelassen: „Corinne, maybe we go to Mombasa in two or three months.“
Erschrocken frage ich, warum er noch so lange warten will. Dann sei Napirai ein Jahr alt und brauche mich nicht mehr, sie könne bei seiner Mama bleiben. Diese Aussage erschreckt mich zutiefst. Für mich ist klar, nur mit Napirai wegzugehen, was ich ihm auch ruhig mitteile. Ich brauche meine Tochter, sonst habe ich keine Freude am Arbeiten. Jetzt hilft mir auch James. Er will auf Napirai aufpassen. Und falls wir gehen wollen, müsse es jetzt sein, fügt James hinzu, da er in drei Monaten sein Beschneidungsfest hat. Dann gehört er zu den Kriegern und mein Mann zu den Alten. Das Fest dauert ein paar Tage, und danach darf er lange Zeit nur mit den gerade beschnittenen Männern zusammen sein. Wir beraten hin und her und einigen uns, in knapp drei Wochen aufzubrechen.
Am 4. Juni ist mein 30. Geburtstag, und den will ich in Mombasa feiern. Voller Ungeduld lebe ich nur noch auf den Tag hin, an dem wir Barsaloi verlassen werden.
Da es Monatsbeginn ist, wollen wir die Disco so rasch wie möglich durchführen.
Wir fahren das letzte Mal nach Maralal, um Bier und andere Getränke zu organisieren. In Maralal will mein Mann, daß ich in die Schweiz telefoniere, um abzuklären, ob wir für Mombasa Geld bekommen. Ich täusche das Gespräch vor und teile ihm anschließend mit, es sei alles in Ordnung. Sobald wir in Mombasa sind, solle ich mich wieder melden.
Die Disco ist wieder ein großer Erfolg. Mit Lketinga habe ich abgemacht, daß wir um Mitternacht zusammen eine Abschiedsrede halten werden, da die Leute von unserem Weggehen nichts ahnen. Nach einiger Zeit schleicht sich mein Mann jedoch davon. Um Mitternacht stehe ich also alleine da, und ich bitte den Veterinär, meine Rede, die ich in Englisch vorbereitet habe, in Suaheli für die Arbeiter und in Massai für die Einheimischen zu übersetzen.
James stellt die Musik aus, und al e halten verblüfft inne. Nervös stehe ich in der Mitte des Raumes und bitte um Aufmerksamkeit. Zuerst entschuldige ich die Abwesenheit meines Mannes. Dann eröffne ich mit Bedauern, daß dies unsere letzte Disco sei und wir in gut zwei Wochen Barsaloi verlassen, um ein neues Business in Mombasa zu starten. Es sei uns einfach nicht möglich, mit einem teuren Wagen hier oben zu existieren. Auch sei meine Gesundheit sowie die meiner Tochter dauernd gefährdet. Ich bedanke mich bei al en für ihre Treue zum Shop und wünsche ihnen viel Glück mit der neuen Schule.
Kaum habe ich meine Rede beendet, entsteht große Aufregung, und alle reden durcheinander. Sogar der Mini-Chief ist bedrückt und sagt, jetzt, nachdem mich alle akzeptiert haben, könne ich doch nicht einfach weggehen. Zwei andere sprechen lobende Worte über uns und bedauern den Verlust, den sie mit unserem Wegzug erleiden werden. Allen hätten wir etwas Leben und Abwechslung geboten, ganz zu schweigen von den vielen Hilfeleistungen mit meinem Wagen. Die Leute klatschen.
Ich bin sehr bewegt und bitte sofort wieder um Musik, damit die Freude zurückkehrt.
Mitten im Getümmel steht der junge Somali neben mir und bedauert ebenfalls unseren Entschluß. Er habe immer bewundert, was ich gemacht habe. Gerührt lade ich ihn auf ein Soda ein und biete ihm bei dieser Gelegenheit den Rest aus unserem Shop zum Kauf an. Er willigt sofort ein. Wenn ich die Inventur erstel t habe, wil er mir den vol en Einkaufspreis bezahlen, ja sogar die teure Waage will er mir abnehmen.
Lange unterhalte ich mich noch mit dem Veterinär. Für ihn ist unser Wegzug auch eine Neuigkeit. Nach dem, was vorgefallen ist, kann er mich gut verstehen. Er hofft, daß mein Mann in Mombasa wieder vernünftiger wird. Wahrscheinlich ist er der einzige, der den wahren Grund unseres Fortgehens ahnt.
Um zwei schließen wir, ohne daß Lketinga wiedergekommen ist. Ich eile zur Manyatta, um Napirai abzuholen. Mein Mann sitzt in der Hütte und unterhält sich mit der Mama. Auf die Frage, warum er nicht da war, gibt er zur Antwort, daß es mein Fest war, denn ich wol e ja weg von hier. Diesmal lasse ich mich auf keine Diskussion ein, sondern bleibe in der Manyatta. Vielleicht ist es das letzte Mal, daß ich in einer solchen übernachte, geht es mir durch den Kopf.
Bei nächster Gelegenheit berichte ich Lketinga von der Vereinbarung mit dem Somali. Zuerst reagiert er sauer und will nicht darauf eingehen. Er verhandle nicht mit ihnen, verkündet er hochmütig. Also mache ich die Inventur mit James. Der Somali bittet, ihm die Ware in zwei Tagen zu bringen, dann werde er das Geld beisammen haben. Allein die Waage macht schon ein Drittel der Summe aus.
An der Blockhütte erscheinen immer wieder Leute, die etwas abkaufen wol en. Bis zur letzten Tasse ist al es reserviert. Am 20. will ich das Geld, am 21. morgens kann jeder seine Ware abholen, lautet die Abmachung. Als wir unsere Verkaufsgüter zum Somali bringen wol en, kommt mein Mann doch mit. Jeden Preis hat er zu beanstanden. Als ich die Waage bringe, packt er sie gleich wieder weg. Diese wil er nach Mombasa mitnehmen. Er will einfach nicht einsehen, daß wir sie nicht mehr brauchen und hier wesentlich mehr dafür bekommen. Nein, sie muß mit, und es ärgert mich maßlos, dem Somali so viel Geld zurückgeben zu müssen, doch ich schweige. Nur keinen Streit mehr vor der Abreise! Es dauert noch gut eine Woche bis zum 21. Mai.
Mit vorsichtigem Abwarten schleichen die Tage dahin, und meine innere Spannung wächst, je näher die Abreise rückt. Ich werde keine Stunde länger als nötig bleiben.
Die letzte Nacht steht bevor. Fast al e haben ihr Geld gebracht, und was wir nicht mehr brauchen, haben wir weggegeben. Der Wagen ist vol bepackt, und im Haus stehen nur noch das Bett mit Moskitonetz, Tisch und Stühle. Die Mama war den ganzen Tag bei uns und hat Napirai gehütet. Sie ist betrübt über unsere Abreise.
Gegen Abend hält ein Wagen im Dorf beim Somali, und mein Mann geht sofort hinunter, da es eventuell Miraa zu kaufen gibt. Inzwischen stellen James und ich die Tagesrouten zusammen. Wir sind beide sehr aufgeregt wegen der langen Reise. Es sind fast 1460 km bis zur Südküste.
Weil mein Mann nach einer Stunde noch nicht zurück ist, werde ich unruhig.
Endlich erscheint er, und ich sehe ihm gleich an, daß etwas nicht stimmt. „We cannot go tomorrow“,
verkündet er. Natürlich kaut er wieder Miraa, dennoch ist es sein voller Ernst. Mir wird siedend heiß, und ich frage, wo er so lange war und warum wir morgen nicht abreisen können. Mit wirren Augen schaut er uns an und erklärt, die Alten seien unzufrieden, da wir losfahren wollen ohne ihren Segen. Unmöglich könne er so aufbrechen.
Erregt frage ich, warum dieses Schutzgebet nicht morgen früh abgehalten werden kann, worauf mir James erklärt, wir müßten vorher mindestens ein bis zwei Ziegen schlachten und Bier brauen. Erst wenn sie in guter Stimmung sind, sind sie bereit, uns den „Enkai“ zu sprechen. Er verstehe Lketinga, wenn er ohne dieses Gebet nicht fahren will.
Jetzt verliere ich die Nerven und schreie Lketinga an, warum diese Alten nicht vorher mit dieser Idee gekommen seien. Seit drei Wochen wissen sie, wann wir aufbrechen wol en, wir haben ein Fest gemacht, haben alles verkauft und den Rest eingepackt. Ich bleibe keinen Tag länger, ich fahre, und wenn ich mit Napirai al ein fahren muß! Ich tobe und heule, weil mir schlagartig bewußt ist, daß diese
„Überraschung“ uns mindestens eine Woche länger zurückhält, da das Bier vorher nicht gebraut sein kann.
Lketinga bekundet lediglich, daß er nicht fährt, und kaut sein Kraut, während James das Haus verläßt, um Rat bei der Mama zu suchen. Ich liege auf dem Bett und möchte am liebsten sterben. In meinem Kopf hämmert es fortwährend: Ich fahre morgen, ich fahre morgen. Weil ich kaum schlafe, bin ich völ ig erschlagen, als frühmorgens James mit der Mama erscheint. Wieder wird palavert, doch ich interessiere mich nicht dafür und packe stur weiter unsere Sachen. Durch meine verquollenen Augen nehme ich alles nur schemenhaft wahr. James redet mit der Mama, während viele Menschen herumstehen, um ihre Sachen abzuholen oder Abschied zu nehmen. Ich schaue niemanden an.
James kommt zu mir und fragt im Auftrag von Mama, ob ich wirklich fahren will.
„Yes“, ist meine Antwort, und dabei binde ich Napirai seitlich an mich. Mama schaut ihr Enkelkind und mich lange stumm an. Dann sagt sie etwas zu James, das sein Gesicht erhellt. Freudig teilt er mir mit, Mama gehe los und bringe vier Alte aus Barsaloi, um uns den Segen auch so zu sprechen. Sie wil nicht, daß wir ohne ihn losfahren, denn sie ist sich sicher, uns das letzte Mal zu sehen. Dankbar bitte ich James, ihr zu übersetzen, wo immer ich auch sein werde, werde ich für sie sorgen.
Die gute Spucke
Wir warten eine knappe Stunde, und es kommen immer mehr Menschen. Ich verkrieche mich im Haus. Tatsächlich erscheint Mama mit drei alten Männern. Wir drei stehen neben dem Wagen, und Mama spricht vor, worauf al e im Chor „Enkai“ wiederholen. Es dauert etwa zehn Minuten, ehe wir im Guten ihre Spucke auf die Stirn gedrückt bekommen. Die Zeremonie ist beendet, und ich bin erleichtert. Jedem der Alten drücke ich noch irgendeinen brauchbaren Gegenstand in die Hand, während Mama auf Napirai zeigt und scherzhaft meint, sie wol e nur unser Baby.
Dank ihrer Hilfe habe ich gewonnen. Sie ist die einzige, die ich noch einmal in die Arme schließe, bevor ich mich hinter das Steuer setze. Napirai gebe ich nach hinten zu James. Lketinga zögert noch einzusteigen. Als ich den Motor anlasse, setzt auch er sich mürrisch in den Wagen. Ohne Blick zurück brause ich davon. Ich weiß, es wird ein langer Weg, doch er führt in die Freiheit.
Mit jedem Kilometer, den ich zurücklege, kehrt Kraft in mich zurück. Ich werde durchfahren bis Nyahururu, dann erst kann ich wieder ruhig atmen. Etwa eine Stunde vor Maralal wird unsere Fahrt durch einen Platten gestoppt. Wir sind bis unter das Dach beladen, und das Reserverad liegt ganz unten! Aber ich nehme es gelassen, denn es wird sicher der letzte Radwechsel auf Samburu-Boden sein.
Der nächste Stop ist bei Ruurutti, kurz vor Nyahururu, wo die geteerte Straße beginnt. Eine Polizeikontrolle hält uns an. Sie wollen mein Logbuch sehen sowie meinen Internationalen Führerschein. Dieser ist schon lange abgelaufen, was sie nicht merken. Dafür werde ich aufgefordert, den Wagen zur Kontrol e zu bringen, damit ich an der Scheibe einen neuen Aufkleber mit unserer Adresse bekomme, da dies Vorschrift sei. Ich staune, denn in Maralal kennt man diesen Aufkleber nicht.
In Nyahururu übernachten wir erstmals und erkundigen uns am nächsten Tag, wo dieser Aufkleber zu besorgen ist. Erneut beginnt der Streß mit der Bürokratie. Zuerst muß der Wagen in die Garage, damit alle Mängel behoben werden, und danach bezahlt man für die Anmeldung zur Überprüfung. Er bleibt einen vollen Tag im Service, was wiederum viel Geld kostet. Am zweiten Tag können wir ihn vorführen.
Ich bin überzeugt, daß al es klappt. Doch als wir schließlich an der Reihe sind, bemängelt der Prüfer sofort die geflickte Batterie und den fehlenden Aufkleber. Ich erkläre ihm, daß wir gerade umziehen und noch nicht wissen, welche Adresse wir in Mombasa haben werden. Es interessiert ihn nicht im geringsten. Ich bekomme keinen Aufkleber ohne feste Adresse. Wir fahren wieder weg, und mir wird das Ganze zu dumm. Ich verstehe nicht, warum es auf einmal so kompliziert ist und fahre einfach weiter. Zwei Tage haben wir gewartet und Geld ausgegeben für nichts. Ich wil nach Mombasa. Wir fahren einige Stunden, um kurz hinter Nairobi in einem Dörfchen ein Lodging zu beziehen. Ich bin völlig erledigt von der Fahrerei, da mich der Linksverkehr viel Konzentration kostet. Jetzt muß ich Windeln waschen und Napirai stillen. Zum Glück schläft sie auf den ungewohnt glatten Straßen viel.
Am nächsten Tag erreichen wir nach sieben Stunden Mombasa. Hier ist das Klima tropisch heiß. Erschöpft stel en wir uns in die Kolonne der wartenden Autos, um mit der Fähre auf die Südseite zu gelangen. Ich krame den Brief von Sophia hervor, den sie mir vor einigen Monaten kurz nach ihrer Ankunft in Mombasa zukommen ließ.
Ihre Adresse ist nahe bei Ukunda. Meine ganze Hoffnung, für den heutigen Abend ein Dach über dem Kopf zu haben, liegt bei ihr.
Nach nochmals gut einer Stunde finden wir den Neubau, in dem Sophia jetzt lebt.
Aber niemand öffnet in dem feudalen Haus. Ich klopfe nebenan, und es erscheint eine Weiße, die mir berichtet, Sophia sei für zwei Wochen nach Italien gereist. Meine Enttäuschung ist groß, und ich überlege, wo wir noch Unterkunft finden könnten.
Eigentlich kommt nur noch Priscilla in Frage, aber mein Mann weigert sich, da er lieber an die Nordküste will. Damit bin ich nicht einverstanden, weil ich dort so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Die Stimmung ist gereizt, deshalb fahre ich einfach zu unserem alten Village. Dort stellen wir fest, daß von den fünf Häuschen nur noch eines bewohnbar ist. Wenigstens erfahren wir, daß Priscilla in das nächste Village, fünf Minuten mit dem Wagen entfernt, gezogen ist.
Sehr schnell erreichen wir das Kamau-Village, das hufeisenförmig angelegt ist. Die Gebäude sind aneinander gebaute Zimmer wie die Lodgings in Maralal, in der Mitte mit einem großen Shop. Sofort bin ich begeistert von diesem Vil age. Als wir aus dem Wagen steigen, erscheinen neugierig die ersten Kinder, und aus dem Shop lugt der Besitzer. Plötzlich kommt Priscil a auf uns zu. Sie kann es kaum glauben, uns hier zu sehen. Ihre Freude ist groß, besonders als sie Napirai entdeckt. Auch sie hat in der Zwischenzeit noch einen Jungen bekommen, der etwas älter als Napirai ist. Gleich nimmt sie uns in ihr Zimmer mit, kocht Tee, und wir müssen erzählen. Als sie erfährt, daß wir in Mombasa bleiben wollen, ist sie überglücklich. Sogar Lketinga lässt sich zum ersten Mal seit der Abreise von ihrer Freude anstecken. Sie bietet uns ihr Zimmer an und sogar ihr Wasser, das auch hier in großen Kanistern aus dem Brunnen geholt wird. Heute abend wird sie bei einer Freundin schlafen, und morgen wil sie uns etwas Eigenes organisieren. Wieder einmal bin ich überwältigt, wie unkompliziert und gastfreundlich sie ist.
Nach der anstrengenden Fahrt gehen wir früh schlafen. Am nächsten Morgen hat Priscil a für uns bereits ein Zimmer am Anfang der Reihe aufgetrieben, damit unser Wagen nebenan stehen kann. Der Raum ist etwa drei mal drei Meter. Alles ist aus Beton, nur das Dach ist aus Stroh. Heute sehen wir auch einige der anderen Bewohner. Es sind alles Samburu-Krieger, die wir zum Teil sogar noch kennen.
Lketinga spricht und lacht schon bald mit ihnen, während er Napirai stolz bei sich hat.
Neue Hoffnung
Als ich zum ersten Mal den Shop besichtige, fühle ich mich wie im Paradies. Hier bekomme ich einfach al es, sogar Brot, Milch, Butter, Eier, Früchte, und das zweihundert Meter von der Wohnung entfernt! In bezug auf eine neue Existenz in Mombasa wächst meine Zuversicht.
James will endlich das Meer sehen, und wir machen uns zusammen auf den Weg.
Zu Fuß erreichen wir den Strand in knapp einer halben Stunde. Der Anblick des Meeres erfüllt mich mit Freude und einem Gefühl der Freiheit. Was ich allerdings nicht mehr gewohnt bin, sind die weißen Touristen in ihren knappen Badehosen.
James, der das noch nie gesehen hat, schaut verschämt darüber hinweg und bestaunt die Wassermasse. Er ist, wie damals sein älterer Bruder, völlig irritiert.
Dafür spielt Napirai freudig im Sand unter schattenspendenden Palmen. Hier kann ich mir mein Leben in Kenia wieder vorstel en.
Wir gehen in eine für Europäer errichtete Beach-Bar, um unseren Durst zu stillen.
Alle starren uns an, und ich komme mir in meinem geflickten, wenn auch sauberen Rock unter den neugierigen Blicken etwas verloren vor. Von meinem früheren Selbstvertrauen ist nicht viel übriggeblieben. Als mich eine Deutsche anspricht und wissen will, ob Napirai mein Baby sei, fehlen mir sogar die Worte, um zu antworten.
Zu lange habe ich kein Deutsch oder gar Schweizerdeutsch mehr gesprochen. Ich komme mir wie eine Idiotin vor, als ich in Englisch antworten muß.
Lketinga fährt am nächsten Tag an die Nordküste. Dort wil er ein paar Schmuckstücke einkaufen, um bei den Massai-Tänzen mit anschließendem Schmuckverkauf mitmachen zu können. Ich freue mich, daß auch er sich fürs Geldverdienen interessiert. Zu Hause wasche ich Windeln, während James mit Napirai spielt. Zusammen mit Priscilla schmieden wir Zukunftspläne. Sie ist begeistert, als ich ihr eröffne, daß ich einen Laden suche, um mit den Touristen ins Geschäft zu kommen. Da James nicht länger als einen Monat bleiben kann, weil er wegen seiner großen Beschneidungszeremonie nach Hause muß, beschließe ich, mit Priscilla die Hotels abzuklappern, um eventuell einen freien Laden zu finden.
In den feudalen Hotels werden wir von den Geschäftsführern zum Teil skeptisch empfangen, um dann auch gleich eine Absage zu bekommen. Beim fünften Hotel ist mein ohnehin geringes Selbstvertrauen geschwunden, und ich komme mir wie eine Bettlerin vor. Natürlich sehe ich nicht wie eine ordentliche Geschäftsfrau aus mit meinem rotkarierten Rock und dem Baby auf dem Rücken. Per Zufall hört ein Inder an einer Rezeption unser Gespräch und schreibt mir eine Telefonnummer auf, unter der ich seinen Bruder erreichen kann. Schon am nächsten Tag fahren mein Mann, James und ich nach Mombasa, um uns mit diesem Mann zu treffen. Er hat in der Nähe eines Supermarktes in einer neu erstel ten Siedlung etwas frei, al erdings für umgerechnet 700 Franken Miete im Monat. Zuerst wil ich schon abwinken, da mir dieser Betrag viel zu hoch erscheint doch dann lasse ich mir das Gebäude zeigen.
Das Geschäft liegt ganz feudal etwas abseits der Hauptstraße am Diani-Beach. Mit dem Auto sind es fünfzehn Minuten von zu Hause. Im Gebäude ist bereits ein riesiger, indischer Souvenirshop und gegenüber ein neu eröffnetes Chinarestaurant, der Rest steht leer. Da das Ganze treppenförmig angelegt ist, sieht man von der Straße den Laden nicht. Trotzdem ergreife ich diese Möglichkeit, obwohl es nur etwa 60 Quadratmeter sind. Der Raum ist absolut kahl, und Lketinga versteht nicht, warum ich soviel Geld für einen leeren Laden ausgebe. Er geht weiterhin zu den Touristenaufführungen, doch das erwirtschaftete Geld verschwindet beim anschließenden Bier– oder Miraakonsum, was zu unschönen Auseinandersetzungen führt.
Während Einheimische nach meinen Plänen die Holzgestelle bauen, organisiere ich mit James in Ukunda Holzpfähle und bringe sie mit dem Wagen zum Shop.
Tagsüber arbeiten wir wie die Wilden, während mein Mann mit anderen Kriegern in Ukunda herumhängt.
Am Abend koche und wasche ich meistens noch, und wenn Napirai schläft, unterhalte ich mich mit Priscil a. Lketinga nimmt bei Anbruch der Nacht den Wagen und fährt die Krieger zu den verschiedenen Aufführungsplätzen. Mir ist dabei nicht wohl, weil er keinen Führerschein hat und außerdem Bier trinkt. Wenn er nachts wieder erscheint, weckt er mich und will wissen, mit wem ich mich unterhalten habe.
Sind nebenan schon einige Krieger zu Hause, ist er überzeugt, daß ich mit ihnen gesprochen habe. Ich warne ihn eindringlich, er sol e nicht wieder al es kaputt machen mit seiner Eifersucht. Auch James versucht, ihn zu beruhigen.
Endlich ist Sophia zurück. Es ist eine große Wiedersehensfreude. Sie kann kaum glauben, daß wir bereits dabei sind, ein Geschäft aufzubauen. Sie ist schon seit fünf Monaten hier und hat ihr Caféhaus immer noch nicht eröffnet. Allerdings wird meine Euphorie gebremst, als sie mir von all der Bürokratie, die auf mich zukommt, erzählt.
Im Gegensatz zu uns wohnt sie komfortabel. Fast täglich sehen wir uns kurz, was meinem Mann eines Tages nicht mehr gefäl t. Er versteht nicht, was wir uns mitzuteilen haben, und nimmt an, ich erzähle von ihm. Sophia versucht ihn zu beruhigen und schlägt ihm vor, er solle doch weniger Bier trinken.
Seit dem Mietabschluß für den Shop sind vierzehn Tage vergangen, und die Einrichtung steht bereits. Ich möchte Ende des Monats eröffnen, und wir müssen die Verkaufslizenz und meine Arbeitsbewilligung beantragen. Die Lizenz erhält man in Kwale, weiß Sophia, die sich mit uns und ihrem Freund auf den Weg macht. Wieder heißt es Formulare ausfül en und warten. Zuerst wird Sophia aufgerufen und verschwindet mit ihrem Begleiter im Office. Nach fünf Minuten sind beide wieder draußen. Es hat nicht geklappt, weil sie nicht verheiratet sind. Bei uns sieht es nicht besser aus, was ich nicht glauben will. Doch der Officer meint, ohne Arbeitsbewil igung gibt es keine Lizenz, es sei denn, ich überschreibe bei einem Notar alles meinem Mann. Außerdem müsse auch der Name des Shops zuerst in Nairobi registriert werden.
Wie ich diese Stadt mittlerweile hasse! Und nun müssen wir schon wieder dorthin.
Als wir enttäuscht und ratlos zum Wagen marschieren, kommt uns der Officer nach und meint, ohne Lizenz gäbe es auch keine Arbeitsbewilligung. Aber vielleicht könne man Nairobi irgendwie umgehen, wenn er darüber nachdenke. Er sei um 16 Uhr in Ukunda, dann könne er uns bei Sophia besuchen. Natürlich ist uns allen sofort klar, worum es geht: Schmiergeld! Mir steigt die Gal e hoch, aber Sophia bekundet sofort ihre Bereitschaft, auf diesem Weg die Lizenz zu bekommen. Wir warten bei ihr zu Hause, und ich bin stinksauer, daß ich nicht allein mit Lketinga nach Kwale gefahren bin. In der Tat erscheint der Typ und schleicht sich unauffällig ins Haus. Er kommt umständlich zur Sache und sagt, morgen sei die Lizenz bereit, sofern jede von uns 5
000 Schillinge in einem Kuvert mitbringt. Sophia willigt sofort ein, und mir bleibt nichts anderes übrig, als ebenfal s zu nicken.
Nun erhalten wir ohne Probleme die Lizenz. Der erste Schritt ist getan. Mein Mann könnte bereits verkaufen, doch ich darf mich nur im Laden aufhalten und nicht einmal ein Verkaufsgespräch führen. Ich weiß, daß es so nicht geht, und überrede meinen Mann, mit mir nach Nairobi zu fahren, um die Arbeitsbewilligung sowie den Namen des Geschäftes zu beantragen. Wir taufen den Laden auf „Sidais-Massai-Shop“, was zu großen Diskussionen mit Lketinga führt. Sidai ist sein zweiter Name. Aber Massai wil er nicht anschreiben. Da aber die Lizenz nunmal ausgestellt ist, gibt es kein Zurück mehr.
Im zuständigen Amt in Nairobi werden wir nach mehreren Stunden Wartezeit aufgefordert mitzukommen. Ich weiß, daß es um sehr viel geht und mache dies meinem Mann eindringlich klar. Einmal ein Nein bleibt ein Nein. Wir werden ausgefragt, warum und wieso ich eine Arbeitserlaubnis brauche. Mühsam erkläre ich der Sachbearbeiterin, daß wir eine Familie sind, und da mein Mann keine Schule besucht hat, bleibe mir nichts anderes übrig, als zu arbeiten. Dieses Argument sieht sie ein. Aber ich habe zu wenig Devisen gebracht, und mir fehlen fast 20000
Franken, um zusammen mit der vorgezeigten Lizenz die Bewilligung zu bekommen.
Ich verspreche, dieses Geld aus der Schweiz einzuführen und mich wieder zu melden. Vol er Hoffnung verlasse ich das Office. Geld brauche ich nun sowieso, damit ich Ware einkaufen kann. Erschöpft begeben wir uns auf die weite Heimreise.
Als wir todmüde zu Hause eintreffen, sind einige Krieger daheim und präparieren Speere für den Verkauf. Edy ist auch dabei. Wir freuen uns sehr, uns nach so langer Zeit wiederzusehen. Während wir uns über früher unterhalten, krabbelt Napirai freudig auf ihn zu.
Da es schon spät ist und ich müde bin, erlaube ich mir, Edy für morgen zum Tee einzuladen. Schließlich war er es, der mir damals, als ich verzweifelt Lketinga suchte, geholfen hat.
Kaum sind die Krieger weg, fängt mein Mann an, mich mit Vorwürfen und Vermutungen über Edy zu quälen. Unter anderem wisse er nun, warum ich drei Monate allein in Mombasa war und ihn nicht vorher gesucht habe. Es ist unglaublich, was er mir unterstellt, und ich will einfach weg, damit ich diese häßlichen Anschuldigungen nicht ertragen muß. Ich packe meine schlafende Napirai auf den Rücken und laufe in die dunkle Nacht hinaus.
Ziel os streife ich durch die Gegend und stehe auf einmal vor dem Africa-Sea-Lodge-Hotel. Da überkommt mich das Bedürfnis, meine Mutter anzurufen, um ihr zum ersten Mal mitzuteilen, wie es um unsere Ehe steht. Schluchzend erzähle ich meiner überraschten Mutter einen Teil meines Elends. In so kurzer Zeit einen Rat zu geben ist schwierig, und so bitte ich sie, zu veranlassen, daß jemand von unserer Familie nach Kenia kommt. Ich brauche einen vernünftigen Rat und seelische Unterstützung, und vielleicht hilft es auch Lketinga, mir endlich mehr zu vertrauen.
Wir vereinbaren, morgen um dieselbe Zeit wieder zu telefonieren. Nach dem Gespräch geht es mir besser, und ich stolpere zu unserem Häuschen zurück.
Mein Mann ist natürlich noch streitsüchtiger geworden und wil wissen, woher ich komme. Als ich ihm von meinem Telefongespräch und dem anstehenden Besuch eines Familienmitglieds erzähle, wird er sofort ruhig.
Zu meiner Erleichterung erfahre ich am nächsten Abend, daß mein ältester Bruder bereit ist zu kommen. Er wird bereits in einer Woche mit meinem benötigten Geld hier sein.
Lketinga ist gespannt, noch jemanden von meiner Familie kennenzulernen. Da es mein ältester Bruder ist, hat er schon jetzt Respekt und behandelt mich freundlicher.
Als Geschenk näht er ihm ein Massai-Armband mit seinem Vornamen aus bunten Glasperlen. Irgendwie rührt es mich, wie wichtig dieser Besuch für ihn und James ist.
Mein Bruder Marc ist im Hotel „Two Fishes“
eingetroffen. Die Freude ist al gemein groß, obwohl er nur eine Woche bleiben kann. Er lädt uns oft zum Essen ins Hotel ein. Es ist herrlich, obwohl ich nicht an seine Rechnungen denken darf. Natürlich erlebt er meinen Mann von der besten Seite. In dieser Woche geht er nie weg, um Bier oder Miraa zu konsumieren, und weicht meinem Bruder nicht von der Seite. Als Marc uns zu Hause besucht, staunt er, wie seine früher so elegante Schwester haust. Doch vom Shop ist er begeistert und gibt mir noch ein paar gute Tips. Die Woche ist viel zu schnell vorbei, und am letzten Abend spricht er ausführlich mit meinem Mann. James übersetzt ihm jedes Wort. Als er ehrfürchtig und kleinlaut verspricht, mich nicht mehr mit seiner Eifersucht zu quälen, sind wir überzeugt, daß dieser Besuch ein vol er Erfolg war.








