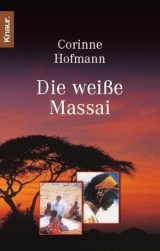
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
antwortet er lachend. Dann erzählt er, Anna habe er rausgeworfen, da sie uns bestohlen und zum Teil Lebensmittel verschenkt habe. Das kann ich nicht glauben und frage ängstlich, wer mir in Zukunft helfen soll. Er habe einen Burschen eingestellt, der von seinem älteren Bruder und von ihm kontrolliert werde. Nun muß ich fast lachen, denn wie zwei Analphabeten einen ehemaligen Schüler kontrollieren wollen, ist mir ein Rätsel. Außerdem sei der Shop fast leer. Deshalb sei er mit dem Landrover hier und wol e weiter nach Maralal, um mit den beiden Kriegern einen Laster zu organisieren. Entsetzt frage ich: „Mit welchem Geld?“ Er zeigt mir seine Tasche voller Geldscheine. Er habe al es bei Pater Giuliano geholt. Ich überlege fieberhaft, was zu tun ist. Wenn er mit diesen beiden Kriegern nach Maralal fährt, wird er ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Das Geld liegt ungebündelt in seiner Plastiktasche, und er weiß nicht mal, wieviel es ist.
Noch während ich nachdenke, kommt die Arztvisite, und die Krieger müssen hinaus. Der Arzt meint, die Malaria sei für diesmal besiegt. Ich bitte um meine Entlassung, die er mir für morgen verspricht. Nur arbeiten sol ich nicht viel, mahnt er.
Spätestens drei Wochen vor dem Geburtstermin sol e ich mich im Spital einfinden.
Ich bin erleichtert über meine Entlassung und teile es Lketinga mit. Auch er freut sich und verspricht, mich morgen abzuholen. Sie selber werden in Wamba ein Lodging nehmen.
Für die Fahrt nach Maralal übernehme ich das Steuer, und wie immer, wenn mein Mann dabei ist, gibt es keine Schwierigkeiten. Wir können bereits für den nächsten Tag einen Lastwagen buchen. Im Lodging zähle ich das Geld, das Lketinga dabei hat. Zu meinem Entsetzen stel e ich fest, daß einige tausend Kenia-Schil inge fehlen, um die Ladung zu bezahlen. Ich befrage Lketinga, und er meint ausweichend, es gebe noch einiges im Lager. So bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder Geld abzuholen, statt Gewinn auf die Bank zu bringen. Aber, ich freue mich, daß wir so schnel nach Barsaloi zurückkehren können. Schließlich war ich mehr als zehn Tage nicht mehr zu Hause.
Der Laster nimmt in Begleitung eines Kriegers den Umweg, wir fahren durch den Urwald. Ich bin glücklich, bei meinem Mann zu sein, und körperlich fühle ich mich wohl, da mir das regelmäßige Essen im Spital gut getan hat.
Am Todeshang
Unterwegs stellen wir fest, daß der Weg vor uns befahren worden ist. Es sind frische Fahrspuren, und Lketinga erkennt am Profil, daß es fremde Fahrzeuge gewesen sein müssen. Wir passieren den „Todeshang“ ohne Probleme, und ich versuche, meine Gedanken an das grauenvol e Erlebnis mit der Totgeburt zu verdrängen.
Wir biegen um die letzte Kurve vor den Felsen, und ich bremse augenblicklich ab.
Zwei alte Militär-Landrover stehen mitten im Weg. Zwischen den Fahrzeugen bewegen sich aufgeregt mehrere Weiße. Wir können unmöglich vorbeifahren und steigen aus, um nachzusehen, was los ist. Wie ich höre, ist es eine Gruppe von jungen Italienern in Begleitung eines Schwarzen.
Einer der jungen Männer sitzt laut schluchzend in der glühenden Hitze, während zwei junge Frauen auf ihn einreden. Auch ihnen laufen Tränen über das Gesicht.
Lketinga spricht mit dem Schwarzen, und ich krame ein paar italienische Brocken aus meinem Gedächtnis hervor.
Was ich zu hören bekomme, ruft trotz der etwa 40 Grad Gänsehaut hervor. Die Freundin des weinenden Mannes sei vor fast zwei Stunden neben den Felsen in den dichten Busch gegangen, um ihre Notdurft zu verrichten. Sie hatten angehalten, weil sie glaubten, die Straße sei hier zu Ende. Die Frau sei keine zwei Meter weit gekommen und vor ihren Augen in die Tiefe gestürzt. Sie alle hörten einen langen Schrei und danach den Aufpral. Seitdem ist kein Lebenszeichen zu hören, trotz Rufen und vergeblicher Mühe, in die steil überhängende Schlucht zu steigen.
Mich friert, denn ich weiß, hier ist jede Hoffnung Vergeblich. Wieder ruft der Mann laut den Namen seiner Freundin. Erschüttert gehe ich zu meinem Mann. Auch er ist durcheinander und erklärt mir, daß diese Frau tot ist, denn hier geht die Wand etwa hundert Meter in die Tiefe, und unten ist ein ausgetrocknetes, steiniges Flußbett.
Kein Mensch ist bis jetzt von hier oben hinuntergekommen. Die Italiener scheinen es probiert zu haben, denn verschiedene Seile liegen zusammengeknüpft am Boden.
Die beiden Mädchen halten den völlig aufgelösten Mann fest, der schweißnaß und zitternd mit hochrotem Kopf in der sengenden Hitze hockt. Ich gehe zu ihnen und schlage vor, sich unter die Bäume zu setzen. Aber der Mann schreit mit aufgerissenem Mund weiter.
Als ich zu Lketinga schaue, merke ich, daß er überlegt. Ich stürze zu ihm und frage, was er im Sinn habe. Er will mit seinem Freund irgendwie hinunter und die Frau heraufbringen.
Vol er Panik halte ich ihn fest und schreie: „No, Darling, that's crazy, don't go, it is very dangerous!“
Lketinga stößt meine Hand weg.
Der heulende Mann steht auf einmal neben mir und beschimpft mich, weil ich die Hilfe unterbinden wil. Wütend sage ich ihm, daß ich hier lebe und dies mein Mann sei. Er wird in drei Monaten Vater, und ich gedenke nicht, mein Kind ohne Vater großzuziehen.
Doch schon beginnen Lketinga und der andere Krieger etwa fünfzig Meter weiter oben mit dem gefährlichen Abstieg. Das letzte, was ich sehe, sind ihre völ ig versteinerten Gesichter. Samburus meiden Tote, es wird nicht einmal über Tote gesprochen. Ich setze mich in den Schatten und weine stil vor mich hin.
Eine halbe Stunde ist vergangen, und wir haben noch nichts gehört. Meine Angst steigt ins Unerträgliche. Ein Italiener schaut an der Stel e nach, wo sie den Abstieg begonnen haben. Aufgeregt kommt er zurück und erklärt, die beiden auf der anderen Seite der Schlucht gesichtet zu haben, sie hätten eine Art Bahre bei sich.
Hysterische Aufregung entsteht. Es vergehen weitere zwanzig Minuten, ehe die zwei völ ig erschöpft aus dem Busch treten. Sofort springen einige hinzu, um die Bahre, die aus einem Kanga von Lketinga und zwei langen Ästen gebastelt wurde, abzunehmen.
An den Gesichtern der Massai erkenne ich, daß die Frau tot ist. Auch ich werfe einen Blick auf die Gestalt und bin überrascht, wie jung sie ist und wie friedlich sie daliegt. Wäre nicht der süßliche Geruch, den der Körper bei diesen Temperaturen bereits nach drei Stunden verströmt, könnte man an eine Schlafende denken.
Mein Mann spricht kurz mit dem schwarzen Begleiter der Gruppe, dann werden ihre Landrover etwas zur Seite gefahren. Lketinga nimmt den Zündschlüssel, denn er wil selbst fahren. Jeder Protest meinerseits wäre in seinem starren Zustand zwecklos. Mit dem Versprechen, die Mission zu benachrichtigen, fahren wir über die Felsen weiter. Im Wagen herrscht absolutes Schweigen. Beim ersten River steigen die beiden aus und waschen sich fast eine Stunde. Es ist wie eine Art Ritual.
Endlich fahren wir weiter, und die Männer unterhalten sich zaghaft. Es ist kurz vor sechs Uhr, als wir in Barsaloi eintreffen. Vor dem Shop ist bereits mehr als die Hälfte der Waren abgeladen. Der mitgefahrene Krieger und Lketingas Bruder überwachen die Helfer. Ich öffne den Shop und stehe in einem schmutzigen Laden. Überal liegen Maismehl und leere Kartons herum. Während Lketinga einräumt, gehe ich zum Missionar. Er ist erstaunt über den Vorfall, obwohl er über Funk schon etwas Unklares abgehört hat. Er setzt sich sofort in seinen Land-Cruiser und braust davon.
Ich gehe nach Hause. Nach dieser Aufregung kann ich keine zusätzliche Hektik im Shop ertragen. Mama will natürlich wissen, warum der Laster vor uns hier war, aber ich kann nur notdürftig Auskunft geben. Ich koche Chai und lege mich hin. Meine Gedanken kreisen ständig um den Unfall. Ich nehme mir vor, diese Straße nicht mehr zu benützen. In meinem Zustand wird es langsam gefährlich. Gegen 22 Uhr kommt Lketinga mit den zwei Kriegern nach Hause. Sie kochen gemeinsam einen Topf Maisbrei, und ihr Gespräch dreht sich nur um das schreckliche Unglück.
Irgendwann schlafe ich ein.
Morgens holen uns die ersten Kunden zum Shop. Weil ich gespannt bin auf unseren neuen Mitarbeiter, der Anna ersetzt, gehe ich früh hinunter. Mein Mann macht mich mit dem Boy bekannt. Vom ersten Augenblick an ist er mir äußerst unangenehm, nicht nur, weil er unmöglich aussieht, sondern auch arbeitsscheu wirkt.
Doch ich bemühe mich, mir das Vorurteil nicht anmerken zu lassen, denn ich darf nun wirklich nicht mehr so viel arbeiten, wenn ich mein Kind nicht verlieren will. Er arbeitet halb so schnel wie Anna, und jeder zweite fragt nach ihr.
Nun möchte ich von Lketinga doch wissen, wieso wir nicht mehr Geld in Maralal hatten. Mit einem Blick habe ich gesehen, daß das Lager unmöglich die fehlende Differenz aufwiegt. Er holt ein Heftchen hervor und zeigt mir stolz das Kreditbüchlein von verschiedenen Personen. Die einen kenne ich, von anderen kann ich nicht einmal den Namen entziffern. Ich werde sauer, denn vor Beginn des Shops habe ich erklärt: „No credit!“
Der Boy mischt sich ein und beteuert, er kenne diese Leute, und es sei bestimmt kein Problem. Trotzdem bin ich nicht einverstanden. Gelangweilt, fast abschätzig hört er sich meine Argumente an, was mich noch wütender macht. Mein Mann meint zu guter Letzt, daß dies ein Samburu-Shop sei und er seinen Leuten helfen müsse.
Wieder stehe ich als böse, habgierige Weiße da, dabei kämpfe ich nur ums Überleben. Mein Geld in der Schweiz reicht keine zwei Jahre mehr und was dann?
Lketinga verläßt das Geschäft, weil er es nicht ertragen kann, wenn ich etwas energischer werde. Natürlich schauen alle Anwesenden auf uns, sobald ich als Frau ein paar laute Töne von mir gebe.
An diesem Tag gibt es endlose Debatten mit den Kunden, die mit Kredit gerechnet haben. Einige Hartnäckige warten einfach stur auf meinen Mann. Mit dem Boy macht mir das Arbeiten nicht so viel Spaß wie mit Anna. Ich wage kaum, auf die Toilette zu gehen, weil ich vermute, betrogen zu werden. Da mein Mann erst gegen Abend auftaucht, habe ich schon am ersten Tag mehr gearbeitet, als mir bekommt. Die Beine schmerzen. Gegessen habe ich bis zum Abend wieder nichts. Zu Hause fehlen Wasser und Brennholz. Ein wenig wehmütig denke ich an den Service im Hospital: Dreimal täglich essen, ohne selbst kochen zu müssen.
Da mir nun die Beine schneller ermüden, muß etwas geschehen. Ein Chai am Morgen und ein Essen am Abend reichen nicht aus, um mehr an Kraft aufzubauen.
Mama ist ebenfal s der Meinung, ich müsse viel mehr essen, sonst wird es kein gesundes Kind. Wir beschließen, sobald als möglich in den hinteren Teil des Shops umzuziehen. So müssen wir leider unsere schöne Manyatta nach vier Monaten wieder verlassen, doch Mama wird sie bekommen, und das beglückt sie sehr.
Wenn wir den nächsten Laster mieten, werden wir ein Bett, einen Tisch und Stühle mitbringen lassen, damit wir umziehen können. Beim Gedanken an ein Bett freue ich mich sehr, das Schlafen auf dem Boden bereitet mir allmählich Rückenschmerzen.
Mehr als ein Jahr hat es mich nicht gestört.
Seit ein paar Tagen sind Wolken am sonst immer blauen Himmel aufgezogen. Alle Menschen warten auf Regen. Das Land ist völ ig ausgetrocknet. Die Erde ist schon lange rissig und steinhart. Immer wieder hört man von Löwen, die die Herden am hellichten Tag überfallen. Die Kinder, die die Herden bewachen, geraten meistens in Panik, wenn sie ohne die Ziegen nach Hause eilen müssen, um Hilfe zu holen. Nun geht auch mein Mann wieder öfters mit unserer Herde den ganzen Tag auf Wanderschaft, und mir bleibt nichts anderes übrig, als ständig im Laden den Burschen selber zu kontrol ieren und mitzuarbeiten.
Der große Regen
Am fünften Wolkentag fallen die ersten Regentropfen. Es ist Sonntag, unser freier Tag. In aller Eile versuchen wir, Plastikbahnen über die Manyatta zu binden, was aber durch den jäh aufkommenden Wind sehr schwierig ist. Mama kämpft bei ihrer Hütte, wir bei unserer. Nun prasselt der Regen los. Einen solchen Schauer habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Innerhalb kurzer Zeit steht das ganze Land unter Wasser. Der Wind bläst die feuchte Luft in al e Ritzen. Das Feuer müssen wir auch löschen, da überal Funken herumfliegen. Ich ziehe alles an, was irgendwie wärmt.
Nach einer Stunde tropft trotz der Plastikhülle an einigen Stellen das Wasser in unsere Hütte. Wie naß wird es erst bei Mama und Saguna sein!
Stetig kriecht das Wasser vom Eingang in Richtung Schlafplatz. Mit einer Tasse grabe ich die Erde ab, damit das Wasser nicht weiter ansteigt. Der Wind zerrt an den Plastikbahnen, und ich rechne jeden Moment damit, daß sie weggerissen werden.
Draußen rauscht es, als wären wir auf einem reißenden Fluß. Das Wasser dringt nun auch seitlich in unsere Hütte. Ich schaffe alles in die Höhe, so gut es geht. Die Decken stopfe ich in die Reisetasche, damit wenigstens sie trocken bleiben.
Nach etwa zwei Stunden hört der Spuk plötzlich auf. Wir kriechen aus der Hütte, und ich erkenne das Land nicht wieder. Einige Hütten hat es fast abgedeckt, Ziegen rennen verstört umher. Mama steht patschnaß vor ihrer Hütte, die im Wasser schwimmt. Saguna sitzt zitternd und weinend in einer Ecke. Ich nehme sie zu uns und ziehe ihr einen trockenen Sweater von mir über. So kann sie sich wenigstens darin einwickeln. Überall kommen die Leute aus ihren Behausungen. Das Wasser hat richtige Bäche gegraben und braust zum Fluß hinunter. Plötzlich vernehmen wir einen Knall. Erschrocken schaue ich Lketinga an und frage, was das war. Eingehüllt in seine rote Decke lacht er und meint, nun sei am River die Flutwel e vom Berg heruntergekommen. Tosen wie von einem Wasserfall ist zu hören.
Lketinga möchte mit mir zum großen River hinunter, doch Mama ist nicht einverstanden. Es ist viel zu gefährlich, sagt sie sehr bestimmt. Also gehen wir auf die andere Seite, wo der Lori im Sand steckengeblieben war. Dieser Fluß ist nun etwa 25 Meter breit. Der andere mißt sicher das Dreifache. Lketinga hat seine Wolldecke bis über den Kopf gezogen, während ich zum ersten Mal hier oben meine Jeans mit Pullover und Jacke trage. Die wenigen Menschen, denen wir begegnen, staunen bei meinem Anblick. Natürlich haben sie noch nie eine Frau in Hosen gesehen. Ich habe Mühe, daß sie mir nicht herunterrutschen, da ich sie wegen meines Bäuchleins nicht schließen kann.
Das Rauschen wird immer lauter, so daß wir kaum unsere Worte verstehen können. Und dann sehe ich den reißenden Fluß vor mir. Kaum zu glauben, wie er sich verwandelt hat! Die braune Masse reißt alles mit. Büsche und Steine rol en davon. Die Gewalt der Natur verschlägt mir die Sprache. Plötzlich glaube ich, einen Schrei gehört zu haben. Ich frage Lketinga, ob er es ebenfalls gehört hat. Doch er verneint. Dann vernehme ich es ganz deutlich, hier schreit jemand. Nun bestätigt es auch mein Mann. Woher kommt das Geräusch? Wir rennen am oberen Uferrand entlang, bedacht, ja nicht auszurutschen.
Nach einigen Metern sehen wir das Entsetzliche. Mitten im Fluß, auf einer Felsgruppe, hängen zwei Kinder bis zum Hals im reißenden Wasser. Lketinga zögert keinen Augenblick und schreit ihnen etwas zu, während er die Böschung hinunterklettert. Es sieht schrecklich aus. Immer wieder werden die Köpfe vom ansteigenden Wasser überspült. Die Händchen klammern sich am Felsen fest. Ich weiß, mein Mann hat Angst vor tiefem Wasser und schwimmen kann er auch nicht.
Wenn er hinfäl t, ist er im reißenden Fluß hoffnungslos verloren. Und doch kann ich es gut verstehen und bin stolz darauf, daß er es wagt, diese Kinder zu retten. Er nimmt einen langen Stock und kämpft sich gegen die Fluten zum Felsen, während er ständig etwas zu den Kindern hinüberruft. Ich stehe da und bete um gute Schutzengel. Er hat den Felsen erreicht, packt das Mädchen auf seinen Rücken und kämpft sich zurück. Gebannt schaue ich auf den Knaben, der noch drüben hängt.
Sein Kopf ist bald nicht mehr zu sehen. Nun gehe ich meinem Mann entgegen und nehme ihm das Mädchen ab, damit er sofort zurückgehen kann. Das Kind ist schwer, und es kostet mich große Anstrengung, die zwei Meter ans Ufer zu kommen. Ich setze sie ab und ziehe ihr sofort meine Jacke über. Sie ist eiskalt. Mein Darling rettet auch den kleinen Jungen, der einiges an Wasser ausspuckt. Lketinga beginnt sofort, den Burschen zu massieren, und ich mache dasselbe mit dem Mädchen. Ihre steifen Glieder werden langsam weicher. Doch der Knabe ist apathisch und kann nicht gehen. Lketinga trägt ihn nach Hause, ich stütze das Mädchen. Bei dem Gedanken, wie knapp die beiden Kinder dem Tod entgangen sind, bin ich erschüttert.
Mama macht ein böses Gesicht, als sie die Geschichte hört und schimpft mit den Kindern. Wie sich herausstel t, waren sie mit der Herde unterwegs und wollten den Fluß passieren, als die Flutwel e kam. Viele Ziegen wurden vom Wasser mitgerissen, einige konnten sich ans Ufer retten. Mein Mann erklärt mir, daß die Wel e größer als er selbst sei und so schnell von den Bergen herunterkäme, daß jeder, der gerade am River ist, keine Chance hat. Jedes Jahr ertrinken mehrere Menschen und Tiere. Die Kinder bleiben bei uns, doch Tee gibt es nicht, das ganze Brennholz ist naß.
Nun schauen wir im Shop nach. Die Veranda ist mit dickem Schlamm überschwemmt, doch im Inneren ist es bis auf zwei kleine Pfützen trocken. Wir gehen zum Chai-Haus, aber auch hier gibt es keinen Tee. Das Tosen des großen Flusses hört man sehr stark, und so gehen wir doch noch hinunter. Er sieht beängstigend aus. Roberto und Giuliano sind ebenfalls da und schauen der Gewalt des Wassers zu. Ich erwähne kurz das Ereignis vom anderen Fluß, und Giuliano geht zum ersten Mal auf meinen Mann zu und dankt ihm mit einem Händedruck.
Auf dem Rückweg nehmen wir aus dem Laden das Öfchen und die Holzkohle mit nach Hause. So sind wir in der Lage, wenigstens heißen Tee für al e zu kochen. Die Nacht ist ungemütlich, weil alles feucht ist. Am Morgen jedoch scheint schon wieder die Sonne. Wir legen Kleider und Decken über die Dornenbüsche in die Wärme.
Einen Tag später verwandelt sich das Land erneut, diesmal sanft und leise. Überall sprießt Gras, und einzelne Blumen wachsen so schnell aus dem Boden, daß man fast zusehen kann. Tausende von kleinen weißen Faltern schweben wie Schneeflocken über das Land. Es ist herrlich, in dieser dürren Landschaft miterleben zu können, wie das Leben erwacht. Nach einer Woche ist ganz Barsaloi ein einziges violettes Blumenmeer.
Aber es gibt auch Nachteile. Abends schwirren schrecklich viele Moskitos herum, und natürlich schlafen wir unter dem Moskitonetz. Es wird so schlimm, daß ich abends sogar noch eine Moskitokeule in der Manyatta abbrenne.
Nun sind zehn Tage seit dem großen Regen vergangen, und wir sind weiterhin durch die beiden mit Wasser gefüllten Flüsse von der Außenwelt getrennt. Obwohl man sie zu Fuß bereits überqueren kann, darf man mit dem Wagen nichts riskieren.
Giuliano hat mich eindringlich gewarnt. Es seien bereits einige Fahrzeuge im Fluß steckengeblieben, und man konnte zusehen, wie der Treibsand sie langsam verschlang.
Tage später wagen wir eine Fahrt nach Maralal. Wir nehmen den Umweg, weil im Wald die Straße glitschig und naß ist. Diesmal bekommen wir nicht gleich einen Lastwagen, sondern müssen vier Tage in Maralal herumhängen. Wir besuchen Sophia. Ihr geht es gut. Sie ist schon so dick geworden, daß sie sich kaum bücken kann. Von Jutta hat sie nichts mehr gehört.
Mein Mann und ich verbringen viel Zeit in der Touristen-Lodge. Jetzt ist es besonders faszinierend, das Wasserloch für die wilden Tiere zu beobachten. Wir haben ja Zeit. Am letzten Tag kaufen wir uns ein Bett mit Matratze, einen Tisch mit vier Stühlen und einen kleinen Schrank. Die Möbel sind nicht so schön wie die in Mombasa, dafür teurer. Der Chauffeur zeigt keine große Freude, als er diese Sachen auch noch abholen muß, aber schließlich bezahle ich ja den Laster. Wir fahren ihm hinterher und erreichen diesmal Barsaloi nach fast sechs Stunden problemlos, nicht einmal ein Reifenwechsel war nötig. Zuerst werden die Möbel im hinteren Teil aufgestellt, dann geht die übliche Abladerei los.
Auszug aus der Manyatta
Am nächsten Tag ziehen wir in den Shop. Es ist drückend heiß, die Blumen sind wieder verschwunden, die Ziegen haben ganze Arbeit geleistet. Ich rücke die Möbel hin und her, aber eine gemütliche Atmosphäre wie in der Manyatta will sich nicht einstel en. Aber ich verspreche mir wesentlich weniger Umstände und geregelte Mahlzeiten, was nun dringend nötig ist. Als der Shop geschlossen ist, geht mein Mann schnell nach Hause, um seine Tiere zu begrüßen. Ich koche einen guten Eintopf mit frischen Kartoffeln, Rüben und Kohl.
Die erste Nacht schlafen wir beide schlecht, obwohl wir bequem im Bett liegen.
Das Blechdach knackt dauernd, so daß wir keinen Schlaf finden. Um sieben Uhr morgens klopft jemand an die Tür. Lketinga geht nachschauen und findet einen Jungen vor, der Zucker haben will. Gutmütig gibt er ihm das halbe Kilo und schließt wieder zu. Für mich ist es nun einfach, meine Morgentoilette zu erledigen, da ich mich in einem Becken gut waschen kann. Das WC-Häuschen ist nur 50 Meter entfernt. Das Leben erscheint mir angenehmer, dafür weniger romantisch.
Zwischendurch, wenn Lketinga ebenfalls im Shop ist, kann ich mich kurz hinlegen.
Während des Kochens bin ich immer wieder vorne im Laden. Eine Woche lang geht alles wunderbar. Ich habe ein Mädchen, das für mich das Wasser bei der Mission abholt. Es kostet etwas, doch dafür brauche ich nicht mehr an den Fluß zu gehen.
Außerdem ist es klar und sauber. Bald hat es sich herumgesprochen, daß wir im Shop leben. Nun kommen pausenlos Kunden und betteln um Trinkwasser. In den Manyattas ist es Sitte, diesen Wunsch zu erfüllen. Doch mittags habe ich von meinen 20 Litern schon fast nichts mehr. Ständig hocken Krieger auf unserem Bett und warten auf Lketinga und somit auf Tee und Essen. Solange der Laden mit Lebensmitteln vol ist, kann er ja nicht sagen, wir hätten nichts.
Nach solchen Besuchen finde ich die Wohnung chaotisch vor. Verschmierte Töpfe oder abgenagte Knochen liegen überall verstreut herum. An den Wänden klebt brauner Schleim. Meine Wolldecke und die Matratze sind vol roter Ockerfarbe von der Bemalung der Krieger. Ich habe mehrere Auseinandersetzungen mit meinem Mann, da ich mir ausgenutzt vorkomme. Manchmal versteht er mich und schickt sie zu Mama nach Hause, ein andermal stellt er sich gegen mich und verschwindet mit ihnen. Auch für ihn ist diese Situation neu und schwer zu handhaben. Wir müssen einen Weg finden, das Gastrecht zu erfül en, ohne ausgenützt zu werden.
Mit der Frau des Veterinärs habe ich mich angefreundet und werde ab und zu bei ihnen zum Tee eingeladen. Ich versuche, ihr mein Problem zu schildern, und zu meinem Erstaunen versteht sie mich sofort. Sie sagt, das sei die Art der Manyatta-Leute, doch in der „town“ habe man dieses Gastrecht sehr eingeschränkt. Es gelte nur noch für Familienmitglieder und sehr gute Freunde, aber keinesfalls mehr für jeden, der des Weges kommt. Am Abend teile ich Lketinga mein Wissen mit, und er verspricht, es in Zukunft ebenfalls so zu handhaben.
In der näheren Umgebung finden in den kommenden Wochen mehrere Hochzeiten statt. Meistens sind es ältere Männer, die die dritte oder vierte Frau heiraten wol en.
Es sind immer junge Mädchen, denen man ihr Elend später oft an den Gesichtern ablesen kann. Es kommt nicht selten vor, daß der Altersunterschied dreißig oder mehr Jahre beträgt. Am glücklichsten sind jene Mädchen, die als erste Frau eines Kriegers geheiratet werden.
Unser Zucker nimmt rapide ab, da als Brautpreis unter anderem häufig 100 kg Zucker benötigt werden und für das Fest selbst zusätzlich mehrere Kilo. So kommt der Tag, an dem wir den Shop zwar vol Maismehl haben, aber keinen Zucker mehr.
Zwei Krieger, die in vier Tagen heiraten wollen, stehen ratlos im Laden. Auch bei den Somalis ist der Zucker längst ausgegangen. Schweren Herzens mache ich mich auf den Weg nach Maralal.
Der Veterinär begleitet mich, was mir sehr angenehm ist. Wir fahren wieder den Umweg. Er wil seinen Lohn abholen und mit mir wieder zurückfahren. Den Zucker habe ich schnel gekauft. Für Lketinga bringe ich das versprochene Miraa mit.
Der Veterinär läßt auf sich warten. Es ist fast vier Uhr, als er endlich erscheint. Er schlägt vor, den Urwaldweg zu fahren. Mir ist nicht wohl bei diesem Gedanken, denn ich habe die Straße seit dem großen Regen nicht mehr benutzt. Doch er meint, jetzt sei es auch dort trocken. Also fahren wir los. Häufig müssen wir größere Schlammpfützen durchqueren, doch im Vierrad ist das kein Problem. Am Todeshang sieht der Weg nun ganz anders aus. Das Wasser hat große Gräben herausgewaschen. Wir steigen oben aus und laufen die Strecke zu Fuß ab, um zu sehen, wo wir am besten durchkommen. Außer bei einem Riß, der quer durch die Straße geht und sicher 30 Zentimeter breit ist, sehe ich überal die Möglichkeit, mit etwas Glück auch diesen Abschnitt zu schaffen.
Wir wagen es. Ich fahre auf den erhöhten Ebenen und hoffe sehr, nicht in den Graben zu rutschen, denn dann würden wir im Schlamm stecken. Wir schaffen es und sind erleichtert. Bei den Felsen ist es wenigstens nicht rutschig. Der Wagen holpert ächzend über die Brocken. Das Gröbste liegt hinter uns, jetzt kommen noch zwanzig Meter Schotter.
Plötzlich scheppert etwas unter dem Wagen. Ich fahre weiter, doch dann halte ich an, weil das Geräusch lauter wird. Wir steigen aus. Von außen sieht man nichts. Ich schaue unter den Wagen und entdecke das Übel. Auf der einen Seite sind die Federn bis auf zwei Stück gebrochen, wir haben praktisch keine Federung mehr. Die einzelnen Teile schleifen am Boden und verursachen das Geräusch.
Schon wieder hänge ich mit diesem Vehikel fest! Ich bin wütend auf mich, daß ich mich zu dieser Straße habe überreden lassen. Der Veterinär schlägt vor, einfach weiterzufahren. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich überlege, was zu tun ist. Aus dem Auto hole ich die Seile und suche passende Holzstücke. Dann binden wir alles zusammen fest nach oben. Zuletzt schieben wir die Holzstücke dazwischen, damit die Seile nicht durchgeschabt werden. Langsam fahre ich weiter bis zu den ersten Manyattas. Dort laden wir vier der fünf Säcke aus und lagern sie in der erstbesten Hütte. Der Veterinär schärft den Leuten ein, die Säcke nicht zu öffnen. Vorsichtig fahren wir weiter nach Barsaloi. Ich rege mich so sehr über dieses verfluchte Fahrzeug auf, daß ich Magenschmerzen bekomme.
Zum Glück erreichen wir unseren Shop ohne weiteren Zwischenfall. Lketinga kriecht sofort unter den Wagen, um sich zu vergewissern, ob es so ist, wie wir es ihm schildern. Er versteht nicht, warum ich den Zucker abgeladen habe und garantiert mir schon jetzt, daß er später nicht mehr vorhanden sein wird. Ich gehe in meinen Wohnraum und lege mich hin, da ich schrecklich müde bin.
Am nächsten Morgen suche ich Pater Giuliano auf, um ihm meinen Wagen zu zeigen. Etwas ärgerlich meint er, daß er keine Reparaturwerkstatt sei. Er müsse den Wagen halb auseinandernehmen, um die Teile zusammenzuschweißen. Dafür habe er jetzt wirklich keine Zeit. Bevor er noch etwas hinzufügen kann, gehe ich enttäuscht nach Hause. Von allen fühle ich mich allein gelassen. Ohne Giulianos Hilfe erreiche ich Maralal nie mehr mit diesem Wagen. Lketinga fragt mich, was Giuliano gesagt habe. Als ich ihm erzähle, daß er uns nicht helfen kann, meint er nur, er habe immer gewußt, daß dieser Mann nicht gut ist. So hart sehe ich es nicht, schließlich hat er uns schon häufig aus dem Schlamassel geholt.
Lketinga und der Bursche bedienen im Shop, und ich schlafe den ganzen Morgen.
Mir ist einfach nicht gut. Der Zucker ist schon mittags ausverkauft, und ich habe große Mühe, meinen Mann zurückzuhalten, damit er nicht mit dem defekten Wagen zurückfährt, um den Rest zu holen.
Gegen Abend sendet Giuliano seinen Watchman, der uns mitteilt, daß wir den Wagen vorbeibringen sollen. Erleichtert, daß er es sich anders überlegt hat, schicke ich Lketinga mit dem Wagen hoch, denn ich bin gerade dabei, etwas zu kochen. Um sieben Uhr schließen wir den Shop, und Lketinga ist noch nicht zurück. Dafür warten zwei mir fremde Krieger vor der Haustür. Ich habe bereits gegessen, als er endlich kommt. Er war zu Hause bei Mama, um nach den Tieren zu schauen. Freudig lachend bringt er mir meine ersten zwei Eier mit. Seit gestern legt mein Huhn Eier.
Nun kann ich meinen Speisezettel erweitern. Ich koche für den Besuch Chai und krieche erschöpft unter das Moskitonetz ins Bett.
Die drei essen, trinken und quatschen. Ich schlafe immer wieder ein. In der Nacht erwache ich schweißgebadet und durstig. Mein Mann liegt nicht neben mir. Ich weiß nicht, wo sich die Taschenlampe befindet. So krieche ich unter der Decke und dem Netz hervor, um mich zum Wasserkanister vorzutasten und stoße mit dem Fuß auf etwas am Boden Liegendes. Bevor ich überlegen kann, was es ist, vernehme ich ein Grunzgeräusch. Starr vor Schreck frage ich: „Darling?“ Im Lichtstrahl der Taschenlampe, die ich endlich gefunden habe, erkenne ich drei Gestalten, die am Boden liegen und schlafen. Einer davon ist Lketinga. Vorsichtig steige ich über die Gestalten zum Wasserkanister. Wieder im Bett klopft mein Herz immer noch wie verrückt. Mit diesen Fremden im Raum finde ich fast keinen Schlaf mehr. Am Morgen friere ich dermaßen, daß ich nicht unter der Decke hervorkomme. Lketinga kocht für alle Chai, und ich bin froh, etwas Heißes zu bekommen. Die drei lachen herzhaft über das nächtliche Erlebnis.
Der Bursche verkauft heute alleine, da Lketinga mit den beiden Kriegern zu einer Zeremonie gegangen ist. Ich bleibe im Bett. Mittags kommt Pater Roberto vorbei und bringt uns die restlichen vier Säcke Zucker. Ich gehe in den Laden, um mich zu bedanken. Dabei merke ich, daß mir schwindlig wird. Sofort lege ich mich wieder hin.
Mir paßt es nicht, daß der Bursche al ein ist, doch ich fühle mich zu elend, um ihn zu kontrollieren. Eine halbe Stunde nach Ankunft des Zuckers herrscht das übliche Durcheinander. Ich liege im Bett, an Schlafen ist bei diesem Lärm und Geschnatter nicht zu denken. Abends schließen wir den Shop, und ich bin allein.








