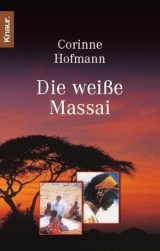
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Nachmittags geht es endlich los. Wir fahren über Baragoi, also brauchen wir sicher sechs Stunden und werden erst in der Nacht Barsaloi erreichen. Auf dem Laster fahren mindestens fünfzehn Personen mit. Der Driver verdient gutes Geld dabei.
Die Fahrt dauert unendlich lang. Zum ersten Mal lege ich die Strecke mit einem Lastwagen zurück. In tiefer Finsternis überqueren wir den ersten Fluß. Nur der Lichtstrahl der Scheinwerfer tastet sich durch die dunkle Weite. Gegen zehn Uhr haben wir es geschafft. Der Laster hält vor dem Lager der Mission. Viele Menschen erwarten den Lori, wie er hier heißt. Sie haben die Lichter schon längst erspäht, und damit ist Aufregung in das ruhige Barsaloi eingezogen. Einige wollen sich Geld mit dem Abladen der schweren Säcke verdienen.
Müde, aber freudig erregt klettere ich aus dem Laster. Ich bin zu Hause, obwohl die Manyattas noch einige hundert Meter entfernt sind. Ein paar Leute begrüßen mich freundlich. Giuliano erscheint mit einer Taschenlampe, um Anweisungen zu geben. Auch er begrüßt mich kurz und ist schon wieder verschwunden. Mit meinen schweren Taschen stehe ich hilflos herum, im Dunkeln kann ich sie nicht allein bis zu Mamas Manyatta schleppen. Zwei Boys, die offensichtlich nicht zur Schule gehen, da sie traditionell gekleidet sind, bieten mir ihre Hilfe an. Auf halber Strecke kommt uns jemand mit einer Taschenlampe entgegen. Es ist mein Darling. „Hello!“ strahlt er mich an. Freudig umarme ich ihn und drücke ihm einen Kuß auf den Mund. Die Aufregung verschlägt mir die Sprache. Schweigend gehen wir zur Manyatta.
Auch Mama zeigt große Freude. Sofort entfacht sie das Feuer für den obligaten Chai. Ich verteile meine Geschenke. Später klopft Lketinga liebevoll auf meinen Bauch und fragt: „How is our baby?“
Mir ist mulmig, als ich ihm sage, ich hätte leider kein Baby im Bauch. Sein Gesicht verfinstert sich: „Why? I know you have baby before!“
So ruhig wie möglich versuche ich zu erklären, daß ich nur wegen der Malaria meine Monatsblutung nicht bekommen habe. Lketinga ist über diese Nachricht sehr enttäuscht. Dennoch lieben wir uns in dieser Nacht wunderbar.
Die nächsten Wochen verbringen wir sehr glücklich. Das Leben geht seinen gewohnten Gang, bis wir uns nach Maralal begeben, um erneut nach dem Hochzeitstermin zu fragen. Lketingas Bruder kommt ebenfalls mit. Diesmal haben wir Glück. Als wir vorsprechen und meine bestätigten Papiere sowie den Brief vom Chief, den Lketinga in der Zwischenzeit bekommen hat, vorlegen, scheint es keine Probleme mehr zu geben.
Standesamt und Hochzeitsreise
Am 26. Juli 1988 werden wir getraut. Anwesend sind zwei neue Trauzeugen, Lketingas älterer Bruder und einige mir unbekannte Menschen. Die Zeremonie wird erst in Englisch und dann in Suaheli von einem netten Officer vollzogen. Alles verläuft reibungslos, außer daß mein Darling im entscheidenden Moment sein „Yes“
nicht ausspricht, bis ich kräftig gegen sein Bein stoße. Dann wird die Urkunde unterzeichnet. Lketinga nimmt meinen Paß und meint, jetzt müsse doch ein kenianischer her, da ich nun Leparmorijo heiße. Der Officer erklärt, dies müsse in Nairobi gemacht werden, da Lketinga ohnehin für mich den ständigen Wohnsitz beantragen muß. Nun verstehe ich gar nichts mehr. Ich war der Meinung, jetzt sei alles in Ordnung und der Papierkrieg höre endlich auf. Aber nein, trotz der Heirat bin ich immer noch Touristin, bis ich das Aufenthaltsrecht im Paß habe. Meine Freude schwindet, und auch Lketinga versteht das Ganze nicht. Im Lodging kommen wir zu dem Entschluß, nach Nairobi zu fahren.
Samt Trauzeugen und dem älteren Bruder, der noch nie eine große Reise unternommen hat, brechen wir am nächsten Tag auf. Bis Nyahururu fahren wir mit unserem Landrover, dann mit dem Bus nach Nairobi. Der Bruder kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Für mich ist es eine Freude, jemanden zu beobachten, der mit vierzig Jahren das erste Mal eine Stadt besucht. Er ist sprachlos und noch hilfloser als Lketinga. Nicht einmal eine Straße kann er ohne unsere Hilfe überqueren. Wenn ich ihn nicht bei der Hand nehmen würde, bliebe er sicherlich bis zum Abend am selben Fleck stehen, weil ihn der Verkehr und die vielen Autos ängstigen. Beim Anblick der riesigen Wohnblocks versteht er nicht, wie die Leute übereinander leben können. Endlich erreichen wir das Nyayo-Gebäude. Ich stelle mich in die wartende Kolonne, um wieder einige Formulare auszufüllen. Als ich das schließlich geschafft habe, meint die Dame hinter dem Schalter, wir sol en in etwa drei Wochen nachfragen. Protestierend versuche ich ihr klarzumachen, daß wir von sehr weit her kommen und auf keinen Fall ohne gültigen Eintrag im Paß zurückfahren. Fast flehe ich sie an, doch sie sagt höflich, al es habe seinen Weg zu gehen, sie werde versuchen, es in etwa einer Woche hinzukriegen. Da ich merke, daß dies das letzte Wort war, bedanke ich mich.
Draußen besprechen wir die Lage. Wir sind zu viert und müssen eine Woche warten. In Nairobi ist das mit meinen drei Buschmännern unvorstellbar. Deshalb schlage ich vor, nach Mombasa zu fahren, damit der Bruder auch einmal ans Meer kommt. Lketinga ist einverstanden, da er sich in Begleitung sicher fühlt. So treten wir die achtstündige Reise an, sozusagen unsere Hochzeitsreise.
In Mombasa besuchen wir als erstes Priscilla. Über unsere Hochzeit freut sie sich riesig und glaubt auch, daß jetzt al es gut wird. Lketingas Bruder will nun endlich ans Meer, doch als er vor der riesigen Wassermenge steht, muß er sich an uns festhalten. Näher als zehn Meter geht er nicht ans Wasser, und nach zehn Minuten müssen wir den Strand verlassen, zu groß ist seine Furcht. Ich zeige ihm auch ein Touristen-Hotel. Er kann nicht glauben, was er sieht. Einmal fragt er meinen Mann, ob wir wirklich noch in Kenia sind. Es ist ein schönes Gefühl, jemandem, der noch staunen kann, diese Welt zu zeigen. Später gehen wir essen und trinken, wobei er zum ersten Mal Bier trinkt, was ihm nicht gut bekommt. In Ukunda finden wir ein schäbiges Lodging.
Die Tage in Mombasa kosten mich eine Menge Geld. Die Männer trinken Bier, und ich sitze dabei, denn al ein mag ich nicht an den Strand. Langsam werde ich sauer, ständig den Bierkonsum für drei Personen zu bezahlen, und so bleiben die ersten kleinen Streitigkeiten nicht aus. Lketinga, der nun offiziel mein Mann ist, versteht mich nicht und meint, es sei meine Schuld, so lange warten zu müssen, bevor wir nach Nairobi zurück können. Er begreife sowieso nicht, warum ich noch einen Stempel brauche. Schließlich habe er mich geheiratet, und dadurch sei ich eine Leparmorijo und Kenianerin. Die anderen stimmen ihm zu. Ich sitze da und weiß auch nicht, wie ich ihnen den ganzen Bürokram erklären soll.
Nach vier Tagen brechen wir mißmutig auf. Mit Müh und Not bringe ich Lketinga nochmals, und wie er sagt, das letzte Mal, in dieses Office in Nairobi. Inständig hoffe ich, daß ich den Stempel schon heute bekomme. Erneut erkläre ich unser Anliegen und bitte nachzuschauen, ob es geklappt hat. Wieder heißt es warten. Die drei machen sich gegenseitig nervös und mich dazu. Die Leute starren uns ohnehin entgeistert an. Eine Weiße mit drei Massai gibt es nicht al e Tage im Office.
Endlich werden mein Mann und ich aufgerufen, wir sollen einer Dame folgen. Als wir vor einem Personenlift warten, ahne ich bereits, was passiert, wenn Lketinga da hineingehen sol. Die Lifttüre öffnet sich, und eine Menschenmasse quil t heraus.
Erschrocken starrt Lketinga in die leere Kabine und fragt: „Corinne, what's that?“
Ich versuche ihm zu erklären, daß wir mit dieser Kiste in den zwölften Stock fahren.
Die Dame wartet bereits ungeduldig am Lift. Lketinga will nicht. Er hat Angst, in die Höhe zu fahren. „Darling, please, this is no problem, if we are in the 12th floor you go around like now. Please, please come!“
Ich flehe ihn an zuzusteigen, bevor die Dame keine Arbeitslust mehr verspürt.
Tatsächlich steigt er endlich mit großen Augen ein.
Wir werden in ein Büro geführt, wo uns eine strenge Afrikanerin erwartet. Sie fragt mich, ob ich wirklich mit diesem Samburu verheiratet bin. Von Lketinga will sie wissen, ob er in der Lage sei, für mich mit Haus und Essen zu sorgen. Er schaut mich groß an: „Corinne, please, which house I must have?“
Mein Gott, denke ich, sag einfach nur ja! Die Frau schaut zwischen uns hin und her. Meine Nerven sind so angespannt, daß mir der Schweiß aus al en Poren läuft.
Den Blick streng auf mich gerichtet fragt sie: „You want to have children?“ „O yes, two“,
ist meine prompte Antwort. Es folgt Schweigen. Dann endlich geht sie zum Pult und sucht unter verschiedenen Stempeln einen aus. Ich zahle 200 Schilling und bekomme meinen abgestempelten Paß zurück. Vor Freude könnte ich heulen.
Endlich, endlich geschafft! Ich kann in meinem geliebten Kenia bleiben. Jetzt nichts wie raus und nach Barsaloi, nach Hause!
Unsere eigene Manyatta
Mama ist glücklich, daß alles gelungen ist. Nun sei es an der Zeit, die traditionelle Samburu-Heirat zu planen. Außerdem müssen wir eine eigene Manyatta haben, denn nach der Heirat dürfen wir nicht mehr in ihrem Haus wohnen. Da ich geheilt bin von den ewigen Officebesuchen, lasse ich den Gedanken an ein richtiges Haus fal en und bitte Lketinga, nach Frauen auszuschauen, die uns eine große, schöne Manyatta bauen. Ich werde Äste mit dem Landrover holen, doch bauen kann ich die Hütte nicht. Als Lohn wird es eine Ziege geben.
Nach kurzer Zeit erstel en vier Frauen, darunter seine beiden Schwestern, unsere Manyatta. Sie soll doppelt so groß wie die von Mama werden und auch höher, so daß ich fast darin stehen kann.
Die Frauen arbeiten nun schon zehn Tage, und ich kann es kaum erwarten, bis wir einziehen können. Die Hütte wird fünf auf dreieinhalb Meter. Der Umriß wird zuerst mit dicken Pfosten abgesteckt, die dann mit den Weidenästen verflochten werden.
Das Innere teilen wir in drei Plätze auf. Gleich neben dem Eingang ist die Feuerstelle. Darüber hängt ein Gestell für Tassen und Töpfe. Nach anderthalb Metern folgt eine geflochtene Trennwand, die eine Hälfte dahinter ist nur für meinen Darling und mich. Auf den Boden kommt ein Kuhfel, darauf eine Strohmatte und auf diese dann meine gestreifte Schweizer Wolldecke. Über unserem Schlafplatz wird das Moskitonetz hängen. Gegenüber der Schlafstelle ist eine zweite Schlafmöglichkeit für zwei bis drei Besucher geplant. Ganz hinten am Kopfende soll ein Gestell für meine Kleider stehen. Im Groben ist unsere Superhütte schon fertig, nur der Putz, das heißt Kuhmist, muß noch aufgebracht werden. Da aber in Barsaloi keine Kühe sind, fahren wir nach Sitedi zu Lketingas Halbbruder und beladen unseren Landrover mit Kuhfladen. Wir müssen dreimal fahren, bis wir genügend zusammen haben.
Zwei Drittel der Hütte werden von innen mit dem Dung verputzt, der in der großen Hitze schnell trocknet. Ein Drittel und das Dach werden von außen verputzt, damit der Rauch durch das poröse Dach entweichen kann. Es ist spannend, den Hausbau zu verfolgen. Die Frauen schmieren den Mist mit bloßen Händen um die Hütte und lachen über meine gerümpfte Nase. Wenn al es fertig ist, können wir in einer Woche einziehen, denn bis dahin ist der Mist steinhart und geruchlos.
Samburu-Hochzeit
Wir verbringen die letzten Tage in Mamas Hütte. Alles dreht sich jetzt um unsere bevorstehende Samburu-Hochzeit. Jeden Tag treffen ältere Männer oder Frauen bei Mama ein, um einen möglichen Termin zu finden. Wir leben ohne Datum oder bestimmte Tage, alles richtet sich nach dem Mond. Ich würde gern zu Weihnachten feiern, doch das kennen die Massai nicht, außerdem wissen sie nicht, wie der Mond dann steht. Aber vorläufig haben wir diesen Termin geplant. Da noch nie Weiß und Schwarz hier geheiratet haben, wissen wir nicht, wie viele Leute kommen werden. Es wird sich von Dorf zu Dorf weitersprechen, und erst am Hochzeitstag werden wir sehen, wer uns die Ehre erweist. Je mehr Menschen, vor allem Alte, kommen, desto mehr Ansehen genießen wir.
Eines Abends kommt der Wildhüter vorbei, ein ruhiger, stattlicher Mann, der mir sofort sympathisch ist. Leider spricht auch er nur spärlich Englisch. Er unterhält sich lange mit Lketinga. Nach geraumer Zeit bin ich neugierig und frage nach. Mein Mann erklärt mir, daß uns der Wildhüter seinen neu erstellten Shop, der außer als Lager für Pater Giulianos Mais ungenutzt ist, vermieten will. Aufgeregt frage ich, was er denn kosten würde.
Er schlägt vor, morgen gemeinsam den Shop zu besichtigen und anschließend zu verhandeln. In dieser Nacht schlafe ich unruhig, denn Lketinga und ich haben schon Pläne geschmiedet. Nach dem morgendlichen Waschen am Fluß schlendern wir durch das Dorf zum Shop. Mein Mann spricht mit jeder entgegenkommenden Person. Es geht um unsere Hochzeit. Sogar die Somalis kommen aus ihren Geschäften und fragen, wann es soweit ist. Aber wir wissen von den Alten immer noch nichts Genaues. Im Moment wil ich nur den Shop sehen und dränge Lketinga weiter.
Der Wildhüter erwartet uns schon im geöffneten, leeren Haus. Ich bin sprachlos.
Es ist ein gemauertes Gebäude in der Nähe der Mission, von dem ich immer dachte, es gehöre Pater Giuliano. Der Shop ist riesig, mit einem Tor, das sich nach vorne öffnet. Links und rechts davon sind Fenster. In der Mitte steht so etwas wie eine Verkaufstheke, und an der hinteren Wand sind richtige Holzgestelle. Hinter einer Zwischentür befindet sich ein gleich großer Raum, der als Lager oder Wohnung dienen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, hier mit etwas Geschick den schönsten Laden in ganz Barsaloi und Umgebung zu betreiben. Aber ich muß meine Begeisterung verbergen, wenn ich den Mietzins nicht in die Höhe treiben will. Wir einigen uns auf umgerechnet 50 Franken, sofern Lketinga die Shop-Lizenz bekommt.
Vorher will ich mich noch nicht festlegen, zu schlecht sind meine Ämtererfahrungen.
Der Wildhüter ist einverstanden, und wir kehren zur Mama zurück. Lketinga erzählt ihr alles, und sie geraten in eine Auseinandersetzung. Danach übersetzt er mir lachend: „Mama hat Angst, daß es Probleme mit den Somalis geben könnte, weil die Leute nicht mehr in ihre Läden gehen würden. Die Somalis sind gefährlich und könnten uns Böses anwünschen. Erst will sie unsere Hochzeit hinter sich haben.“
Dann schaut Mama mich lange, sehr lange an und meint, ich solle meinen Oberkörper besser bekleiden, damit nicht jeder sieht, daß ich ein Baby im Bauch trage. Als Lketinga versucht, mir dies zu übersetzen, bin ich sprachlos. Ich und schwanger? Doch nach längerem Überlegen wird mir klar, daß meine Periode schon fast drei Wochen ausgeblieben ist, was mir nicht bewußt war. Aber schwanger?
Nein, das würde ich doch merken!
Warum Mama das denke, frage ich Lketinga. Sie kommt zu mir und zeichnet mit dem Finger die Linien der Adern nach, die zu den Brüsten führen. Dennoch kann ich es nicht recht glauben und weiß im Moment nicht, ob es mir mit dem geplanten Shop auch passen würde. Abgesehen davon wünsche ich mir natürlich von meinem Mann Kinder, vor allem eine Tochter. Mama ist überzeugt, daß ihre Prognose stimmt und mahnt Lketinga, er müsse mich nun in Ruhe lassen. Überrascht frage ich: „Why?“
Mühsam erklärt er mir, wenn eine schwangere Frau mit einem Mann Verkehr habe, würden die Kinder später eine verstopfte Nase bekommen. Obwohl er es offensichtlich ernst meint, muß ich lachen. Solange ich selbst nicht sicher bin, möchte ich nicht ohne Sex leben.
Zwei Tage später, als wir vom Fluß kommen, sitzen mehrere Personen unter Mamas Baum und palavern. Wir bleiben in Mamas Hütte. Unsere ist in drei Tagen bezugsfertig, was bedeutet, daß ich selbst Feuer machen muß und für das Brennholz verantwortlich bin. Wasser kann ich mit dem Wagen vom Fluß holen, sofern niemand für etwas Kleingeld dies erledigen wil. Da ich jedoch mit fünf Litern schlecht auskomme, möchte ich einen Zwanzig-Liter-Kanister im Haus haben.
Mama kommt in die Manyatta und spricht mit Lketinga. Er wirkt aufgewühlt, und ich frage: „What's the problem?“ „Corinne, we have to make the ceremony in five days, because the moon is good.“
In fünf Tagen soll also bereits die Hochzeit sein? Da müssen wir sofort nach Maralal, um Reis, Tabak, Tee, Süßigkeiten, Getränke und andere Waren zu besorgen!
Lketinga ist unglücklich, weil er seine Haare nicht mehr neu flechten lassen kann.
Dies dauert Tage von früh bis spät. Selbst Mama ist hektisch, weil sie Unmengen Maisbier brauen muß, was auch knapp eine Woche dauert. Eigentlich will sie uns nicht mehr weglassen, doch im Dorf gibt es keinen Zucker und keinen Reis, nur Maismehl. Ich gebe ihr Geld, damit sie mit dem Bierbrauen beginnen kann, Lketinga und ich fahren los.
In Maralal kaufen wir fünf Kilo Kautabak, der für die Alten unbedingt vorhanden sein muß, hundert Kilo Zucker, ohne den der Tee unvorstellbar wäre, sowie zwanzig Liter H-Milch, weil ich nicht weiß, wie viele Frauen Milch mitbringen werden, was eigentlich üblich ist. Ich will kein Risiko eingehen, es soll ein schönes Fest werden, auch wenn viel eicht nur wenige Leute erscheinen. Dann brauchen wir noch Reis, doch den gibt es im Moment nicht. Ich fasse Mut, bei der Maralal-Mission darum zu bitten. Zum Glück verkauft uns der Missionar seinen letzten Zwanzig-Kilo-Sack.
Schließlich müssen wir zur Schule, um James zu informieren. Der Headmaster erklärt uns, die Schüler hätten ab dem 15. Dezember Ferien, und da wir unser Fest am 17. Dezember veranstalten, sei es für ihn kein Problem, dabei zu sein. Ich freue mich auf ihn. Zuletzt beschließe ich, ein altes Benzinfaß zu kaufen, damit wir es gereinigt als Wassertank benutzen können. Als wir außerdem Süßigkeiten für die Kinder im Wagen verstaut haben, ist es bereits nach fünf Uhr.
Dennoch entscheiden wir, sofort wieder zurückzufahren, so können wir das gefährliche Waldstück gerade noch vor dem Dunkelwerden passieren. Mama ist über unsere Rückkehr erleichtert. Die Nachbarn kommen gleich, um Zucker zu erbetteln, aber Lketinga ist diesmal hart. Er schläft im Auto, damit nichts wegkommt.
Es folgen einige Bilder:
• Lketinga
• Meine wichtigsten Aufenthaltsorte in Kenia (Landkarte mit den bekannten Orten)
• Lketinga mit Kopfschmuck und frisch gefärbten roten Haaren
• Am Fluß beim Wasserholen
• In diesem ersten Zuhause lebte ich gemeinsam mit Lketinga und seiner Mutter mehr als ein Jahr lang
• Vor seiner neuen Manyatta
• Meine Samburu-Hochzeit in Weiß
• Unsere Tochter Napirai mit ihren stolzen Eltern
• Bei der Herde
• Beim Schlachten einer Kuh im Busch, in der Bildmitte Lketingas Schwester
• Mama Masulani, Lketingas Mutter, mit Saguna und drei weiteren Enkelkindern
Am nächsten Tag zieht er los, um einige Ziegen zu kaufen, die wir schlachten müssen. Unsere will ich nicht töten, da ich inzwischen jede kenne. Ein Ochse muß auch her. Am Fluß versuche ich, das alte Benzinfaß vom Geruch zu befreien, was nicht so einfach ist. Den ganzen Morgen rolle ich das mit Omo und Sand gefül te Faß hin und her, bis es einigermaßen sauber ist. Drei Kinder helfen mir, mit Büchsen das Faß mit Wasser zu fül en. Mama steckt den ganzen Tag im Busch und braut Bier, weil das im Dorf verboten ist. Gegen Abend suche ich die Mission auf, verkünde die Nachricht von unserem Fest und frage um einige Kirchenbänke und Eßgeschirr nach. Pater Giuliano zeigt sich nicht überrascht, weil er es von seiner Angestellten schon vernommen hat, und sichert mir zu, daß ich am Tage unserer Hochzeit die gewünschten Sachen abholen darf. Da ich vor einiger Zeit, als ich meine Benzinfässer einstel en durfte, auch mein Brautkleid bei der Mission deponierte, damit es in der Manyatta nicht schwarz wird, bitte ich ihn, mich in der Mission umziehen zu dürfen. Er ist überrascht über meine Absicht, hier in Weiß zu heiraten, doch er ist einverstanden.
Nur noch zwei Tage, und Lketinga ist immer noch nicht zurück von seiner
„Ziegensafari“. Langsam werde ich nervös, mit niemandem kann ich richtig reden, und al e laufen geschäftig hin und her. Gegen Abend erscheinen wenigstens die Schüler, worüber ich mich sehr freue. James ist wegen der bevorstehenden Hochzeit sehr aufgeregt, und ich lasse mir von ihm eine Samburu-Hochzeit erklären.
Normalerweise startet das Fest morgens und zwar damit, daß die Braut in der Hütte beschnitten wird. Ich falle aus allen Wolken. „Why?“ will ich wissen. Weil sie sonst keine richtige Frau ist und keine gesunden Kinder bekommt, antwortet der sonst so aufgeklärte James mit großem Ernst. Bevor ich mich recht erholen kann, betritt Lketinga die Hütte. Er strahlt mich an, und ich freue mich, daß er wieder da ist.
Vier große Ziegen hat er mitgebracht, was nicht einfach war, weil sie immer wieder zu ihrer Ursprungsherde zurück wollten.
Nach dem üblichen Chai verlassen uns die Burschen, und ich kann Lketinga endlich fragen, was es mit der Beschneidung auf sich hat, und sage mit Bestimmtheit, daß ich alles mitmache, aber das auf keinen Fall. Er schaut mich ruhig an. „Why not, Corinne? All ladies here make this.“
Nun werde ich starr wie eine Salzsäule und will ihm gerade klarmachen, daß ich unter diesen Umständen bei al er Liebe auf eine Heirat verzichten werde, als er mich in seine Arme nimmt und mich beruhigt: „No problem, my wife, I have told to everybody, white people have this“,
dabei zeigt er zwischen meine Beine, „cut, when they are babies.“
Zweifelnd schaue ich ihn an, doch als er mir liebevoll auf den Bauch klopft und fragt: „How is my baby?“
falle ich ihm erleichtert um den Hals. Später erfahre ich, daß er dieses Märchen sogar seiner Mutter erzählt hat. Daß er mich vor diesem Brauch gerettet hat, rechne ich ihm hoch an.
Einen Tag vor unserer Hochzeit kommen die ersten Gäste von weit her und verteilen sich in den umliegenden Manyattas. Mein Darling holt bei seinem Halbbruder den Ochsen ab, was den ganzen Tag beanspruchen wird. Ich fahre mit den Boys in den Busch, um genügend Feuerholz zu schlagen. Bis wir den Wagen voll Brennholz haben, müssen wir viel herumfahren. Die Burschen sind sehr tüchtig.
Gegen Abend fahren wir zum Fluß und füllen das Faß sowie al e verfügbaren Kanister mit Wasser. Auf dem Heimweg bitte ich James, er möge im Chai-Restaurant Mandazi, die kleinen Brotfladen, für morgen bestellen. Während ich im Wagen warte, kommt der jüngste Ladenbesitzer, ein sympathischer Somali, zu mir und gratuliert zur morgigen Hochzeit.
In der Nacht vor unserer Hochzeit schlafen wir das letzte Mal in Mamas Behausung. Zwar ist unsere Manyatta schon fertig, aber ich wollte erst am Hochzeitstag umziehen, weil Lketinga die vergangenen Tage viel unterwegs war und ich nicht al ein in der neuen Hütte schlafen mochte.
Wir wachen früh auf, ich bin sehr nervös. Ich gehe zum Fluß hinunter, um mich und meine Haare zu waschen. Lketinga fährt mit den Burschen zur Mission und holt Bänke und Geschirr ab. Als ich zurückkomme, herrscht schon lebhaftes Treiben. Die Bänke stehen unter dem schattigen Baum. Lketingas älterer Bruder kocht Tee in einem riesigen Topf. Nun fährt Lketinga auch zum River, um sich zu schmücken. Wir verabreden uns eine Stunde später bei der Mission. In der Mission ziehe ich mein Hochzeitskleid mit dem passenden Schmuck an. Giulianos Angestellte hilft mir dabei.
Das enge Kleid paßt mir gerade noch, und nun glaube ich selber, daß ich viel eicht doch schwanger bin. Über den Brüsten und dem Bauch spannt es leicht. Als ich fertig geschminkt bin, steht Pater Giuliano sprachlos im Türrahmen. Seit langem ernte ich wieder einmal ein Kompliment. Lachend bemerkt er, dieses weiße, bodenlange Kleid sei nicht sehr geeignet für die Manyattas und vor allem nicht für die Dornenbüsche. Dann steht auch schon mein Darling wundervoll bemalt da, um mich abzuholen.
Etwas irritiert fragt er mich, warum ich ein solches Kleid trage. Leicht verlegen lache ich: „Um schön zu sein.“ Gott sei Dank trage ich normale weiße Plastiksandalen und keine europäischen Schuhe mit Absatz. Giuliano nimmt unsere Einladung an.
Als ich aus dem Wagen steige, staunen Kinder und Erwachsene, denn so ein Kleid haben sie noch nie gesehen. Ich fühle mich unsicher und weiß nicht, was ich nun tun soll. Überall wird gekocht, Ziegen werden ausgenommen und zerlegt. Es ist erst kurz nach zehn Uhr, doch es sind schon mehr als fünfzig Leute da. Die alten Männer sitzen auf den Bänken und trinken Tee, während die Frauen unter einem anderen Baum abseits sitzen. Kinder springen um mich herum. Ich verteile Kaugummis, während die Alten bei James anstehen, der Tabak ausgibt. Aus al en Richtungen strömen Menschen herbei. Frauen geben ihre Milchkalebassen bei Mama ab, andere binden Ziegen an den Bäumen fest. Auf einem riesigen Feuer wird in einem großen Topf Reis mit Fleisch gegart. Das Wasser schwindet bedenklich schnell, da laufend Tee gekocht wird. Gegen Mittag ist das erste Essen fertig, und ich beginne, es zu verteilen, während der inzwischen eingetroffene Pater Giuliano das Geschehen filmt.
Allmählich verliere ich die Übersicht. Mittlerweile sind fast 250 Personen, die Kinder nicht eingerechnet, anwesend. Immer wieder höre ich, daß dies die größte Zeremonie ist, die es bisher in Barsaloi gab. Vor al em für meinen Darling bin ich sehr stolz, der das Risiko einging, eine Weiße zu heiraten, obwohl bei weitem nicht jeder das befürwortet hat. James kommt mit der Nachricht, der Reis sei al e, und viele Frauen und vor al em die Kinder hatten noch nichts. Ich berichte Giuliano von diesem „Unglück“. Er fährt sofort los und kommt mit einem Zwanzig-Kilo-Sack zurück, den er uns zur Hochzeit schenkt. Während die Krieger abseits von allen anderen zu tanzen beginnen, wird für die übrigen weitergekocht. Lketinga ist die meiste Zeit bei seinen Kriegern, die erst in der Nacht zu ihrem Essen kommen werden. Mit der Zeit fühle ich mich schon etwas verlassen. Schließlich ist es meine Hochzeit, aber niemand von meinen eigenen Verwandten ist hier, und mein Mann verbringt mehr Zeit mit seinen Kriegern als mit mir.
Die Gäste tanzen. Jede Gruppe tanzt für sich, die Frauen unter ihrem Baum, die Boys separat und die Krieger weit entfernt. Einige Turkana-Frauen tanzen für mich.
Ich sol bei den Frauen mitmachen, doch nach den ersten Tänzen nimmt mich Mama zur Seite und gibt zu bedenken, ich dürfe nicht so springen wegen des Babys.
Abseits des Festplatzes wurde inzwischen der Ochse zerlegt und stückweise verteilt.
Zufrieden stelle ich fest, daß wir für alle genug zu essen und zu trinken haben.
Bevor es dunkel wird, werden uns die Geschenke überreicht oder versprochen.
Jeder, der etwas schenken will, sei es meinem Mann oder mir, steht auf und verkündet dies. Die Person muß speziell betonen, für wen das Geschenk ist, denn bei den Samburus besitzen Frauen und Männer die Güter, das heißt die Tiere, getrennt. Ich bin überwältigt, wieviel mir die Leute schenken. Vierzehn Ziegen, zwei Schafe, einen Hahn, ein Huhn, zwei junge Kälber und ein kleines Kamel, al es nur für mich. Mein Mann bekommt in etwa das gleiche. Nicht al e haben ihre Geschenke mitgebracht, so daß Lketinga sie später abholen muß.
Das Fest geht zu Ende, und ich ziehe mich zum ersten Mal in meine neue Manyatta zurück. Mama hat alles für mich gerichtet, endlich kann ich mich aus meinem engen Kleid schälen. Ich sitze vor dem Feuer und warte auf meinen Ehemann, der noch im Busch weilt. Es ist eine wunderschöne Nacht, und ich bin das erste Mal allein in unserer großen Manyatta. Für mich beginnt ein neues Leben als selbständige Hausfrau.
Der Shop
Eine Woche nach der Hochzeit fahren wir nach Maralal, um uns nach einer Shop-Lizenz für Lketinga zu erkundigen. Diesmal könnte es schnel klappen, meint ein freundlicher Beamter. Wir fül en Formulare aus und sollen in drei Tagen wieder vorbeikommen. Da wir für den Laden dringend eine Waage benötigen, machen wir uns auf den Weg nach Nyahururu. Außerdem möchte ich Maschendraht kaufen, um im Verkaufsregal die Ware besser ausstellen zu können, denn ich will den Leuten Kartoffeln, Karotten, Orangen, Kabis, Bananen und anderes anbieten.
In Nyahururu finden wir keine Waage. Die seien sehr teuer und daher nur in Nairobi erhältlich, erklärt uns der einzige Eisenwarenhändler. Lketinga ist nicht erfreut, aber wir brauchen die Waage unbedingt, und so fahren wir mit dem Bus in das verhaßte Nairobi. Dort werden sie überall angeboten, wobei die Preise extrem schwanken. Schließlich erstehen wir beim billigsten Anbieter für 350 Franken eine schwere Waage mit den dazugehörenden Gewichten und fahren nach Maralal zurück. Hier klappern wir alle Großhändler und Märkte ab, um die jeweils günstigsten Preise für die einzelnen Waren zu erfragen. Mein Mann findet al es zu teuer, doch ich bin überzeugt, mit geschicktem Verhandeln die gleichen Preise wie die Somalis zu bekommen. Der größte Händler bietet mir an, einen Lastwagen zu organisieren, der die Ware nach Barsaloi bringt.
Guten Mutes gehen wir am dritten Tag ins Office. Der freundliche Officer erklärt uns, es sei nur ein kleines Problem aufgetaucht. Wir müßten ein Schreiben vom Veterinär in Barsaloi bringen, daß der Shop sauber sei, und sofern wir auch das Portrait vom Staatspräsidenten vorlegen, das in jedem Geschäft hängen muß, wird er uns die Lizenz geben. Lketinga will schimpfen, doch ich halte ihn zurück. Ohnehin wil ich erst nach Hause, um den Shopvertrag schriftlich zu machen und den Laden so herzurichten, daß die Ware sinnvoll aufgebaut werden kann.
Außerdem muß eine Verkaufshilfe gefunden werden, weil ich die Sprache zu wenig beherrsche und mein Mann nicht rechnen kann.
Abends besuchen wir Sophia und ihren Freund. Sie ist aus Italien zurück, und wir haben uns viel zu erzählen. Nebenbei vertraut sie mir an, daß sie im dritten Monat schwanger ist. Über diese Nachricht freue ich mich sehr, weil ich mittlerweile glaube, in der gleichen Situation zu sein. Nur habe ich nicht die hundertprozentige Gewißheit wie sie. Im Gegensatz zu mir muß sich Sophia jeden Morgen übergeben. Über mein geschäftliches Vorhaben staunt sie sehr. Aber mit dem Wagen muß ich endlich Geld verdienen, weil ich nicht immer nur Tausende von Franken ausgeben kann.
In Barsaloi wird der Vertrag gemacht, wir sind glückliche Ladenbesitzer. Tagelang putze ich die verstaubten Gestelle und nagle den Maschendraht an den Tresen. Im hinteren Teil räume ich alte Bretter heraus. Plötzlich höre ich ein Zischen und sehe gerade noch einen grünen Schlangenkörper unter dem restlichen Holz verschwinden. Vol er Panik renne ich hinaus und schreie: „Snake, snake!“








