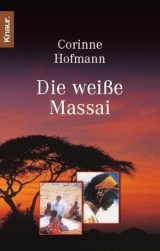
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Eigentlich hätte ich Lust zu Mama zu gehen, doch mir ist schon wieder kalt. Für mich allein will ich nicht kochen und lege mich unter das Moskitonetz. Die Viecher sind noch sehr zahlreich und aggressiv. In dieser Nacht bekomme ich Schüttelfrostanfälle. Meine Zähne klappern so laut, daß ich vermute, man hört es bis zur nächsten Hütte. Warum kommt Lketinga nicht nach Hause? Die Nacht will nicht vorbeigehen. Einmal friere ich furchtbar, um kurz darauf wieder zu schwitzen. Ich müßte auf die Toilette, doch wage ich nicht, allein nach draußen zu gehen. In meiner Not benutze ich eine leere Büchse, um Wasser zu lassen.
Am frühen Morgen klopft es an die Tür. Ich frage erst, wer da ist, denn verkaufen mag ich nichts. Dann vernehme ich endlich die vertraute Stimme meines Darlings. Er sieht sofort, daß etwas nicht stimmt, doch ich beruhige ihn, weil ich nicht schon wieder die Mission belästigen will.
Aufgekratzt erzählt er mir von der Hochzeitszeremonie des einen Kriegers und berichtet, daß in etwa zwei Tagen hier eine Safari-Rallye vorbeikommen wird. Er habe schon einige Wagen gesehen. Wahrscheinlich kommen heute ein paar Fahrer hier vorbei, um die Strecke nach Wamba zu erkunden. Irgendwie glaube ich nicht daran, lasse mich aber trotz meines Elends gerne von der Aufregung anstecken.
Später geht er, um nach unserem Wagen zu schauen, aber der ist noch nicht fertig.
Gegen zwei Uhr höre ich einen Höl enlärm. Bis ich beim Shop-Eingang stehe, sehe ich gerade noch, wie eine Staubwolke langsam verfliegt. Der erste Probefahrer ist vorbeigeflitzt. Nach kurzer Zeit steht halb Barsaloi an der Straße. Etwa eine halbe Stunde später brausen ein zweiter und kurz darauf ein dritter Wagen vorbei. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, hier am Ende der Welt, in einer völlig anderen Zeit, von der Zivilisation in dieser Weise eingeholt zu werden. Wir warten noch lange, doch der Spuk ist für heute vorüber. Dies waren die Testfahrzeuge. In zwei Tagen sol en hier dreißig oder mehr Wagen vorbeisausen. Ich freue mich auf diese Abwechslung, obwohl ich hoch fiebrig im Bett liege. Lketinga kocht für mich, aber schon beim Anblick des Essens wird mir übel.
Am Tag vor der Ral ye geht es mir extrem schlecht. Immer wieder verliere ich für kurze Zeit das Bewußtsein. Seit mehreren Stunden habe ich das Kind in meinem Bauch nicht mehr gespürt. Panik erfaßt mich, und ich weine, als ich es meinem Mann mitteile. Erschrocken verläßt er das Haus und kommt mit Mama zurück. Sie spricht fortwährend mit mir, während sie meinen Bauch abtastet. Ihr Gesicht ist finster.
Weinend frage ich Lketinga, was mit dem Kind los sei. Doch er sitzt hilflos da und redet nur mit der Mama. Schließlich erklärt er mir, seine Mutter glaube, ich sei von einem bösen Fluch befallen, der mich krank macht. Irgend jemand wolle mich und unser Baby töten.
Sie möchten wissen, mit welchen alten Leuten ich in letzter Zeit im Shop gesprochen habe, ob die alten Somalis hier waren, ob mich ein Alter angefaßt oder angespuckt habe oder ob mir jemand eine schwarze Zunge gezeigt habe. Die Fragen prasseln nur so nieder, und ich werde vor Angst fast hysterisch. In meinem Kopf hämmert es ununterbrochen: Mein Baby ist tot!
Mama verläßt uns und verspricht, mit guter Medizin zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie lange ich dagelegen und geschluchzt habe. Als ich die Augen öffne, sehe ich sechs bis acht alte Männer und Frauen, die sich um mich versammelt haben.
Unablässig höre ich: „Enkai, Enkai!“
Jeder der Alten reibt an meinem Bauch und murmelt etwas. Mir ist alles egal.
Mama hält mir einen Becher an die Lippen mit einer Flüssigkeit, die ich in einem Zug leeren muß. Das Zeug ist brennend scharf, daß es mich schüttelt. Im selben Moment spüre ich zwei-, dreimal ein Zucken und Stampfen im Bauch und fasse erschrocken nach ihm. Mir dreht sich al es. Ich sehe nur noch alte Gesichter über mir und möchte am liebsten sterben. Mein Kind hat noch gelebt, nun aber ist es sicher tot, ist mein letzter Gedanke, bevor ich schreie: „Ihr habt mein Kind getötet, Darling, they have now kil ed our baby!“
Ich spüre, wie mir die letzte Kraft und mein Lebenswille schwinden.
Wieder legen sich zehn oder mehr Hände auf meinen Bauch und reiben und drücken. Dabei wird laut gebetet oder gesungen. Plötzlich hebt sich der Bauch ein wenig, und ich spüre von innen ein leichtes Zucken. Zuerst wage ich kaum, es zu glauben, doch es wiederholt sich noch ein paarmal. Die Alten scheinen es ebenfal s gespürt zu haben, und die Gebete werden leiser. Als mir klar wird, daß mein kleines Baby lebt, durchströmt mich ein starker Lebenswille, den ich schon verloren glaubte.
„Darling, please, go to Pater Giuliano and tell him about me. I want to go to the hospital!“
Flying doctor
Kurze Zeit später erscheint Giuliano. In seinem Gesicht sehe ich blankes Entsetzen. Er spricht kurz mit den Alten und fragt mich, in welchem Monat ich nun sei. „Anfang achter Monat“, erwidere ich matt. Er wil versuchen, einen flying doctor über Funk zu erreichen. Dann verläßt er uns, und auch die Alten außer Mama gehen wieder. Schweißnaß liege ich im Bett und bete für das Kind und mich. Um alles in der Welt will ich dieses Kind nicht verlieren. Mein Glück hängt vom Leben dieses kleinen Wesens ab.
Plötzlich vernehme ich Motorengeräusch, nicht von einem Wagen, sondern von einem Flugzeug. Mitten in der Nacht taucht hier im Busch ein Flugzeug auf! Draußen höre ich Stimmen. Auch Lketinga geht hinaus und kommt aufgeregt zurück. Ein Flugzeug! Giuliano erscheint und sagt, ich solle nur wenige Sachen mitnehmen und einsteigen, denn die Piste sei nicht lange erleuchtet. Sie helfen mir aus dem Bett.
Lketinga packt das Nötigste ein, um mich dann zum Flugzeug zu schleppen.
Ich bin sprachlos, wie hell al es ist. Giuliano hat mit seinem Aggregat einen riesigen Scheinwerfer in Betrieb gesetzt. Fackeln und Petroleumlampen säumen links und rechts den flachen Teil der Straße. Große weiße Steine zeichnen die Spur weiter. Der Pilot, ein Weißer, hilft mir ins Flugzeug. Er winkt meinem Mann zu, einzusteigen. Hilflos steht Lketinga da. Er möchte mit und kann doch seine Angst nicht überwinden.
Mein armer Darling! Ich rufe ihm zu, er sol e hier bleiben und auf den Shop aufpassen, als die Tür geschlossen wird. Wir starten durch. Zum ersten Mal in so einem kleinen Flieger fühle ich mich dennoch sicher. Nach etwa zwanzig Minuten sind wir über dem Wamba-Hospital. Auch hier ist alles beleuchtet, allerdings gibt es eine richtige Flugpiste. Nach der Landung erblicke ich zwei Schwestern, die mich mit einem Rollstuhl erwarten. Mühsam klettere ich aus dem Flugzeug und stütze dabei mit einer Hand meinen Bauch, der weit nach unten gerutscht ist. Als ich im Rollstuhl zum Spital geschoben werde, überfäl t mich erneut das heulende Elend, und die tröstenden Worte der Schwestern nützen nichts, im Gegenteil, ich schluchze noch mehr. Beim Spital erwartet mich die Schweizer Ärztin. Auch aus ihrem Gesicht lese ich Besorgnis, doch sie tröstet mich, jetzt werde alles gut.
Im Untersuchungszimmer liege ich im Gynäkologenstuhl und warte auf den Chefarzt. Mir wird bewußt, wie schmutzig ich bin, und ich schäme mich zutiefst. Als ich mich deswegen beim Arzt entschuldigen will, winkt er ab und meint, im Moment gebe es Wichtigeres zu überlegen. Er untersucht mich vorsichtig ohne Instrumente, nur mit den Händen, während ich gebannt an seinen Lippen hänge, um zu hören, wie es meinem Kind geht.
Endlich erlöst er mich, indem er bestätigt, daß das Kind lebt. Doch für den achten Monat ist es viel zu klein und schwach, und wir müssen alles versuchen, um eine Frühgeburt zu verhindern, da es bereits sehr tief liegt. Dann kommt die Schweizer Ärztin zurück und gibt den niederschmetternden Befund bekannt: Ich habe eine schwere Anämie und benötige sofort Blutkonserven wegen einer schweren Malaria.
Der Arzt erklärt mir, wie schwierig es sei, Blut zu bekommen. Hier besitzen sie nur einige wenige Konserven, und diese müssen von mir über einen Spender ersetzt werden.
Mir wird elend bei dem Gedanken an fremdes Blut hier in Afrika in den Zeiten von Aids. Ängstlich frage ich ihn, ob das Blut denn auch kontrol iert sei. Er antwortet ehrlich, nur zum Teil, da im Normalfall die Patienten mit Anämie erst einen Spender aus der Familie bringen müssen, bevor sie eine Bluttransfusion erhalten. Hier sterben die meisten Menschen an Malaria oder deren Folge, Anämie. Nur wenige Blutkonserven kommen aus dem Ausland als Spende in die Mission.
Ich liege auf dem Stuhl und versuche, meine Gedanken unter Kontrolle zu bringen.
Blut bedeutet Aids, hämmert es in meinem Kopf. Diese tödliche Krankheit will ich nicht, wage ich zu protestieren. Der Arzt wird sehr ernst und deutlich, als er mir sagt, daß ich mich zwischen diesem Blut und dem sicheren Tod entscheiden kann. Eine afrikanische Schwester erscheint, setzt mich wieder in den Rol stuhl, und ich werde in ein Zimmer zu drei anderen Frauen gebracht. Sie hilft mir aus den Kleidern, und ich bekomme eine Spital-Uniform wie al e anderen.
Als erstes wird mir wieder eine Spritze verabreicht, dann hängt sie die Infusion an meinen linken Arm. Die Schweizer Ärztin kommt mit einem Beutel Blut herein. Mit einem beruhigenden Lächeln teilt sie mir mit, daß sie die letzte Schweizer Konserve mit meiner Blutgruppe aufgetrieben habe. Bis morgen reicht es, und die meisten weißen Missionsschwestern seien bereit, falls ihre Blutgruppe für mich in Frage kommt, zu spenden.
Bei soviel Fürsorge bin ich gerührt, doch ich versuche meine Tränen zu unterdrücken und bedanke mich. Als sie mir die Bluttransfusion am rechten Arm anhängt, sticht es gewaltig, weil die Nadel sehr dick ist und sie mehrmals anstechen muß, bevor das lebensrettende Blut in meine Ader fließt. Beide Arme werden mir am Bett festgebunden, damit ich im Schlaf die Nadeln nicht herausreiße. Mein Anblick muß traurig sein, und ich bin froh, daß meine Mutter nicht weiß, wie elend mir ist.
Auch wenn alles gut gehen sol te, werde ich es ihr nie schreiben. Mit diesen Gedanken schlafe ich ein.
Um sechs Uhr werden die Patienten geweckt, um Fieber zu messen. Ich bin noch ganz erschlagen, weil ich höchstens vier Stunden geschlafen habe. Um acht Uhr bekomme ich wieder eine Spritze und gegen Mittag neue Transfusionen.
Ich habe Glück und erhalte die nächsten Konserven von den hiesigen Schwestern.
Wenigstens brauche ich mir keine Gedanken mehr wegen Aids zu machen.
Die normale Schwangerschaftsuntersuchung findet am Nachmittag statt. Der Bauch wird abgetastet, die Herztöne des Babys abgehört, und der Blutdruck gemessen. Mehr kann man hier nicht machen. Essen kann ich noch nichts, da mir auch hier der Geruch von Kohl Übelkeit verursacht. Dennoch geht es mir am Ende des zweiten Tages viel besser. Durch die Zufuhr einer dritten Blutkonserve fühle ich mich wie eine Blume, die nach langer Zeit endlich Wasser bekommt, das Leben kehrt von Tag zu Tag mehr in meinen Körper zurück. Nachdem die letzte Bluttransfusion beendet ist, schaue ich seit langem wieder einmal in den Handspiegel. Ich erkenne mich fast nicht mehr. Die Augen wirken groß und eingefallen, die Backenknochen stehen hervor, und die Nase ist lang und spitz. Meine Haare kleben verschwitzt, matt und dünn am Kopf. Dabei fühle ich mich doch schon viel besser, denke ich erschrocken. Aber bis jetzt bin ich ja nur gelegen und habe in den drei Tagen noch kein einziges Mal das Bett verlassen, denn ich hänge nach wie vor an einer Infusion gegen die Malaria.
Die Schwestern sind sehr nett und kommen vorbei, sooft sie können. Aber sie machen sich Sorgen, weil ich immer noch nichts esse. Eine ist besonders nett, sie strahlt Güte und Wärme aus, die mich rührt. Eines Tages erscheint sie mit einem Käse-Sandwich aus der Mission. Ich habe schon so lange keinen Käse mehr gesehen, daß es mich keine Überwindung kostet, das Brot langsam zu essen. Von diesem Tage an kann ich wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Jetzt geht es aufwärts, freue ich mich. Mein Mann wird über Radio-Funk informiert, daß das Baby und ich über den Berg sind.
Ich bin nun schon eine Woche hier, als mir die Schweizer Ärztin bei einer Untersuchung rät, die Geburt in der Schweiz zu erwarten. Erschrocken schaue ich sie an und frage, wieso. Ich sei zu schwach und viel zu dünn für den achten Monat.
Wenn ich mich hier nicht richtig ernähren kann, sei die Gefahr, durch den erneuten Blutverlust und die Anstrengung bei der Geburt zu sterben, sehr groß. Sie haben keine Sauerstoff-Geräte, und für die schwachen Babys gibt es keinen Brutkasten.
Auch verabreicht man hier keine schmerzstillenden Mittel bei der Geburt, weil sie einfach keine haben.
Furcht ergreift mich bei dem Gedanken, in meinem Zustand in die Schweiz zu fliegen. Ich weiß, das würde ich nicht schaffen, teile ich der Ärztin mit. Wir suchen nach anderen Möglichkeiten, denn ich muß in den verbleibenden Wochen mindestens auf siebzig Kilo kommen. Nach Hause darf ich nicht, da es wegen der Malaria zu gefährlich ist. Da fäl t mir Sophia in Maralal ein. Sie hat eine schöne Wohnung und kann gut kochen. Mit dieser Möglichkeit ist auch die Ärztin einverstanden. Doch frühestens in zwei Wochen kann ich das Hospital verlassen.
Weil ich tagsüber nicht mehr so viel schlafe, vergeht die Zeit schleppend. Mit meinen Zimmergenossinnen kann ich mich nur spärlich unterhalten. Es sind Samburu-Frauen, die schon mehrere Kinder haben. Zum Teil sind sie bekehrt durch die Mission, oder es waren Komplikationen aufgetreten, so daß sie hierher gebracht wurden. Einmal täglich am Nachmittag ist Besuchszeit. Doch in die Geburten-Abteilung kommen nicht viele Besucher, denn Kinderkriegen ist Frauensache.
Inzwischen vergnügen sich wahrscheinlich ihre Männer mit den anderen Ehefrauen.
Langsam mache ich mir auch Gedanken, wo mein Darling bleibt. Unser Wagen wird sicher repariert sein und wenn nicht, könnte er zu Fuß in etwa sieben Stunden hier sein, was für einen Massai kein großes Problem ist. Natürlich bekomme ich fast täglich Grüße von den Schwestern ausgerichtet, die er persönlich bei Pater Giuliano aufgibt. Er ist ständig im Shop und hilft dem Burschen. Mir ist der Laden im Moment egal, ich mag mir keine zusätzlichen Gedanken aufladen. Aber wie soll ich Lketinga erklären, daß ich bis nach der Geburt unseres Kindes nicht mehr nach Hause kommen kann? Sein mißtrauisches Gesicht sehe ich bereits vor mir.
Am achten Tag steht er plötzlich im Türrahmen. Etwas unsicher, doch strahlend setzt er sich auf die Bettkante. „Hello, Corinne, how are you and my baby? Are you okay?“
Dann packt er gebratenes Fleisch aus. Ich bin wirklich gerührt. Pater Giuliano ist auch hier in der Mission, und deshalb konnte er mitfahren. Viel an Zärtlichkeiten können wir nicht austauschen, da die anwesenden Frauen uns beobachten oder ihn ausfragen. Dennoch bin ich glücklich, ihn zu sehen, und erwähne deshalb nichts von meiner Absicht, die nächste Zeit in Maralal zu verbringen. Er verspricht, sobald der Wagen repariert ist, wiederzukommen. Giuliano schaut ebenfalls schnell vorbei, und dann sind beide wieder verschwunden.
Nun kommen mir die bevorstehenden Tage noch länger vor. Die einzigen Abwechslungen sind die Besuche der Schwestern sowie die Arztvisiten. Ab und zu bekomme ich eine Zeitung zugesteckt. In der zweiten Woche spaziere ich täglich etwas im Spital umher. Der Anblick der meist schwerkranken Menschen belastet mich sehr. Am liebsten stehe ich an den Bettchen der Neugeborenen und freue mich dabei sehr auf mein Kind. Ich wünsche mir von Herzen, daß es ein gesundes Mädchen wird. Sicher wird es wunderschön bei diesem Vater. Aber es gibt auch Tage, an denen ich Angst habe, mein Kind gerate nicht normal bei all den Medikamenten.
Lketinga besucht mich Ende der zweiten Woche nochmals. Als er mich besorgt fragt, wann ich denn endlich nach Hause komme, bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn mit meinem Vorhaben zu konfrontieren. Sein Gesicht verfinstert sich augenblicklich, und eindringlich fragt er: „Corinne, why do you not come home? Why you wil stay in Maralal and not with Mama? You are okay now and you get your baby in the house of Mama!“
Alle Erklärungen meinerseits will er nicht glauben. Zu guter Letzt behauptet er:
„Now I know, maybe you have a boyfriend in Maralal!“
Dieser eine Satz ist schlimmer als ein Schlag ins Gesicht. Ich habe das Gefühl, in ein tiefes Loch zu fallen und kann nur noch losheulen. Dies ist für ihn der Beweis, daß er mit seiner Vermutung richtig liegt. Aufgebracht geht er im Zimmer auf und ab, während er dauernd sagt: „I'm not crazy, Corinne, I'm really not crazy, I know the ladies!“
Plötzlich steht eine weiße Schwester im Raum. Erschrocken schaut sie mich und dann meinen Mann an. Sie wil sofort wissen, was passiert ist. Weinend versuche ich zu erzählen. Sie spricht mit Lketinga, doch es nützt erst einigermaßen, als der Arzt geholt wird, der sehr energisch mit ihm umgeht. Widerwil ig gibt er seine Zustimmung, aber Freude verspüre ich im Moment keine mehr. Zu sehr hat er mich verletzt. Er verläßt das Spital, und ich weiß nicht einmal, ob ich ihn hier oder erst in Maralal wiedersehe.
Die Schwester kommt noch mal zu mir, und wir unterhalten uns. Sie ist sehr besorgt wegen der Einstellung meines Mannes und rät mir ebenfalls, mein Kind in der Schweiz zu gebären, da es dann meine Nationalität besitzt. Hier ist es Eigentum der Familie meines Mannes, und ich könne nichts ohne Einwilligung des Vaters unternehmen. Müde winke ich ab, ich fühle mich nicht in der Lage, diese Reise anzutreten. Mein Mann würde mir sowieso keine schriftliche Erlaubnis geben, daß ich als seine Ehefrau Kenia verlassen kann, jetzt, fünf Wochen vor der Geburt.
Zudem bin ich tief im Innern überzeugt, daß er wieder ruhiger und fröhlicher wird, wenn erst das Baby geboren ist.
In der dritten Woche höre ich nichts mehr von ihm. Etwas enttäuscht verlasse ich das Spital, als sich eine Gelegenheit bietet, mit einem Missionar nach Maralal zu fahren. Die Schwestern verabschieden mich herzlich und versprechen, über Pater Giuliano meinem Mann mitzuteilen, ich sei nun in Maralal.
Sophia
Sophia ist zu Hause und freut sich riesig über meinen Besuch. Als ich jedoch meine Situation erkläre, sagt sie, das mit dem Essen sei okay, doch schlafen könne ich nicht bei ihnen, der hintere Teil der Wohnung sei als Fitnessraum für ihren Freund eingerichtet. Etwas ratlos sitze ich da, und wir überlegen, wo ich hingehen könnte. Ihr Freund macht sich immerhin auf die Suche nach einem Schlafplatz für mich. Nach Stunden kommt er wieder und erklärt, er habe ein Zimmer gefunden. Es befindet sich in der Nähe und ist ein Raum wie bei den Lodgings, nur das Bett ist größer und schöner. Sonst ist er leer. Sofort stehen einige Frauen und Kinder um uns herum, als wir das Zimmer begutachten. Ich nehme es.
Die Tage verstreichen langsam. Nur das Essen ist eine wahre Freude. Sophia kocht fantastisch. Täglich nehme ich zu. Die Nächte jedoch sind schrecklich. Bis tief in die Nacht ertönt Musik oder Geschwätz aus al en Ecken. Der Raum ist so hellhörig, daß man meinen könnte, man lebe mit seinen Nachbarn in einem Zimmer.
Jeden Abend quäle ich mich in den Schlaf.
Manchmal könnte ich selber laut schreien über diesen Krach, aber ich will das Zimmer nicht verlieren. Morgens wasche ich mich im Zimmer. Die Kleider wasche ich auch jeden zweiten Tag, damit ich etwas Abwechslung habe. Sophia streitet viel mit ihrem Freund, so daß ich mich nach dem Essen häufig zurückziehe. Mein Bauch wächst stetig, und ich bin richtig stolz.
Nun lebe ich schon eine Woche hier, und mein Mann ist kein einziges Mal gekommen, was mich traurig stimmt. Dafür habe ich James mit anderen Burschen im Dorf getroffen. Ab und zu bringt Sali, der Freund von Sophia, Kollegen mit zum Essen, und dann spielen wir Karten. Dies ist immer sehr vergnüglich.
Wieder einmal sitzen wir zu viert in der Wohnung und spielen. Die Tür ist meistens offen, damit wir mehr Licht haben. Plötzlich steht mein Mann mit seinen Speeren im Türrahmen. Noch bevor ich ihn begrüßen kann, fragt er, wer der andere Mann sei.
Alle lachen, nur ich nicht. Sophia winkt ihn herein, doch er bleibt am Türrahmen stehen und fragt mich scharf: „Corinne, is this your boyfriend?“
Ich schäme mich fast zu Tode für sein Benehmen. Sophia versucht die Situation zu lockern, doch mein Mann dreht sich um und verläßt das Haus. Langsam erwache ich aus meiner Starrheit und werde richtig wütend. Ich sitze hier im neunten Monat, sehe meinen Mann nach zweieinhalb Wochen endlich wieder, und er unterstellt mir einen Liebhaber!
Sali geht los, um ihn zu suchen, während Sophia mich beruhigt. Der Freund hat sich verzogen. Als lange nichts geschieht, gehe ich in mein Zimmer und warte. Etwas später taucht Lketinga auf. Er hat getrunken und kaut Miraa. Steif liege ich im Bett und mache mir über die Zukunft Gedanken. Dann, nach mehr als einer Stunde, entschuldigt er sich tatsächlich: „Corinne, my wife, no problem. Long time I have not seen you and the baby, so I become crazy. Please, Corinne, now I am okay, no problem!“
Ich versuche, zu lächeln und zu verzeihen. In der Nacht des folgenden Tages geht er wieder nach Hause. In den kommenden zwei Wochen sehe ich meinen Mann nicht mehr, lediglich Grüße werden mir ausgerichtet.
Endlich ist der Tag gekommen, an dem Sophia und ich ins Spital aufbrechen.
Sophia ist etwa eine Woche, ich zwei Wochen vor der Niederkunft. Wegen der schlechten Straßen wurde uns empfohlen, rechtzeitig loszufahren. Aufgeregt steigen wir in den Bus. Sophias Freund begleitet uns. Im Spital bekommen wir ein Zimmer für uns. Es ist herrlich. Die Schwestern sind erleichtert, als sie mich wiegen und ich tatsächlich genau siebzig Kilo auf die Waage bringe. Nun heißt es für uns warten.
Fast täglich stricke ich etwas für mein Kind, während Sophia den ganzen Tag Bücher über Schwangerschaft und Geburt liest. Ich wil gar nichts darüber wissen, sondern mich überraschen lassen. Mit gutem Essen versorgt uns Sali aus dem Dörfchen.
Die Zeit schleicht dahin. Täglich kommen Kinder zur Welt. Wir hören die Frauen meistens bis in unser Zimmer. Sophia wird immer nervöser. Bei ihr müßte es schon bald losgehen. Bei den täglichen Untersuchungen stel t man fest, daß sich mein Uterus bereits etwas geöffnet hat. Deshalb bekomme ich Bettruhe verordnet. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn kaum hat die Ärztin unser Zimmer verlassen, verliere ich mein Fruchtwasser. Überrascht und glücklich schaue ich zu Sophia und sage: „I think my baby is coming!“
Erst will sie es gar nicht glauben, da ich noch gut eine Woche Zeit habe. Sie holt die Ärztin zurück, und als sie sieht, was los ist, bestätigt sie mir mit ernster Miene, heute nacht werde mein Kind kommen.
Napirai
Sophia ist verzweifelt, weil bei ihr nichts passiert. Um acht Uhr habe ich die ersten leichten Wehen. Zwei Stunden später sind sie schon sehr vehement. Von nun an werde ich jede halbe Stunde untersucht. Gegen Mitternacht ist es kaum noch zu ertragen. Ständig muß ich mich übergeben vor Schmerz. Endlich werde ich in den Gebärsaal geführt. Es ist derselbe Raum, in dem ich schon einmal auf dem Gynäkologenstuhl saß und untersucht wurde. Die Ärztin und zwei schwarze Schwestern reden auf mich ein. Seltsamerweise verstehe ich kein Englisch mehr.
Zwischen den Wehen starre ich die Frauen an und sehe nur, wie ihre Münder auf-und zugehen. Panik ergreift mich, weil ich nicht weiß, ob ich al es richtig mache.
Atmen, gut atmen, hämmert es in meinem Kopf. Dann werden meine Beine an den Stuhl gebunden. Ich fühle mich hilflos und entkräftet. Gerade als ich schreien will, ich könne nicht mehr, drückt mir eine Schwester den Mund zu. Voller Angst schaue ich zu der Ärztin. In diesem Moment höre ich, daß sie bereits das Köpfchen des Kindes sieht. Bei der nächsten Wehe muß es kommen. Mit letzter Kraft presse ich und spüre eine Art Explosion im Unterleib. Mein Mädchen ist geboren. Es ist 1.15 Uhr. Ein gesundes, 2 960 Gramm schweres Mädchen ist auf die Welt gekommen. Ich bin überglücklich. Sie ist so schön wie ihr Vater, und wir werden sie Napirai nennen.
Noch während die Ärztin mit der Nachgeburt und dem Nähen beschäftigt ist, geht die Tür auf, und Sophia fäl t mir freudig um den Hals. Sie hat die Geburt durch das Fenster miterlebt. Mein Kindchen wird mir noch einmal gezeigt und anschließend zu den anderen Neugeborenen gebracht. Ich bin froh, denn im Moment bin ich viel zu schwach, es zu heben. Nicht einmal die angebotene Teetasse kann ich halten. Ich wil nur schlafen. Im Rollstuhl werde ich ins Zimmer zurückgebracht und bekomme eine Schlaftablette.
Um fünf erwache ich mit höllischen Schmerzen zwischen den Beinen und wecke Sophia, die sofort aufsteht, um eine Nachtschwester zu suchen. Mit schmerzstillenden Tabletten werde ich beruhigt. Um acht schleppe ich mich mühsam zum Babyraum, um mein Kind zu sehen. Als ich es endlich entdecke, bin ich erleichtert, aber es schreit vor Hunger. Ich muß es stillen, doch das bereitet große Schwierigkeiten. Aus meinen mittlerweile riesigen Brüsten kommt kein Tropfen. Mit Absaugen geht auch nichts. Gegen Abend halte ich es kaum noch aus. Meine Brüste sind hart wie Stein und schmerzen, während Napirai ununterbrochen schreit. Eine schwarze Schwester schimpft, ich solle mir mehr Mühe geben, damit sich die Milchdrüsen öffnen, bevor ich eine Entzündung bekomme. Unter grauenhaften Schmerzen probiere ich alles. Zwei Samburu-Frauen kommen und „melken“ meine Brüste fast eine halbe Stunde, bevor endlich die erste Milch fließt. Dafür hört es jetzt nicht mehr auf. Es kommt so viel, daß mein Baby wieder nicht trinken kann. Erst im Laufe des Nachmittags gelingt es das erste Mal.
Sophia liegt seit Stunden in den Wehen, doch das Kind will nicht kommen. Sie heult und schreit und verlangt einen Kaiserschnitt, was der Arzt ablehnt, da dafür kein Grund besteht. Noch nie habe ich Sophia so erlebt. Dem Arzt wird es langsam zu bunt, und er droht ihr, sie nicht zu entbinden, falls sie sich nicht beherrscht. Die Unterhaltung findet auf Italienisch statt, da auch er Italiener ist. Nach schrecklichen 36 Stunden ist auch ihr Mädchen durch Glockengeburt auf der Welt.
An diesem Abend, die Besuchszeit ist gerade vorbei, erscheint mein Darling. Am Morgen hat er über Radiocall von der Geburt unserer Tochter erfahren und sich sofort zu Fuß auf den Weg nach Wamba gemacht. Er hat sich besonders schön bemalt und frisiert und begrüßt mich freudig.
Er hat Fleisch und ein wunderschönes Kleid für mich dabei. Sofort möchte er Napirai sehen, doch die Schwestern wehren ab und vertrösten ihn auf morgen.
Obwohl er enttäuscht ist, strahlt er mich stolz und glücklich an, was mich wieder hoffen läßt. Als er das Spital verlassen muß, beschließt er, in Wamba zu übernachten, um zur ersten Besuchszeit hier zu sein. Mit kleinen Geschenken beladen kommt er ins Zimmer, als ich gerade Napirai stil e. Selig nimmt er seine Tochter in die Arme und trägt sie in die Sonne. Sie schaut ihn neugierig an, und er kann gar nicht mehr von ihr lassen. Schon lange habe ich ihn nicht mehr so fröhlich erlebt. Ich bin gerührt und weiß, jetzt wird alles wieder gut.
Die ersten Tage mit dem Baby sind anstrengend. Ich bin immer noch recht schwach, habe zu wenig Gewicht, und die genähte Scheide schmerzt sehr beim Sitzen. Nachts weckt mich mein Mädchen zwei– bis dreimal, entweder um an die Brust zu kommen oder um gewickelt zu werden. Schläft sie endlich einmal, schreit sicher das Kind von Sophia. Hier benützt man Stoffwindeln, und gewaschen werden die Babys in kleinen Waschbecken. Mit dem Wickeln bin ich noch nicht so vertraut.
Meine gestrickten Sachen ziehe ich ihr nicht an, aus lauter Angst, ich könnte ihr dabei die Armchen oder Beinchen verletzen. So liegt sie bis auf die Windeln nackt in einer Babydecke. Während mein Mann uns betrachtet, stellt er zufrieden fest: „She is looking like me!“
Er besucht uns täglich, doch wird er allmählich ungeduldig und möchte mit seiner Familie nach Hause gehen. Aber ich bin noch zu schwach und habe ein wenig Sorge, mit dem Baby auf mich allein gestellt zu sein. Windeln waschen, kochen, Holz suchen und viel eicht wieder im Shop mithelfen, erscheint mir fast unmöglich. Der Shop ist seit drei Wochen geschlossen, da nur noch Maismehl übrig ist und der Boy nicht mehr zuverlässig zu sein schien, wie mir Lketinga mitteilt. Außerdem besteht keine Fahrmöglichkeit, da er zu Fuß hier ist, denn mit unserem Wagen gab es wieder einmal Probleme. Diesmal sei es die Gangschaltung, hat Giuliano festgestel t. Also muß er zuerst nach Hause, um uns mit dem Landrover abzuholen, falls er repariert ist.
Das gibt mir die Möglichkeit, sicherer zu werden. Auch die Ärztin ist froh, daß ich noch ein paar Tage bleibe. Sophia hingegen verläßt am fünften Tag nach der Niederkunft das Spital und kehrt nach Maralal zurück. Drei Tage später kommt mein Mann mit dem reparierten Wagen. Ohne Pater Giuliano wären wir wirklich hilflos. Ich wil nun auch fort von Wamba, denn seit Sophia gegangen ist, habe ich schon die zweite Samburu-Mutter im Zimmer. Die erste, eine alt aussehende, ausgemergelte Frau, die ihr zehntes Kind als Frühgeburt hier bekommen hat, ist in derselben Nacht an Schwäche und Anämie gestorben. Es war einfach nicht möglich, in so kurzer Zeit die Familie der Frau zu benachrichtigen, damit ein geeigneter Blutspender gefunden werden konnte. Die Aufregung dieser Nacht hat mich Kraft gekostet, so daß ich nur noch weg will.
Stolz steht der frische Papa mit seiner Tochter auf dem Arm bei der Rezeption, während ich die Rechnung bezahle. Die 22 Tage inklusive Geburt kosten lediglich 80
Franken, ich kann es kaum glauben. Für den flying doctor hingegen muß ich tiefer in die Tasche greifen und 800 Franken bezahlen. Doch was ist das schon gegen unser beider Leben! Seit langem sitze ich wieder einmal am Steuer, und mein Mann hält Napirai. Aber schon nach den ersten hundert Metern schreit das Baby wegen des gräßlichen Lärms, den der Wagen macht. Lketinga versucht, es mit Singen zu beruhigen, doch es nützt nichts. Nun fährt mein Mann, und ich halte Napirai an die Brust, so gut es geht. Jedenfal s erreichen wir Maralal, bevor es Abend ist. Ich muß noch Windeln, einige Kleidchen und Babydecken besorgen. Auch Lebensmittel wol en wir einkaufen, da es in Barsaloi seit Wochen nichts gibt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ins Lodging zu gehen. Um nur ein Dutzend Windeln zu finden, laufe ich durch ganz Maralal. Lketinga hütet unsere Tochter.








