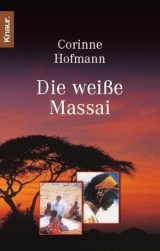
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Die erste Nacht außerhalb des Spitals ist nicht sehr gemütlich. Weil es in Maralal nachts sehr kalt wird, habe ich Probleme, Napirai die Windeln zu wechseln. Ich friere und sie ebenfalls. Stillen im Dunkeln beherrsche ich auch noch nicht so gut. Am Morgen bin ich müde und habe bereits Schnupfen. Die Hälfte der Windeln ist verbraucht. So wasche ich sie noch hier. Gegen Mittag ist der Wagen mit Lebensmitteln gefül t, und wir brechen auf. Für uns ist klar, den Umweg zu fahren.
Aber mein Mann stellt fest, daß es in den Bergen in Richtung Baragoi regnet. Es besteht die Gefahr, daß die Flüsse sich mit Wasser füllen, und wir diese nicht mehr passieren können. Deshalb entscheiden wir uns, den Weg zurück nach Wamba zu benützen, um von der anderen Seite her nach Barsaloi zu kommen. Wir wechseln uns im Fahren ab, da Lketinga den Wagen nun schon gut beherrscht. Nur ab und zu fährt er zu schnell in große Löcher. Napirai gefäl t das Autofahren gar nicht. Ständig schreit sie, und sobald der Wagen stillsteht, ist auch sie ruhig. So legen wir mehrere Pausen ein.
Heimkehr zu dritt
Unterwegs lädt Lketinga zwei Krieger ein, und nach über fünf Stunden Fahrt erreichen wir den riesigen Wamba-River. Er ist berüchtigt wegen des Treibsandes, der beim geringsten Wasservorkommen aktiv wird. Die Mission hat hier vor Jahren einen Wagen verloren. Erschrocken halte ich vor dem steil abfallenden Hang zum River. Wir sehen Wasser. Beunruhigt steigen die Massai aus und gehen zum Fluß hinunter. Er führt nicht viel Wasser, viel eicht zwei bis drei Zentimeter, und ab und zu lugen einzelne trockene Sandbänke hervor. Doch Pater Giuliano hat mich ausdrücklich gewarnt, beim geringsten Naß sei der River zu meiden. Immerhin mißt er eine Breite von zirka 150 Metern. Ich sitze am Steuer des Wagens und überlege enttäuscht, daß wir wohl zurück nach Wamba müssen. Einer der Krieger ist schon bis zu den Knien eingesunken. Der andere, nur einen Meter neben ihm, geht ohne Probleme weiter. Auch Lketinga versucht es. Immer wieder sinkt er ein. Mir ist das Ganze unheimlich, und ich will nichts riskieren. Ich steige aus, um dies meinem Mann mitzuteilen. Doch er kommt wild entschlossen zurück, nimmt mir Napirai ab und fordert mich auf, mit Vol gas zwischen den beiden Kriegern hindurchzufahren.
Verzweifelt versuche ich, ihm dies auszureden, doch er sieht es nicht ein. Er will nach Hause, wenn nicht mit dem Wagen, dann zu Fuß. Aber allein kann ich mit dem Kind nicht zurückfahren.
Ganz langsam steigt der Fluß an. Ich weigere mich, zu fahren. Nun wird er wütend, drückt mir Napirai in die Arme, setzt sich selber ans Steuer und will losfahren. Er verlangt von mir den Zündschlüssel. Ich habe ihn nicht und bin der Meinung, er steckt, da der Motor läuft. „No, Corinne, please give me the key, you have driven the car, now you have taken it that we go back to Wamba!“
sagt er ärgerlich, dabei funkeln seine Augen böse. Ich gehe zum Wagen, um nachzusehen. Welch ein Hohn, der Wagen läuft ohne Zündschlüssel! Fieberhaft suche ich am Boden und auf den Sitzen, doch der Schlüssel, unser einziger, ist verschwunden.
Lketinga gibt mir die Schuld. Wütend setzt er sich in den Wagen und braust im Vierrad in den River hinein. Bei so viel Unvernunft kann ich mich nicht mehr beherrschen und heule los. Auch Napirai schreit lauthals. Der Wagen sticht in den Fluß. Die ersten Meter geht es gut, die Räder versinken nur ein wenig, doch je weiter er fährt, desto langsamer wird er, und die hinteren Räder sinken durch das schwere Gewicht langsam ab. Er ist nur noch wenige Meter von einer trockenen Sandbank entfernt, als der Wagen droht, zum Stil stand zu kommen, weil die Räder durchdrehen. Ich bete und heule und verfluche al es. Die beiden Krieger stapfen zum Wagen, heben ihn an und schieben. Tatsächlich schafft er die letzten zwei Meter, und die Reifen greifen wieder. Mit Schwung überquert er die zweite Hälfte des Rivers. Mein Mann hat das Kunststück geschafft. Doch stolz bin ich nicht. Zu leichtsinnig hat er al es aufs Spiel gesetzt. Außerdem fehlt der Schlüssel immer noch.
Ein Krieger kommt zurück und hilft mir durch den Fluß. Auch ich sinke oft bis zu den Knien ein. Lketinga steht stolz und wild neben dem Wagen und meint, ich solle jetzt den Schlüssel hergeben. „I don't have it!“
schreie ich entrüstet. Ich gehe zum Wagen und suche erneut al es ab, nichts.
Ungläubig schüttelt Lketinga den Kopf und sucht selbst.
Es dauert nur ein paar Sekunden, und dann hält er den Schlüssel in der Hand. Er sei zwischen dem Sitz und der Rückenlehne eingeklemmt gewesen. Wie dies passieren konnte, ist für mich ein Rätsel. Für ihn dagegen ist klar, daß ich ihn versteckt habe, weil ich nicht durch den River wollte. Schweigend fahren wir nach Hause.
Als wir Barsaloi endlich erreichen, ist es bereits Nacht. Natürlich gehen wir zuerst zu Mama in die Manyatta. Mein Gott, freut sie sich! Sofort nimmt sie Napirai an sich und segnet sie, indem sie die Fußsohlen, Handflächen und die Stirne bespuckt und dabei zu Enkai betet. Auch zu mir sagt sie einiges, was ich nicht verstehe. Der Qualm bereitet mir Schwierigkeiten, und auch Napirai hustet. Doch die erste Nacht bleiben wir bei ihr.
Am Morgen wollen einige Leute mein Baby sehen, doch Mama erklärt, ich dürfe die ersten Wochen das Kind niemandem zeigen, außer denen, die sie mir erlaubt.
Ich verstehe das nicht und frage: „Warum, sie ist doch so schön!“ Lketinga schimpft, ich dürfe nicht sagen, sie sei schön, das bringe nur Unglück. Fremde dürfen sie nicht anschauen, weil sie ihr Böses anwünschen könnten. In der Schweiz zeigt man stolz seine Kinder, hier muß ich meine Tochter verstecken oder wenn ich hinausgehe, ihr den Kopf mit einem Kanga zudecken. Es fällt mir sehr schwer.
Seit drei Tagen sitze ich fast den ganzen Tag mit meinem Baby in der dunklen Manyatta, während Mama den Eingang bewacht. Mein Mann bereitet ein Fest zur Geburt seiner Tochter vor. Dafür muß ein großer Ochse geschlachtet werden.
Mehrere Alte sind anwesend, verzehren das Fleisch und segnen dafür unsere Tochter. Ich bekomme die besten Stücke, um mich zu stärken.
Nachts tanzen einige Krieger ihm zu Ehren mit meinem Mann. Natürlich müssen auch sie später verpflegt werden. Mama hat mir eine übel riechende Flüssigkeit gebraut, die mich vor weiteren Krankheiten schützen sol. Während ich sie austrinken muß, schauen alle zu und sprechen den „Enkai“ für mich. Schon nach einem Schluck wird mir schlecht von diesem Gebräu. Unauffällig verschütte ich so viel wie möglich.
Zum Fest kommen auch der Veterinär und seine Frau, worüber ich sehr froh bin.
Zu meiner Überraschung vernehme ich, daß das Blockhaus neben dem ihren frei geworden ist. Jetzt freue ich mich riesig auf ein neues Haus mit zwei Wohnräumen und einem WC direkt im Haus. Am nächsten Tag ziehen wir aus dem zugigen Shop in das etwa 150 Meter entfernte Blockhaus. Zuerst muß ich gründlich putzen. Mama hütet inzwischen unsere Tochter vor dem Haus. Sie hält das Kind so geschickt unter ihren Kangas versteckt, daß es gar nicht auffäl t.
Immer wieder kommen Leute zum Shop und wollen etwas kaufen. Er sieht leer und verkommen aus. Das Kreditbüchlein ist fast voll. Das eingenommene Geld reicht wieder nicht für einen Laster, aber im Moment wil und kann ich nicht arbeiten. So bleibt der Laden geschlossen.
Täglich bin ich bis mittags damit beschäftigt, die verschmutzten Windeln vom Vortag zu waschen. Meine Knöchel sind in kurzer Zeit völlig wund. So kann es nicht weitergehen. Ich suche ein Mädchen, das mir im Haushalt helfen kann und vor allem die Wäsche erledigt, damit mir mehr Zeit für Napirai und das Kochen bleibt. Lketinga organisiert eine ehemalige Schülerin. Für etwa 30 Franken im Monat plus Essen ist sie bereit, Wasser zu holen und zu waschen. Nun kann ich endlich mein Töchterchen genießen. Sie ist so hübsch und fröhlich und weint fast nie. Auch mein Mann liegt viele Stunden mit ihr unter dem Baum vor der Blockhütte.
Allmählich habe ich den Tagesablauf im Griff. Das Mädchen arbeitet sehr langsam, und ich finde keinen rechten Zugang zu ihr. Mir fäl t auf, daß das Waschmittel rasch schwindet. Unser Reis– und Zuckervorrat nimmt ebenfalls rapide ab. Nachdem Napirai bei jeder nassen Windel sofort schreit und ich feststelle, daß sie zwischen den Beinen feuerrot und wund ist, wird es mir zuviel. Ich spreche das Mädchen auf diese Dinge an und erkläre ihr, daß sie die Windeln so lange spülen muß, bis keine Omo-Reste mehr vorhanden sind. Sie zeigt sich eher desinteressiert und meint, mehr als einmal Wasserholen am River sei zuviel für das gebotene Geld. Verärgert schicke ich sie wieder nach Hause. Lieber wasche ich selber.
Hunger
Die Menschen werden ungeduldig, weil sie hungern. Schon mehr als einen Monat sind die Shops leer, und jeden Tag kommen Leute zu unserem Haus, um zu fragen, wann wir wieder öffnen. Im Moment jedoch sehe ich keine Möglichkeit, wieder zu arbeiten. Ich müßte dazu nach Maralal und einen Laster organisieren. Mit unserem Wagen aber habe ich zu große Angst, mit dem Baby irgendwo steckenzubleiben. Die Gangschaltung ist nur notdürftig gerichtet, das Zündschloß völlig verwürgt und manches andere reparaturbedürftig.
Eines Tages kommt der Mini-Chief zu uns und beklagt sich über den Hunger der Leute. Er weiß, daß noch einige Maismehlsäcke im Shop sind und bittet uns, wenigstens diese zu verkaufen. Widerwillig gehe ich in den Shop, um die Säcke zu zählen. Mein Mann kommt mit. Als wir jedoch den ersten Sack öffnen, wird mir fast übel. Obenauf kriechen fette, weiße Maden, dazwischen tummeln sich kleine, schwarze Käfer. Wir öffnen die anderen Säcke, und überal bietet sich das gleiche Bild. Der Chief stochert im Sack herum und meint, nach der oberen Schicht würde es besser. Doch ich weigere mich, dieses Zeug unter die Leute zu bringen. Inzwischen scheint es sich in Windeseile herumgesprochen zu haben, daß wir noch Maismehl besitzen. Immer mehr Frauen stehen im Shop und sind bereit, auch dieses zu kaufen. Wir besprechen die Lage, und ich biete an, alles zu verschenken. Das lehnt der Mini-Chief ab und sagt, das würde in kurzer Zeit zu Mord und Totschlag führen, wir sollen zu einem bil igeren Preis verkaufen. Mittlerweile stehen fünfzig oder mehr Personen im und vor dem Shop und halten ihre Säcke und Tüten auf. Ich aber kann nicht in diese Säcke greifen, da es mich vor dem Gekrabbel der Maden graust.
Schließlich habe ich auch noch Napirai auf dem Arm. Ich sehe los, um zu Hause bei Mama nach dem älteren Bruder zu suchen. Er ist da und kommt mit zum Shop.
Napirai gebe ich Mama. Wir kommen gerade noch rechtzeitig. Der Chief hindert die Leute daran, den Laden zu stürmen, während Lketinga verkauft. Jede Person darf nur maximal drei Kilogramm kaufen. Ich lege die Kilosteine auf die Waage und kassiere. Die beiden Männer fül en das unappetitliche Maismehl ab. Wir arbeiten wie verrückt und sind froh, daß der Chief einigermaßen Ordnung hält. Gegen 20 Uhr sind alle Säcke verkauft, und wir sind völ ig erledigt. Aber endlich ist wieder etwas Geld in der Kasse.
Der Verkauf und die Einsicht in die Notwendigkeit unseres Shops beschäftigen mich am Ende dieses Tages sehr. Doch viel Zeit bleibt mir nicht, ich muß zu meinem Baby nach Hause. Voller Sorge eile ich im Dunkeln zu den Manyattas. Mein Kind hat schon mehr als sechs Stunden keine Brust mehr gehabt, und ich erwarte, eine völlig aufgelöste Tochter vorzufinden. Als ich mich der Manyatta nähere, vernehme ich keinen Laut von ihr, dafür singt Mama. Ich krieche hinein und sehe verblüfft, wie mein Mädchen an der großen, langen, schwarzen Brust der Mama saugt. Bei diesem Anblick kann ich nur staunen. Mama lacht, während sie mir mein nacktes Baby entgegenstreckt. Als Napirai meine Stimme hört, schreit sie gleich los, um sich aber sofort wieder an meiner Brust festzusaugen. Ich bin immer noch sprachlos, daß Mama sie mit ihrer leeren Brust so lange beruhigen konnte.
Kurze Zeit später erscheint mein Mann, und ich erzähle ihm davon. Er lacht und meint, das sei normal hier. Auch Saguna sei zu ihr gekommen, schon als kleines Baby, weil das hier so üblich sei. Das erste Mädchen der Söhne bekommt die Mama als spätere Haushaltshilfe. Sie zieht es praktisch von Geburt an mit ihrer Brust und Kuhmilch auf. Ich betrachte mein Mädchen. Obwohl es vor Dreck steht und nach Rauch riecht, bin ich sehr zufrieden und mir dennoch gewiß, mein Kind niemals irgend jemandem zu überlassen.
Wir trinken Chai bei Mama und gehen dann zurück in unser Haus. Stolz trägt Lketinga Napirai. Vor der Tür wartet der Chief. Natürlich muß ich ihm nochmals Chai kochen, obwohl ich keine Lust dazu habe. Plötzlich steht Lketinga auf, holt aus der Geldschachtel 200 Schillinge und gibt das Geld dem Chief. Ich weiß nicht wofür, doch halte ich den Mund. Nachdem er gegangen ist, erfahre ich, daß er das Geld für seine Sicherheitshilfe im Shop verlangt hat. Mich ärgert das, da er uns wieder hereingelegt hat. Er wol te ja unbedingt, daß wir verkaufen, und es war seine Pflicht, als Chief für Ordnung zu sorgen, dafür wird er vom Staat bezahlt. All dies versuche ich Lketinga schonend beizubringen und stelle erfreut fest, daß er sich diesmal selber ärgert und mir zustimmt.
Der Shop bleibt weiterhin geschlossen. Der Bursche, der mit Lketinga im Laden stand, kommt häufig vorbei. Mit mir gibt er sich nicht ab, was mich nicht weiter stört.
An den Gesprächen merke ich, daß er etwas wil. Doch mein Mann winkt ab, er wol e nur den letzten Lohn, den er ihm aber schon ausbezahlt habe. Ich halte mich heraus, denn ich war in Maralal und im Spital und weiß von nichts.
Unser Leben verläuft ruhig, und Napirai entwickelt sich zu einem richtigen Pummelchen. Fremden darf ich sie nach wie vor nicht zeigen. Jedesmal, wenn jemand in die Nähe kommt, versteckt Lketinga sie unter der Babydecke, was sie gar nicht mag.
Eines Tages kommen wir vom River und wollen ins Chai-Haus, als ein Alter auf Lketinga zukommt. Wieder wird geredet. Mein Mann sagt mir, ich sol e hier warten und marschiert zum „Polizeihäuschen“. Dort erkenne ich den richtigen Chief, den Wildhüter und den Boy vom Shop. Aus einiger Entfernung beobachte ich beunruhigt die Diskussion. Napirai hängt an meiner Seite in einem Kanga und schläft. Als Lketinga nach mehr als einer Viertelstunde nicht zurückkommt, schlendere ich zu den Männern.
Irgend etwas geht vor, ich sehe es am Gesichtsausdruck meines Mannes. Er ist wütend, und es wird heftig debattiert, während der Boy etwas abseits lässig zuschaut. Immer wieder höre ich „Duka“, „Shop“. Da ich weiß, daß der Chief Englisch spricht, will ich von ihm wissen, um was es geht. Ich bekomme keine Antwort, statt dessen geben sich alle die Hand, und Lketinga schleicht verstört davon. Mit drei Schritten bin ich neben ihm, packe ihn bei der Schulter und wil wissen, was hier abgelaufen ist. Müde dreht er sich zu mir um und erzählt, er müsse dem Boy noch fünf Ziegen abgeben für seine Arbeit im Shop, ansonsten droht ihm der Vater des Boys mit einer Anzeige bei der Polizei. Er will aber nicht ins Gefängnis. Ich verstehe überhaupt nicht, was los ist.
Eindringlich frage ich meinen Mann, ob der Boy seinen Lohn jeden Monat bekommen hat. „Yes, Corinne, I don't know, why they want five goats, but I don't want to go again in prison, I'm a good man. The father of this boy is a big man!“
Ich kann Lketinga glauben, daß er das Geld bezahlt hat. Ihm mit Gefängnis zu drohen für nichts und wieder nichts ist wirklich das letzte, das ich ertragen kann, zumal dieser Boy schuld daran ist. Wutentbrannt stürze ich auf ihn los und schreie ihn an: „What do you want from me?“ „From you nothing, only from your husband“, lächelt er mich blöde an. Nun kann ich nicht mehr an mich halten und schlage und trete blindlings auf ihn ein. Er will ausweichen, doch ich erwische sein Hemd und zerre ihn heran, während ich ihn lauthals mit deutschen Flüchen eindecke und anspucke.
Die umstehenden Männer halten mich fest, und Napirai schreit wie am Spieß.
Inzwischen ist Lketinga da und sagt ärgerlich: „Corinne, you are crazy, go home!“
„I'm not crazy, really not crazy, but if you give goats to this boy, I don't open again this shop!“
Der Boy wird von seinem Vater festgehalten, sonst würde er mich sicher anfallen.
Wütend reiße ich mich los und laufe mit der schreienden Napirai nach Hause. Ich verstehe meinen Mann nicht, warum er sich so einschüchtern läßt und kann auch den Chief nicht begreifen. Ab jetzt werde ich mir jeden Handgriff bezahlen lassen.
Niemand kommt mehr in unseren Wagen, ohne vorher bezahlt zu haben! Viele starren mich an, als ich an ihnen vorbeirase, doch mir ist es egal. Mir ist klar, daß ich den Burschen und seinen Vater schwer beleidigt habe, denn hier schlagen die Frauen keine Männer, eher umgekehrt.
Es dauert nicht lange, und Lketinga kommt mit dem Chief nach Hause. Sofort wollen sie wissen, warum ich das gemacht habe. Mein Mann ist verstört und entsetzt, was mich gleich wieder aufbrausen läßt. Dem Chief lege ich unser Kreditbuch auf den Tisch, damit er sieht, wie viele tausend Schillinge wir wegen des Burschen ausstehen, wenn nicht verloren haben. Außerdem steht er selbst mit über 300
Schillingen bei uns in der Kreide. Und so einer will fünf Ziegen, was einen halben Jahreslohn bedeutet! Nun dämmert es auch dem Chief, und er entschuldigt sich für seinen Entscheid. Wir müssen aber einen Weg finden, uns mit dem Alten zu einigen, da Lketinga bereits mit Handschlag das Urteil akzeptiert hat.
Höflichkeitshalber muß ich für den Chief Tee kochen. Ich entzünde die Holzkohle in unserem Öfchen und stelle es ins Freie, damit der Luftzug die Kohle schnel er zum Glühen bringt. Es ist eine sternenklare Nacht. Gerade wil ich zurück ins Haus, als ich nur ein paar Meter von mir entfernt eine Gestalt mit einem blitzenden Gegenstand bemerke. Augenblicklich verspüre ich Gefahr und trete sofort ins Haus, um meinen Mann zu informieren. Er geht hinaus, und ich folge dicht hinter ihm. Der Chief bleibt in der Hütte. Ich höre Lketinga fragen, wer hier sei. Kurz darauf erkenne ich die Stimme und die Gestalt des Boys, der eine Machete in der Hand hält. Böse frage ich, was er hier zu suchen habe. Er antwortet kurz, er sei hier, um mit der „Mzungu“
abzurechnen. Sofort stürze ich ins Haus zurück und frage den Chief, ob er alles gehört habe. Er nickt und kommt nun ebenfalls heraus.
Erschrocken wil der Bursche wegrennen, doch Lketinga hält ihn fest und nimmt ihm die gefährliche Machete aus der Hand. Triumphierend schaue ich den Chief an, nun sei er Zeuge eines Mordversuchs geworden. Er sol ihn festnehmen, und morgen fahren wir al e zusammen nach Maralal. Diesen gemeingefährlichen Idioten will ich nicht mehr in unserer Nähe sehen. Der Bursche versucht, al es abzuwiegeln, doch ich bestehe auf einer Festnahme. Der Chief geht mit dem Burschen weg. Mein Mann verschwindet auch, und ich verriegle zum ersten Mal die Haustür.
Kurze Zeit später klopft es. Nach vorsichtigem Nachfragen öffne ich dem Veterinär.
Er hat den Lärm gehört und will wissen, was passiert ist. Ich biete ihm Tee an und erzähle den Vorfall. Er bestätigt mich in meinem Vorhaben und bietet mir seine Hilfe an. Ohnehin hat er nie verstanden, warum wir diesen verrückten Burschen bei uns arbeiten ließen, denn er hat schon manches angerichtet, das sein Vater ausbügeln mußte. Während wir uns unterhalten, kommt mein Mann nach Hause. Verdutzt schaut er zum Veterinär und dann zu mir. Der Veterinär beginnt ein Gespräch mit ihm. Ich verabschiede mich und krieche unter das Moskitonetz zu meiner Napirai.
Der Vorfal geht mir nicht aus dem Kopf, und ich habe Mühe einzuschlafen. Später kommt Lketinga ebenfalls ins Bett. Er versucht, mit mir zu schlafen. Ich habe überhaupt kein Verlangen, außerdem liegt Napirai bei uns. Aber er will einfach wieder einmal Sex. Wir probieren es, doch es tut mir wahnsinnig weh. Wütend vor Schmerz stoße ich ihn weg und verlange Geduld von ihm, schließlich ist Napirai erst fünf Wochen alt. Lketinga versteht meine Abweisung nicht und behauptet ärgerlich, ich hätte es wohl schon mit dem Veterinär getrieben. Als er mir das an den Kopf wirft, habe ich endgültig genug für heute. Ich breche in Tränen aus, doch sprechen kann und will ich nicht mehr. Das einzige, was ich ihm erwidere, ist, daß er heute nicht hier im Bett schlafen kann. Seine Nähe könnte ich im Moment, nach diesem Vorwurf und nach al em, was ich heute erlebt habe, nicht mehr ertragen. So richtet er sich ein Nachtlager im vorderen Raum ein. Napirai kommt in der Nacht zwei– bis dreimal an die Brust, anschließend müssen die Windeln gewechselt werden.
Um etwa sechs Uhr morgens, als sie sich gerade wieder meldet, klopft es an unsere Tür. Es wird wohl der Chief sein, doch bin ich nach unserer Auseinandersetzung nicht mehr in der Stimmung, nach Maralal zu fahren. Lketinga öffnet, und vor der Tür steht der Vater des Boys mit dem Chief. Während ich in meinen Rock steige, wird draußen heftig debattiert. Nach einer halben Stunde kommt mein Mann mit dem Chief in unser Haus. Es fäl t mir schwer, die Männer anzusehen.
Der Chief gibt mir eine Entschuldigung des Boys und dessen Vater weiter und erklärt, wenn wir nicht nach Maralal fahren würden, sei der Vater bereit, uns fünf Ziegen zu geben. Ich entgegne ihm, daß damit mein Leben nicht außer Gefahr sei, vielleicht versuche er es morgen oder übermorgen wieder, in Maralal hingegen verschwinde er für zwei bis drei Jahre im Gefängnis.
Der Chief teilt dem alten Mann meine Bedenken mit. Er verspricht mir, den Burschen für eine Weile zu Verwandten zu bringen. Auf meinen Wunsch hin bürgt er dafür, daß sein Sohn nie wieder näher als 150 Meter an unser Haus herankommt.
Nachdem mir der Chief diese Vereinbarung schriftlich bestätigt hat, bin ich einverstanden. Lketinga geht mit dem Alten die Ziegen abholen, bevor sie den Kral verlassen.
Ich bin froh, daß er fort ist, und gehe gegen Mittag zur Mission, um meine Tochter zu zeigen. Pater Giuliano hat sie seit Wamba nicht mehr gesehen, und Pater Roberto kennt sie überhaupt noch nicht. Beide freuen sich sehr über meinen Besuch.
Aufrichtig bewundert Pater Giuliano mein schönes Mädchen, das ihm neugierig ins weiße Gesicht schaut. Als er hört, daß mein Mann unterwegs ist, lädt er mich zum Mittagessen ein. Ich bekomme hausgemachte Teigwaren und Salat. Wie lange habe ich keinen Salat mehr gegessen! Ich komme mir vor wie im Schlaraffenland.
Während des Essens erzählt mir Giuliano, daß er demnächst für mindestens drei Monate Ferien in Italien macht. Ich freue mich für ihn, doch ist mir nicht wohl, ohne ihn hier zu sein. Wie oft war er doch ein rettender Engel in der Not!
Wir sind gerade fertig mit dem Essen, als plötzlich mein Mann auftaucht. Die Situation ist sofort gespannt: „Corinne, why do you eat here and not wait for me at home?“
Er nimmt Napirai an sich und verläßt uns. Schnel bedanke ich mich bei den Missionaren und eile Lketinga und dem Baby nach. Napirai schreit. Als wir zu Hause sind, gibt er mir das Kind und fragt: „What do you have made with my baby, now she cries only, when she comes to me!“
Statt zu antworten, frage ich ihn, weshalb er schon zurück ist. Er lacht höhnisch:
„Because I know you go to other men, if I'm not here!“
Wütend über die ewigen Vorwürfe beschimpfe ich ihn, er sei crazy. „What do you tel me? I'm crazy? You tell your husband, he is crazy? I don't want see you again!“
Dabei packt er seine Speere und verläßt das Haus. Wie versteinert sitze ich da und verstehe es nicht, warum er mir dauernd andere Männer unterstellt. Nur weil wir längere Zeit keinen Sex mehr hatten? Ich kann doch nichts dafür, daß ich erst krank und dann so lange in Maralal war! Zudem haben Samburus sowieso keinen Sex während der Schwangerschaft.
Unsere Liebe hat bereits einige Schläge einstecken müssen, so kann es nicht weitergehen. In meiner Verzweiflung nehme ich Napirai und gehe zu Mama. So gut wie möglich versuche ich ihr die Situation zu schildern. Dabei laufen mir Tränen über das Gesicht. Sie sagt nicht viel dazu, und meint lediglich, es sei normal, daß die Männer eifersüchtig sind, ich solle einfach nicht hinhören. Dieser Rat tröstet mich wenig, und ich schluchze noch heftiger. Jetzt schimpft sie mit mir und sagt, ich hätte keinen Grund zu weinen, da er mich nicht geschlagen habe. Hier finde ich also auch keinen Trost und gehe traurig nach Hause.
Gegen Abend schaut meine Nachbarin, die Frau des Veterinärs, vorbei.
Anscheinend hat sie etwas mitbekommen von unserem Krach. Wir machen Chai und unterhalten uns zögernd. Die Krieger sind sehr eifersüchtig, meint sie, doch dürfe ich deshalb meinen Mann niemals crazy schimpfen. Das sei gefährlich.
Als sie geht, fühle ich mich mit Napirai sehr verlassen. Ich habe nichts gegessen seit gestern Mittag, aber wenigstens habe ich Milch im Überfluß für mein Baby. Diese Nacht kommt mein Mann nicht nach Hause. Langsam mache ich mir große Sorgen, ob er mich wirklich verlassen hat. Am nächsten Morgen fühle ich mich elend und komme kaum aus dem Bett. Meine Nachbarin schaut mittags wieder vorbei. Als sie sieht, daß es mir schlecht geht, hütet sie Napirai und wäscht al e Windeln. Dann holt sie Fleisch und kocht mit meinem letzten Reis ein Essen für mich. Ich bin gerührt über ihren Einsatz. Hier entwickelt sich das erste Mal eine Freundschaft, in der nicht ich, die Mzungu, gebe, sondern mir eine Freundin ohne Aufforderung hilft. Tapfer esse ich den gefüllten Tel er leer. Sie will nichts, da sie schon gegessen hat.
Nachdem sie alle Arbeiten erledigt hat, geht sie nach Hause, um bei sich Ordnung zu machen.
Grußlos inspiziert Lketinga, als er am Abend endlich zurückkommt, alle Räume.
Ich versuche, möglichst normal zu sein und biete ihm Essen an, das er sogar annimmt. Das ist ein Zeichen, daß er zu Hause bleiben wird. Ich bin froh und schöpfe Hoffnung. Doch es kommt anders.
Quarantäne
Gegen neun Uhr bekomme ich schreckliche Magenkrämpfe. Ich liege im Bett und ziehe meine Beine bis zum Kinn hoch, damit es einigermaßen erträglich ist. Napirai kann ich so nicht stil en. Sie ist beim Papa und schreit. Diesmal zeigt er sich geduldig und läuft stundenlang singend in der Wohnung umher. Sie beruhigt sich nur kurz und schreit dann weiter. Gegen Mitternacht ist mir so schlecht, daß ich erbrechen muß.
Das ganze Essen kommt unverdaut hoch. Ich breche und breche und kann nicht mehr aufhören. Es kommt nur noch gelbe Flüssigkeit. Der Boden ist verschmutzt, doch ich fühle mich zu elend, um alles aufzuwischen. Mir ist kalt, und ich bin sicher, hohes Fieber zu haben.
Lketinga macht sich Sorgen und geht zur Nachbarin, obwohl es schon sehr spät ist. Es dauert nicht lange, und sie ist bei mir. Wie selbstverständlich putzt sie die ganze Misere auf. Besorgt fragt sie mich, ob ich vielleicht wieder Malaria habe. Ich weiß es nicht und hoffe, nicht schon wieder ins Spital zu müssen. Die Magenschmerzen lassen nach, und ich kann die Beine wieder strecken. Nun bin ich auch in der Lage, Napirai die Brust zu geben.
Die Nachbarin geht nach Hause, und mein Mann schläft neben meinem Bett auf einer zweiten Matratze. Morgens geht es mir einigermaßen, und ich trinke Chai, den Lketinga gekocht hat. Doch es dauert keine halbe Stunde, und der Tee schießt wie eine Fontäne unkontrol iert aus meinem Mund hervor. Gleichzeitig setzen wieder heftige Magenschmerzen ein. Sie werden so stark, daß ich in der Hocke am Boden sitze und die Beine anziehe. Nach einiger Zeit beruhigt sich der Magen wieder, und ich beginne mit dem Waschen des Babys und der Windeln. Sehr schnell bin ich völ ig ermattet, obwohl ich im Moment weder Schmerzen noch Fieber habe. Auch der typische Schüttelfrost bleibt aus. Ich bezweifle, daß es Malaria ist und denke eher an eine Magenverstimmung.
Jeder Versuch, etwas zu essen oder zu trinken, scheitert während der nächsten zwei Tage. Die Schmerzen halten länger und heftiger an. Meine Brüste schwinden, weil ich keine Nahrung behalten kann. Am vierten Tag bin ich total ausgelaugt und kann nicht mehr aufstehen. Meine Freundin kommt zwar jeden Tag und hilft, wo es nur geht, doch stillen muß ich schon selber.
Heute kommt Mama zu uns, weil Lketinga sie geholt hat. Sie schaut mich an und drückt auf meinem Magen herum, was höl ische Schmerzen verursacht. Dann deutet sie auf meine Augen, sie seien gelb, und auch mein Gesicht habe eine komische Farbe. Sie wil wissen, was ich gegessen habe. Aber außer Wasser habe ich ja schon lange nichts mehr bei mir behalten. Napirai schreit und wil gestillt werden, doch ich kann sie nicht mehr halten, da ich mich al ein nicht mehr aufrichten kann.
Mama hält sie an meine schlaffe Brust. Ich bezweifle, daß ich noch genug Milch habe und mache mir Sorgen, was mein Mädchen denn sonst zu sich nehmen kann. Da auch Mama zu dieser Krankheit keinen Rat weiß, beschließen wir, ins Spital nach Wamba zu fahren.
Lketinga fährt, während meine Freundin Napirai hält. Ich selbst bin zu schwach.
Natürlich ziehen wir uns unterwegs wieder einen Platten zu. Es ist zum Verzweifeln, ich hasse diesen Wagen. Mühsam setze ich mich in den Schatten und stille Napirai, während die beiden den Radwechsel vornehmen. Am späten Nachmittag erreichen wir Wamba. Ich schleppe mich zur Rezeption und frage nach der Schweizer Ärztin.
Mehr als eine Stunde vergeht, bis der italienische Arzt erscheint. Er fragt nach meinen Beschwerden und nimmt mir Blut ab. Nach einiger Zeit erfahren wir, daß es keine Malaria ist. Mehr weiß er erst morgen. Napirai bleibt bei mir, während mein Mann und meine Freundin erleichtert nach Barsaloi zurückfahren.
Wir kommen wieder in die Schwangerenabteilung, damit Napirai neben mir im Kinderbett schlafen kann. Da sie es nicht gewohnt ist, ohne mich einzuschlafen, schreit sie die ganze Zeit, bis eine Schwester sie zu mir ins Bett legt. Sofort saugt sie sich in den Schlaf. Am frühen Morgen erscheint endlich die Schweizer Ärztin. Sie ist nicht erfreut, als sie mich samt Kind in diesem Zustand wiedersieht.
Nach einigen Untersuchungen folgt ihre Diagnose: Hepatitis! Im ersten Moment verstehe ich nicht, was das ist. Besorgt erklärt sie mir, daß dies eine Gelbsucht, genauer gesagt eine Leberentzündung sei, die zudem noch ansteckend sei. Meine Leber verarbeitet keine Speisen mehr. Die Schmerzen werden durch die geringste Einnahme von Fett hervorgerufen. Ab sofort muß ich strengste Diät halten, absolute Ruhe haben und in Quarantäne gehen. Mit den Tränen kämpfend frage ich, wie lange es dauern wird. Mitleidig schaut sie Napirai und mich an und sagt: „Sicher sechs Wochen! Dann ist die Krankheit nicht mehr ansteckend, aber noch lange nicht ausgeheilt.“ Auch muß geprüft werden, wie es um Napirai steht. Sicher habe ich sie schon angesteckt! Jetzt kann ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die gute Ärztin versucht, mich zu trösten, es sei ja noch nicht sicher, ob Napirai auch betroffen ist.








