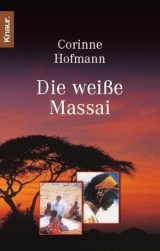
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Dann, ich kann es kaum fassen, drückt er mir noch einen Kuß auf den Mund. Ich bin gerührt, steige ein und winke den dreien zu, die in der Finsternis zurückbleiben.
Abschied und Aufbruch
In der Schweiz beginne ich sogleich mit der Suche nach einer Nachfolgerin für mein Geschäft. Viele haben Interesse, wenige eignen sich, doch diese haben kein Geld. Natürlich will ich möglichst viel herausholen, weil ich nicht weiß, wann ich wieder Geld verdienen kann. Mit zehn Franken kann ich in Kenia gut zwei Tage leben. So werde ich ziemlich geizig und lege jeden Franken für die Zukunft in Afrika zur Seite.
Schnell ist ein Monat vergangen, und von Lketinga habe ich nichts gehört. Ich habe bereits drei Briefe geschrieben. Deshalb schreibe ich nun etwas beunruhigt auch an Priscilla. Zwei Wochen später erhalte ich von ihr einen Brief, der mich verwirrt. Von Lketinga habe sie schon zwei Wochen nach meiner Abreise nichts mehr gesehen, wahrscheinlich lebe er wieder an der Nordküste. Mit seinem Paß gehe es nicht so recht vorwärts, und zu guter Letzt rät sie mir, ich solle lieber in der Schweiz bleiben. Ich bin völlig ratlos und schreibe sofort den nächsten Brief an die P.
O. Box an der Nordküste, wohin schon meine ersten Briefe an Lketinga gingen.
Nach fast zwei Monaten entschließt sich eine Freundin von mir, mein Geschäft zum ersten Oktober zu kaufen. Ich bin überglücklich, daß dieses größte Problem endlich gelöst ist. Also kann ich theoretisch im Oktober abreisen. Aber von Lketinga habe ich leider immer noch nichts gehört. In die Schweiz muß er nun nicht mehr kommen, weil ich bald wieder in Mombasa sein werde, denke ich und glaube weiterhin an unsere große Liebe. Von Priscil a erhalte ich noch zwei verworrene Briefe, doch mit unerschütterlichem Glauben gehe ich zum Reisebüro und buche einen Flug nach Mombasa für den fünften Oktober.
Mir bleiben noch gut zwei Wochen, um meine Wohnung und die Autos loszuwerden. Die Wohnung ist kein Problem, da ich alles komplett eingerichtet zu einem Spottpreis einem jungen Studenten verkaufe. So kann ich wenigstens bis zur letzten Minute in der Wohnung bleiben.
Meine Freunde, Geschäftskollegen, al e, die mich kennen, begreifen nicht, was ich mache. Für meine Mutter ist es besonders hart, doch habe ich das Gefühl, daß sie mich noch am ehesten versteht. Sie hoffe und bete für mich, daß ich finde, was ich suche, und glücklich werde.
Mein Cabriolet verkaufe ich am allerletzten Tag und lasse mich gleich zum Bahnhof bringen. Als ich das Bahnbillett nach Zürich-Kloten „einfach“ löse, bin ich aufgeregt. Mit kleinem Handgepäck und einer großen Reisetasche, in der sich einige T-Shirts, Unterwäsche, einfache Baumwollröcke und einige Geschenke für Lketinga und Priscilla befinden, sitze ich im Zug und warte auf die Abfahrt.
Als sich der Zug in Bewegung setzt, glaube ich vor Freude abzuheben. Ich lehne mich zurück, leuchte wahrscheinlich wie eine Laterne und lache vor mich hin. Ein wundervolles Gefühl der Freiheit hat mich ergriffen. Ich könnte losschreien und jedem, der im Zug sitzt, mein Glück und mein Vorhaben mitteilen. Ich bin frei, frei, frei! In der Schweiz habe ich keine Verpflichtungen mehr, keinen Briefkasten mit Rechnungen, und ich entkomme dem trostlosen, trüben Wetter im Winter. Ich weiß nicht, was mich in Kenia erwartet, ob Lketinga meine Briefe erhalten hat und wenn, ob sie ihm richtig übersetzt wurden. Ich weiß nichts und genieße einfach das beglückende Gefühl von Schwerelosigkeit.
Drei Monate werde ich Zeit haben, mich einzuleben, erst dann muß ich mich um ein weiteres Visum bemühen. Mein Gott, drei Monate, viel Zeit, um al es zu regeln und Lketinga besser kennenzulernen. Mein Englisch habe ich verbessern können, außerdem habe ich gute Bücher mit Bildern zum Lernen im Gepäck. In fünfzehn Stunden bin ich in meiner neuen Heimat. Mit diesen Gedanken steige ich ins Flugzeug, lehne mich ins Polster und sauge noch einmal die letzten Eindrücke von der Schweiz durch das Guckloch ein. Wann ich wiederkomme, ist ungewiß. Ich leiste mir zum Abschied und zum Neuanfang Champagner und weiß bald nicht mehr, ob ich lachen oder weinen soll.
In der neuen Heimat
Vom Flughafen Mombasa kann ich mit einem Hotelbus bis zum Africa-Sea-Lodge mitfahren, obwohl ich kein Hotel gebucht habe. Priscilla und Lketinga sollten informiert sein, wann ich dort bin. Ich bin furchtbar durcheinander. Was ist, wenn niemand kommt? Am Hotel angekommen, habe ich keine Zeit mehr nachzudenken.
Ich schaue mich um und sehe niemanden, der mich empfängt. Nun stehe ich da mit der schweren Tasche, meine Spannung löst sich langsam und macht einer großen Enttäuschung Platz. Doch plötzlich höre ich meinen Namen, und als ich den Weg hinaufschaue, stürmt Priscilla mit ihrem wogenden Busen auf mich zu. Vor Erleichterung und Freude schießen mir Tränen in die Augen.
Wir fallen uns um den Hals, und natürlich muß ich fragen, wo Lketinga ist. Ihr Gesicht wird finster, sie schaut mich nicht an, als sie sagt: „Corinne, please, I don't know, where he is!“
Seit damals, vor mehr als zwei Monaten, habe sie ihn nicht mehr gesehen. Es werde viel erzählt, aber sie wisse nicht, was davon wahr sei. Ich will al es erfahren, aber Priscilla meint, wir sollten zuerst zum Vil age gehen. Ich lade ihr die schwere Tasche auf den Kopf und nehme mein Handgepäck. So machen wir uns auf den Weg.
Mein Gott, was wird aus meinen Träumen vom großen Glück und der Liebe, denke ich. Wo ist nur Lketinga? Ich kann nicht glauben, daß er al es vergessen haben soll.
Im Vil age treffe ich auf eine weitere Frau, eine Muslimin. Priscilla stel t sie mir als eine Freundin vor und erklärt, momentan müßten wir zu dritt in ihrer Behausung leben, da diese Frau nicht mehr zu ihrem Mann zurückgehen wil. Das Häuschen ist zwar nicht sehr groß, aber fürs erste wird es schon reichen.
Wir trinken Tee, doch mir lassen die ungeklärten Fragen keine Ruhe. Wieder frage ich nach meinem Massai. Priscilla erzählt zögernd, was sie gehört hat. Einer seiner Kollegen erzähle, er sei nach Hause gefahren. Da er so lange keine Briefe von mir erhielt, wurde er krank. „Was?“ entgegne ich aufgebracht. „Ich habe mindestens fünfmal geschrieben.“ Jetzt schaut auch Priscil a etwas überrascht. „Ja, wohin denn?“ will sie wissen. Ich zeige ihr die P. O. Box-Adresse an der Nordküste. Dann, so meint sie, sei es kein Wunder, wenn Lketinga diese Briefe nicht bekommen habe.
Diese Box gehöre al en Massai an der Nordküste, und jeder könne herausnehmen, was er wil. Da Lketinga nicht lesen kann, habe man ihm die Briefe wahrscheinlich unterschlagen.
Ich kann kaum glauben, was Priscil a mir erzählt: „Ich dachte, alle Massai sind Freunde oder fast wie Brüder, wer soll denn so etwas machen?“ Da erfahre ich zum ersten Mal von der Mißgunst unter den Kriegern hier an der Küste. Als ich vor drei Monaten wegging, hätten einige der Männer, die schon lange an der Küste leben, Lketinga gehänselt und aufgestachelt: „So eine Frau, so jung und hübsch, mit viel Geld, wird sicher nicht mehr nach Kenia zurückkommen wegen eines schwarzen Mannes, der nichts besitzt.“ Und so, erzählt Priscilla weiter, habe er, der noch nicht lange hier lebe, wahrscheinlich den anderen geglaubt, weil er keine Briefe erhielt.
Neugierig frage ich Priscilla, wo denn sein Zuhause sei. Sie weiß es nicht genau, aber irgendwo im Samburu-District, etwa eine dreitägige Reise von hier entfernt. Ich solle mir keine Gedanken machen, ich sei jetzt gut angekommen, und sie werde versuchen, jemanden zu finden, der in absehbarer Zeit dorthin fährt und eine Nachricht überbringen kann. „Mit der Zeit erfahren wir schon, was los ist. Pole, pole“, sagt sie, was soviel heißt wie „langsam, langsam“. „Du bist jetzt in Kenia, da brauchst du viel Zeit und Geduld.“
Die beiden Frauen umsorgen mich wie ein Kind. Wir reden viel miteinander, und Esther, die Moslemfrau, erzählt von ihrem Leidensweg mit ihrem Ehemann. Sie warnen mich davor, jemals einen Afrikaner zu heiraten. Sie seien nicht treu und behandelten die Frauen schlecht. Mein Lketinga ist anders, denke ich und sage nichts dazu.
Nach der ersten Nacht beschließen wir, ein Bett zu kaufen. In der vergangenen Nacht konnte ich kein Auge schließen, denn Priscil a und ich teilten uns ein schmales Bett, während Esther an der anderen Seite auf dem zweiten Bett schlief. Da Priscil a recht voluminös ist, habe ich kaum Platz und muß mich am Bettrand festhalten, um nicht dauernd auf sie zu rutschen.
Also fahren wir nach Ukunda und laufen bei 40 Grad im Schatten von einem Händler zum nächsten. Der erste hat kein Doppelbett, könnte dies jedoch in drei Tagen herstel en. Ich aber möchte jetzt eines. Beim nächsten finden wir ein wunderschön geschnitztes Bett für etwa achtzig Franken. Ich will es sofort kaufen, doch Priscilla meint entrüstet: „Too much!“
Ich glaube, mich verhört zu haben. Für dieses Geld ein so schönes Doppelbett und handgefertigt! Aber Priscilla marschiert weiter. „Come, Corinne, too much!“
So geht es den halben Nachmittag, bis ich endlich für sechzig Franken eines kaufen kann. Der Handwerker zerlegt es, und wir transportieren alles zur Hauptstraße. Priscilla besorgt noch eine Schaumstoffmatratze, und nach einer Stunde Warten in brütender Hitze an der staubigen Straße fahren wir mit einem Matatu wieder bis zum Hotel, wo al es abgeladen wird. Jetzt stehen wir da mit den Einzelteilen, die natürlich schwer sind, da alles aus massivem Holz besteht.
Ratlos schauen wir uns um, als drei Massai vom Strand kommen. Priscilla spricht mit ihnen, und sofort helfen uns die sonst arbeitsscheuen Krieger, mein neues Doppelbett ins Vil age zu tragen. Ich muß mir das Lachen verkneifen, denn das Ganze sieht wirklich komisch aus. Als wir endlich beim Häuschen ankommen, will ich mich sofort an die Arbeit machen und das Bett zusammenschrauben, habe aber keine Chance, denn jeder der Massai will dies für mich erledigen. Inzwischen sind es bereits sechs Männer, die sich an meinem Bett zu schaffen machen.
Spät abends können wir uns erschöpft auf den Bettrand setzen. Für alle Helfer gibt es Tee, und es wird wieder einmal in der mir unverständlichen Massai-Sprache gesprochen. Von den Kriegern werde ich abwechselnd gemustert, und ab und zu verstehe ich den Namen Lketinga. Nach etwa einer Stunde verlassen uns alle, wir Frauen machen uns bereit zum Schlafen. Das heißt notdürftiges Waschen außerhalb des Häuschens, was sehr gut geht, weil es stockdunkel ist und wir sicher nicht beobachtet werden. Auch das letzte Wasserlassen findet etwas abseits der Hütte statt, denn im Dunkeln geht man nicht mehr die Hühnerleiter hoch.
Erschöpft sinke ich in einen herrlichen Schlaf im neuen Bett. Von Priscil a spüre ich diesmal nichts, da das Bett breit genug ist. Allerdings ist kaum mehr Platz in der Hütte, und wenn Besuch kommt, sitzt nun jeder auf der Bettkante.
Die Tage vergehen wie im Fluge, und ich werde von Priscilla und Esther verwöhnt.
Die eine kocht, die andere schleppt Wasser und wäscht sogar meine Kleider. Wenn ich protestiere, heißt es, für mich sei es zu heiß, um zu arbeiten. So verbringe ich die meiste Zeit am Strand und warte immer noch auf ein Zeichen von Lketinga. Abends besuchen uns häufig Massai-Krieger, wir spielen Karten oder versuchen, Geschichten zu erzählen. Mit der Zeit merke ich wohl, daß der eine oder andere Interesse an mir zeigt, aber ich habe keine Lust darauf einzugehen, da für mich nur der eine Mann in Frage kommt. Keiner ist nur halb so schön und elegant wie mein
„Halbgott“, für den ich al es aufgegeben habe. Nachdem die Krieger mein Desinteresse bemerken, höre ich weitere Gerüchte über Lketinga. Anscheinend wissen alle, daß ich immer noch auf ihn warte.
Als ich wieder einmal einem die angebotene Freundschaft, sprich Liebschaft, höflich, aber bestimmt abschlage, meint er nur: „Wieso wartest du auf diesen Massai, obwohl jeder weiß, daß er mit deinem Geld, das du ihm für den Paß gegeben hast, nach Watamu Malindi gereist ist und mit afrikanischen Girls alles versoffen hat?“
Dann steht er auf und sagt, ich solle mir sein Angebot noch mal überlegen. Ärgerlich fordere ich ihn auf, sich nicht mehr blicken zu lassen. Trotzdem fühle ich mich sehr einsam und verraten. Was ist, wenn es wirklich stimmt? Mir gehen viele Gedanken durch den Kopf, und letzten Endes weiß ich mit Gewißheit nur, daß ich das nicht glauben will. Ich könnte zum Inder nach Mombasa fahren, aber irgendwie bringe ich den Mut dazu nicht auf, denn eine Blamage wäre für mich kaum erträglich. Täglich treffe ich am Strand auf Krieger, und die Geschichten nehmen kein Ende. Einer berichtet sogar, Lketinga sei „crazy“ und nach Hause gebracht worden. Dort habe er ein junges Mädchen geheiratet und komme nicht mehr nach Mombasa. Wenn ich Trost brauche, sei er immer für mich da. Mein Gott, lassen die mich denn nie in Ruhe? Ich komme mir langsam wie ein verlorenes Reh unter Löwen vor. Jeder will mich fressen!
Abends erzähle ich Priscilla von den neuesten Gerüchten und Belästigungen. Sie meint, das sei normal. Ich sei drei Wochen hier allein ohne Mann, und normalerweise machen diese Leute die Erfahrung, daß eine weiße Frau nie lange allein bleibt. Dann erzählt mir Priscilla von zwei weißen Frauen, die schon länger in Kenia wohnen und nahezu jedem Massai nachlaufen. Einerseits bin ich schockiert, andererseits erstaunt zu hören, daß noch andere weiße Frauen hier sind und sogar Deutsch sprechen.
Diese Mitteilung weckt meine Neugier. Priscilla zeigt auf ein anderes Häuschen im Village und erklärt: „Dies gehört Jutta, einer Deutschen. Sie ist irgendwo im Samburu-District und arbeitet im Moment für ein Touristen-Camp, will aber in den nächsten zwei oder drei Wochen wieder kurz hierherkommen.“ Ich bin neugierig auf diese geheimnisvol e Jutta.
Währenddessen wiederholen sich die verbalen Annäherungsversuche, so daß ich mich wirklich nicht mehr wohl fühle. Eine alleinstehende Frau scheint Freiwild zu sein. Auch Priscilla kann oder will sich dagegen nicht richtig durchsetzen. Wenn ich ihr etwas erzähle, lacht sie manchmal kindisch, was ich nicht begreifen kann.
Meine Reise mit Priscilla
Eines Tages macht sie mir den Vorschlag, mit ihr für zwei Wochen in ihr Dorf zu fahren, um ihre Mutter und ihre fünf Kinder zu besuchen. Erstaunt frage ich: „Was, du hast fünf Kinder, wo leben die denn?“ „Bei meiner Mutter oder manchmal auch bei meinem Bruder“, sagt sie. Sie lebe an der Küste, um durch Schmuckverkauf Geld zu verdienen, und bringe dies zweimal im Jahr nach Hause. Ihr Mann wohne schon lange nicht mehr mit ihr zusammen. Wieder einmal staune ich über die afrikanischen Verhältnisse.
Bis wir zurück sind, ist vielleicht Jutta hier, denke ich und wil ige ein. Durch die Reise könnte ich auch dem Ansturm der verschiedenen Massai entkommen! Priscilla freut sich riesig, da sie noch nie eine Weiße mit nach Hause gebracht hat.
Kurz entschlossen reisen wir am nächsten Tag ab. Esther bleibt und versorgt das Häuschen. In Mombasa kauft Priscilla verschiedene Schuluniformen, die sie ihren Kindern mitbringen wil. Ich habe nur den kleinen Rucksack dabei, in dem sich etwas Unterwäsche, Pullover, drei T-Shirts und Jeans zum Wechseln befinden. Wir kaufen unsere Tickets und haben bis zur Busabfahrt am Abend noch viel Zeit. Deshalb gehe ich in einen Coiffeursalon und lasse mir die Haare zu afrikanischen Zöpfchen flechten. Diese Prozedur dauert fast drei Stunden und ist sehr schmerzhaft. Doch scheint es mir zum Reisen praktischer zu sein.
Lange vor der Abfahrt drängeln sich bereits Dutzende von Menschen um den Bus, der zuerst auf dem Dach mit allen möglichen Reiseutensilien beladen wird. Als wir abfahren, ist es stockfinster, und Priscilla schlägt vor zu schlafen. Bis Nairobi seien es sicher neun Stunden, dann müßten wir umsteigen und noch mal fast viereinhalb Stunden bis Narok durchhalten.
Während der langen Fahrt weiß ich bald nicht mehr, wie ich sitzen soll und bin erleichtert, als wir schließlich ankommen. Nun folgt ein langer Fußmarsch. Leicht ansteigend geht es fast zwei Stunden durch Felder, Wiesen, ja sogar Tannenwälder.
Landschaftlich gesehen könnte man meinen, wir seien in der Schweiz, weit und breit nur Grün und keine Menschen.
Endlich sichte ich weit oben Rauch und erkenne einige verfallene Holzbaracken.
„Wir sind gleich da“, sagt Priscil a und erklärt mir, daß sie für ihren Vater noch einen Kasten Bier besorgen müsse, dies sei das Geschenk für ihn. Ich staune nicht schlecht, als sie diesen auch noch auf dem Kopf nach oben schleppt. Ich bin gespannt, wie diese Massai leben, denn Priscilla hat mir erzählt, sie seien wohlhabender als die Samburus, von denen Lketinga abstammt. Oben angekommen gibt es ein großes Hallo. Alle stürzen herbei, begrüßen Priscilla, bleiben dann aber abrupt stehen und schauen mich schweigend an. Priscilla scheint al en zu erzählen, daß wir Freundinnen sind. Als erstes müssen wir in das Haus ihres Bruders, der etwas Englisch spricht. Die Behausungen sind größer als unser Village-Haus und haben drei Räume. Aber alles ist schmutzig und verrußt, weil auf Holzfeuer gekocht wird und überall Hühner, junge Hunde und Katzen umherspringen. Wohin man sieht, tummeln sich Kinder jeden Alters, von denen die größeren die nächst kleineren im Tragetuch auf dem Rücken schleppen. Die ersten Geschenke werden verteilt.
Die Menschen hier sehen nicht mehr sehr traditionel aus. Sie tragen normale Kleidung und leben ein geregeltes Bauernleben. Als die Ziegen nach Hause kommen, muß ich als Gast für unser Willkommensessen eine aussuchen. Ich bringe es nicht über mich, ein Todesurteil zu fäl en, aber Priscüla belehrt mich, daß dies üblich und mit großer Ehre verbunden sei. Wahrscheinlich werde ich das täglich auch bei den folgenden Besuchen machen müssen. Also zeige ich auf eine weiße Ziege, die sofort eingefangen wird. Von zwei Männern wird das arme Tier erstickt. Um das Gezappel nicht länger mit ansehen zu müssen, wende ich mich ab. Es wird bereits dunkel und kühl. Wir gehen ins Haus und setzen uns ans Feuer, das auf dem Lehmboden in einem der Räume brennt.
Wo die Ziege gekocht oder gebraten wird, weiß ich nicht. Um so überraschter bin ich, als mir ein ganzes Vorderbein und dazu ein riesiges Buschmesser gereicht werden. Priscilla bekommt das andere Bein. „Priscil a“, sage ich, „ich habe nicht soviel Hunger, ich kann das unmöglich alles essen!“ Sie lacht und meint, den Rest nehmen wir mit und essen morgen weiter. Die Vorstellung, zum Frühstück bereits wieder an diesem Bein knabbern zu müssen, behagt mir nicht. Aber ich bewahre Haltung und esse wenigstens etwas, wobei ich allerdings wegen meines geringen Hungers bald ausgelacht werde.
Da ich hundemüde bin und mein Rücken extrem schmerzt, möchte ich wissen, wo wir schlafen können. Wir bekommen eine schmale Pritsche, auf der wir zu zweit schlafen sol en. Wasser zum Waschen ist weit und breit nicht zu sehen, und ohne Feuer ist es im Raum enorm kalt. Zum Schlafen ziehe ich mir den Pulli und eine dünne Jacke an. Ich bin sogar froh, daß Priscilla sich neben mich quetscht, denn so ist es etwas wärmer. Mitten in der Nacht erwache ich, spüre ein Jucken und merke, daß diverse Tierchen an mir hoch– und runterkriechen. Ich möchte von der Pritsche springen, aber es ist stockfinster und bitterkalt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als so bis zum Morgen zu verharren. Beim ersten Lichtstrahl wecke ich Priscil a und zeige ihr meine Beine. Sie sind übersät mit roten Bißwunden, wahrscheinlich von Flöhen.
Viel ändern können wir nicht, denn Kleider zum Wechseln habe ich nicht. Ich möchte mich wenigstens waschen, aber als ich nach draußen gehe, bin ich verblüfft. Das ganze Gebiet ist in Nebel gehül t, und Reif liegt auf den saftigen Wiesen. Man könnte meinen, bei einem Bauern im Jura zu sein.
Heute ziehen wir weiter, um Priscillas Mutter und ihre Kinder zu besuchen. Wir marschieren über Hügel und Felder und treffen ab und zu Kinder oder ältere Menschen. Während die Kinder Abstand zu mir wahren, möchten mich die meisten älteren Leute, vorwiegend Frauen, berühren. Einige halten lange meine Hand und murmeln etwas, was ich natürlich nicht verstehe. Priscil a sagt, die meisten dieser Frauen hätten noch nie eine Weiße gesehen, geschweige denn berührt. So kommt es vor, daß während des Händedrückens noch darauf gespuckt wird, was eine besondere Ehre sein soll.
Nach etwa drei Stunden erreichen wir die Hütte, in der Priscil as Mutter lebt. Sofort stürzen uns Kinder entgegen und kleben an Priscilla. Ihre Mutter, noch rundlicher als Priscil a, sitzt am Boden und wäscht Kleider. Die beiden haben sich natürlich viel zu erzählen, und ich versuche wenigstens, einen Teil zu erahnen.
Diese Hütte ist die bescheidenste, die ich bisher gesehen habe. Sie ist ebenfalls rund und mit diversen Brettern, Tüchern und Plastik zusammengeflickt. Im Inneren kann ich kaum stehen, und die Feuerstelle in der Mitte erfül t den Raum mit beißendem Rauch. Ein Fenster gibt es nicht. Deshalb nehme ich den Tee im Freien ein, weil mir sonst laufend die Tränen herunterrol en und die Augen schmerzen.
Etwas beunruhigt frage ich Priscilla, ob wir hier nächtigen müssen. Sie lacht: „No, Corinne, ein anderer Bruder wohnt etwa eine halbe Stunde entfernt in einem größeren Häuschen. Da werden wir übernachten. Hier ist kein Platz, weil hier alle Kinder schlafen, und mehr als Milch und Mais gibt es nicht zu essen.“ Erleichtert atme ich auf.
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit ziehen wir weiter zum nächsten Bruder. Auch hier erwartet uns eine freudige Begrüßung. Die Leute waren nicht informiert, daß Priscil a kommt und weißen Besuch mitbringt. Dieser Bruder ist mir sehr sympathisch. Endlich kann ich mich gut unterhalten. Auch seine Frau spricht etwas Englisch. Beide haben die Schule besucht.
Dann muß ich mir erneut eine Ziege aussuchen. Ich fühle mich hilflos, denn ich möchte nicht schon wieder das zähe Ziegenfleisch essen. Andererseits habe ich wirklich Hunger und wage zu fragen, ob es noch etwas anderes zu essen gibt, wir Weißen seien es nicht gewohnt, so viel Fleisch zu konsumieren.
Alle lachen, und seine Frau meint, ob ich lieber ein Huhn mit Kartoffeln und Gemüse möchte. Bei diesem herrlichen Menüvorschlag antworte ich begeistert: „O
yes!“
Sie verschwindet und kommt bald darauf mit einem gerupften Huhn, Kartoffeln und einer Art Blattspinat zurück. Diese Massai sind richtige Bauern, haben zum Teil eine Schule besucht und arbeiten hart auf ihren Feldern. Wir Frauen essen gemeinsam mit den Kindern das wirklich gute Mahl. Es ist wie ein Eintopf und schmeckt nach all den gut gemeinten Fleischbergen wunderbar.
Wir bleiben fast eine Woche und machen unsere Besuche von hier aus. Sogar warmes Wasser wird für mich zubereitet, damit ich mich waschen kann. Trotzdem sind unsere Kleider dreckig und stinken fürchterlich nach Rauch. Langsam habe ich genug von diesem Leben und sehne mich nach dem Strand in Mombasa und meinem neuen Bett. Auf meinen Wunsch abzureisen entgegnet Priscilla, wir seien noch auf eine Hochzeitszeremonie eingeladen, die in zwei Tagen stattfindet, und so bleiben wir.
Die Hochzeit findet einige Kilometer entfernt statt. Einer der reichsten Massai soll dort seine dritte Frau heiraten. Ich bin überrascht, daß die Massai offensichtlich so viele Frauen heiraten dürfen, wie sie ernähren können. Mir kommen dabei die Gerüchte über Lketinga in den Sinn. Viel eicht ist er ja wirklich schon verheiratet?
Dieser Gedanke macht mich fast krank. Doch ich beruhige mich und denke, er hätte mir das sicher erzählt. Irgend etwas anderes steckt hinter seinem Verschwinden. Ich muß es herausfinden, sobald ich in Mombasa bin.
Die Zeremonie ist beeindruckend. Hunderte von Männern und Frauen erscheinen.
Auch der stolze Bräutigam wird mir vorgestellt, der mir anbietet, wenn ich heiraten wolle, wäre er sofort bereit, auch mich zur Frau zu nehmen. Ich bin sprachlos. Zu Priscil a gewandt fragt er sie tatsächlich, wie viele Kühe er für mich bieten müsse.
Priscil a aber wehrt ab, und er geht.
Dann erscheint die Braut, begleitet von den zwei ersten Frauen. Es ist ein wunderschönes Mädchen, geschmückt von Kopf bis Fuß. Über ihr Alter bin ich schockiert, denn sie ist bestimmt nicht älter als zwölf oder dreizehn Jahre.
Die beiden anderen Ehefrauen sind vielleicht achtzehn oder zwanzig. Der Bräutigam selbst ist sicher auch nicht sehr alt, aber immerhin etwa fünfunddreißig.
„Wieso“, frage ich Priscil a, „werden hier Mädchen verheiratet, die fast noch Kinder sind?“ Das sei eben so, sie selbst sei nicht viel älter gewesen. Irgendwie empfinde ich Mitleid mit dem Mädchen, das zwar stolz, aber nicht glücklich aussieht.
Wieder wandern meine Gedanken zu Lketinga. Ob er überhaupt weiß, daß ich siebenundzwanzig Jahre alt bin? Plötzlich fühle ich mich alt, verunsichert und nicht mehr besonders attraktiv in meinen schmutzigen Kleidern. Die zahlreichen Angebote von verschiedenen Männern, die über Priscilla auf mich zukommen, können dieses Gefühl nicht mindern. Mir gefällt keiner, und in Bezug auf einen möglichen Ehemann existiert in meinen Gedanken nur Lketinga. Ich will nach Hause, nach Mombasa.
Vielleicht ist er in der Zwischenzeit gekommen. Immerhin bin ich schon fast einen Monat in Kenia.
Begegnung mit Jutta
Wir nächtigen das letzte Mal in der Hütte und kehren am nächsten Tag nach Mombasa zurück. Mit klopfendem Herzen marschiere ich zum Village. Von weitem hört man fremde Stimmen, und Priscilla ruft: „Jambo, Jutta!“ Mein Herz macht einen Freudensprung, als ich diese Worte höre. Nach fast zwei Wochen nahezu ohne Konversation freue ich mich auf die angekommene Weiße.
Sie begrüßt mich ziemlich kühl und redet auf Suaheli mit Priscil a. Schon wieder verstehe ich nichts! Doch dann schaut sie mich lachend an und fragt: „So, wie hat dir das Buschleben gefallen? Wenn du nicht vor Dreck stehen würdest, würde ich dir das gar nicht zutrauen.“ Dabei schaut sie mich kritisch von Kopf bis Fuß an. Ich antworte, daß ich froh sei, wieder hier zu sein, denn ich sei total zerstochen und meine Haare juckten ebenfal s gräßlich. Jutta lacht: „Du wirst Flöhe und Läuse haben, das ist al es! Doch wenn du jetzt in deine Hütte gehst, bringst du sie nicht mehr raus!“
Sie schlägt mir wegen der Flöhe ein Bad im Meer mit anschließender Dusche in einem der Hotels vor. Diesen Luxus leiste sie sich immer, wenn sie gerade in Mombasa sei. Ich frage zweifelnd, ob das nicht auffal e, da ich kein Gast sei.
„Unter so vielen Weißen kann man das unbemerkt machen“, zerstreut sie meine Bedenken. Sie gehe manchmal sogar bei den Büffets Essen holen, natürlich nicht immer im selben Hotel. Über all diese Tricks staune ich und bewundere Jutta. Sie verspricht mir, nachher mitzukommen und verschwindet in ihrem Häuschen.
Priscilla versucht, mir die Zöpfchen zu öffnen. Es zieht grausam. Die Haare sind verfilzt und kleben von Rauch und Dreck. In meinem ganzen Leben war ich noch nie so schmutzig und fühle mich dementsprechend schlecht. Nach über einer Stunde mit büschelweisem Haarausfall sind wir am Ziel. Alle Zöpfchen sind geöffnet, und ich sehe aus wie nach einem Stromschlag. Mit Haarwaschmittel, Seife und frischen Klamotten ausgerüstet, klopfe ich bei Jutta an, und wir ziehen los. Sie nimmt Bleistifte und einen Zeichenblock mit. Als ich sie frage: „Was willst du denn damit machen?“ erklärt sie: „Geld verdienen! In Mombasa kann ich leicht zu Geld kommen, deswegen bin ich ja auch für zwei bis drei Wochen hier.“
„Aber wie?“ will ich wissen. „Ich zeichne Karikaturen von Touristen in zehn bis fünfzehn Minuten und verdiene pro Bild etwa zehn Franken. Wenn ich pro Tag vier bis fünf Leute male, lebe ich nicht schlecht!“ erzählt Jutta. Seit fünf Jahren schlägt sie sich auf diese Weise durch, wirkt immer noch selbstbewußt und kennt jeden Trick.
Ich bewundere sie.
Wir sind am Strand angekommen, und ich stürze mich ins erfrischende Salzwasser. Erst nach einer Stunde komme ich wieder heraus, und Jutta zeigt mir das erste Geld, das sie in der Zwischenzeit verdient hat. „So, und jetzt gehen wir duschen“, meint sie lachend. „Du mußt einfach locker und selbstverständlich am Strandwächter vorbeigehen, denn wir sind Weiße, das mußt du dir immer vor Augen halten!“ Es klappt tatsächlich. Ich dusche und dusche und wasche meine Haare wohl fünfmal, bis ich mich sauber fühle. Schließlich ziehe ich ein leichtes Sommerkleid an, und wir gehen wie selbstverständlich zum traditionellen Vier-Uhr-Tee. Alles gratis!
Hier fragt sie, warum ich eigentlich im Village sei. Ich erzähle ihr meine Geschichte, und sie hört aufmerksam zu. Danach folgen ihre Ratschläge: „Wenn du unbedingt hierbleiben willst und deinen Massai haben möchtest, muß endlich etwas geschehen.
Erstens mußt du dir ein eigenes Häuschen mieten, das kostet fast nichts, und du hast endlich Ruhe. Zweitens solltest du dein Geld zusammenhalten und eigenes verdienen, zum Beispiel mit mir Kunden werben, die ich malen kann, dann wird geteilt. Drittens glaube keinem Schwarzen an der Küste. Im Grunde wollen alle nur das Geld. Um zu sehen, ob dieser Lketinga deinen Kummer wert ist, gehen wir morgen ins Reisebüro und sehen nach, ob er dein Geld von damals dort gelassen hat. Wenn ja, ist er noch nicht verdorben vom Tourismus, das meine ich ernst.“ Wenn ich ein Foto von ihm hätte, würden wir ihn mit etwas Glück schon finden!
Jutta tut mir einfach gut. Sie kann Suaheli sprechen, kennt sich aus und hat Energie wie ein Rambogirl. Am nächsten Tag fahren wir nach Mombasa, aber nicht etwa mit dem Bus. Jutta meint, sie werfe doch ihr sauer verdientes Geld nicht zum Fenster heraus, und hält gekonnt den Daumen raus. Tatsächlich hält das erste private Auto, das vorbeikommt. Es sind Inder, die uns bis zur Fähre mitnehmen. Hier besitzen fast nur Inder oder Weiße Privatautos. Jutta lacht mich an: „Siehst du, Corinne, schon hast du wieder etwas gelernt!“
Nach langem Suchen finden wir das Reisebüro. Ich hoffe sehnlichst, daß das Geld nach nunmehr fast fünf Monaten noch hier ist, nicht unbedingt des Geldes wegen, sondern um in dem Glauben bestätigt zu werden, mich in Lketinga und unserer Liebe nicht getäuscht zu haben. Obendrein wil mir Jutta bei der Suche nach Lketinga nur helfen, wenn er dieses Geld nicht abgeholt hat. Anscheinend glaubt sie nicht daran.








