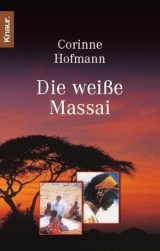
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Es ist bereits dunkel im Dschungel, als wir losfahren können, al es im ersten Gang und mit Vierrad. Wenn es bergab geht, wird der Wagen viel zu schnel, geradeaus heult dafür der Motor gräßlich auf, doch zu schalten traue ich mich nicht.
Automatisch trete ich in kritischen Momenten auf die nicht funktionierende Bremse.
Nach mehr als einer Stunde erreichen wir erleichtert Maralal. Hier überqueren die Leute friedlich die Straße in der Annahme, die wenigen Autos bremsen ab. Ich kann nur hupen, und die Leute springen schimpfend zur Seite. Kurz vor der Garage drehe ich den Zündschlüssel ab und lasse den Wagen ausrol en. Der Chef-Somali will gerade schließen. Ich erkläre ihm mein Problem und daß der Wagen voller Ware ist, die ich nicht ohne Aufsicht lassen kann. Er öffnet das Eisentor, und einige Männer schieben das Gefährt hinein.
Gemeinsam gehen wir Chai trinken und beraten, immer noch völlig geschockt, unsere Lage. Nun müssen wir ein Lodging suchen. Der Wildhüter schaut für sich, während ich natürlich die Burschen und meinen Helfer einlade. Wir nehmen zwei Zimmer. Die Burschen bemerken, sie könnten sich gut zu zweit ein Bett teilen. Ich wil allein sein. Nach dem Essen verziehe ich mich. Bei dem Gedanken an meinen Mann wird mir ganz elend. Er weiß ja nicht, was geschehen ist, und wird sich große Sorgen machen.
Früh suche ich die Garage auf. Die Arbeiter sind dabei, unseren Wagen zu reparieren. Auch für den Chef-Somali ist es ein Rätsel, wie das passieren konnte.
Um elf Uhr können wir aufbrechen, doch diesmal wage ich nicht, die Urwaldstraße zu benützen. Mir sitzt die Angst zu tief in den Knochen, und schließlich bin ich im vierten Monat schwanger. Wir fahren den Umweg über Baragoi, der etwa viereinhalb Stunden dauert. Während der Fahrt denke ich an die Sorge, die mein Mann mittlerweile haben muß. Wir kommen gut voran. Diese Straße, deren einzige Tücke die vielen Schottersteine sind, ist viel anspruchsloser. Wir haben gut die Hälfte hinter uns, als nach dem Überqueren eines ausgetrockneten Flußbetts sich ein mir bereits vertrautes Zischen bemerkbar macht. Zu al em Unglück haben wir auch noch einen Platten! Alle steigen aus, und die Burschen hieven das Reserverad unter den Zuckersäcken hervor. Mein Helfer plaziert den Wagenheber, und nach einer halben Stunde ist der Schaden behoben. Ausnahmsweise habe ich nichts zu tun, sitze in der prallen Sonne und rauche eine Zigarette. Wir setzen unsere Fahrt fort und erreichen Barsaloi im Laufe des Nachmittags.
Wir parken neben dem Laden, und ich wil gerade aussteigen, als mein Mann mit bösem Blick auf mich zukommt. Er steht vor der Wagentür und schüttelt den Kopf:
„Corinne, what is wrong with you? Why you come late?“
Ich berichte, doch er wehrt, ohne zuzuhören, verächtlich ab und fragt statt dessen, mit wem ich die Nacht in Maralal verbracht habe. Jetzt packt mich die Wut. Wir sind knapp mit dem Leben davongekommen, und mein Mann glaubt, ich hätte ihn betrogen! Daß er so reagieren würde, hätte ich mir niemals vorstellen können.
Die Burschen kommen mir zu Hilfe und schildern die Fahrt. Er kriecht unter den Wagen und begutachtet das Kabel. Als er verschmiertes Bremsöl entdeckt, gibt er sich zufrieden. Doch meine Enttäuschung sitzt tief, und ich beschließe, in meine Hütte zu gehen. Die sollen selber sehen, wie sie zurechtkommen, schließlich ist James jetzt auch da. Mama und Saguna begrüße ich flüchtig, dann ziehe ich mich zurück und weine vor Erschöpfung und Enttäuschung.
Gegen Abend beginne ich zu frieren. Ich messe dem keine große Bedeutung bei und koche Chai. Lketinga kommt und nimmt sich Tee. Wir reden nicht viel. Spät abends bricht er auf, um einen weit entfernten Kral zu besuchen und die restlichen Ziegen von der Hochzeit abzuholen. In etwa zwei Tagen sei er zurück. Er wickelt seine rote Decke um die Schultern, schnappt seine beiden Speere und verläßt ohne große Worte die Manyatta. Ich höre ihn kurz mit Mama sprechen, dann ist alles ruhig bis auf Babygeschrei in einer benachbarten Hütte.
Mein Zustand verschlechtert sich. In der Nacht packt mich die Angst. Ist das vielleicht wieder eine Malaria-Attacke? Ich krame meine Fansidar-Tabletten hervor und lese alles genau durch. Drei Tabletten auf einmal bei Verdacht, doch bei Schwangerschaft einen Arzt aufsuchen. O Gott, auf keinen Fall will ich mein Baby verlieren, was bei Malaria bis zum sechsten Monat al erdings leicht passieren kann.
Ich entschließe mich, die drei Tabletten zu nehmen, und lege Holz ins Feuer, damit mir etwas wärmer wird.
Am Morgen erwache ich erst, als ich draußen Stimmen höre. Ich krieche aus der Hütte, und das volle Sonnenlicht blendet mich. Es ist fast halb neun. Mama sitzt vor ihrer Hütte und schaut mich lachend an. „Supa Corinne“, ertönt es aus ihrer Richtung. „Supa Mama“, gebe ich zurück und marschiere in den Busch, um meine Notdurft zu verrichten.
Ich fühle mich schlapp und ausgelaugt. Als ich zurück zur Manyatta komme, stehen schon vier Frauen da und fragen nach dem Shop. „Corinne, tuka“, höre ich Mama rufen, ich soll den Laden öffnen. – ’„Ndjo, ja, later!“ gebe ich zur Antwort.
Verständlicherweise wollen alle den Zucker haben, den ich gestern gebracht habe.
Eine halbe Stunde später schleppe ich mich zum Shop.
Es warten sicher zwanzig Personen, doch Anna ist nicht dabei. Ich öffne, und sofort geht das Geschnatter los. Jede wil die erste sein. Ich bediene mechanisch.
Wo bleibt Anna? Mein Helfer läßt sich ebenfal s nicht blicken, und wo die Burschen sind, weiß ich auch nicht. Während des Bedienens spüre ich einen heftigen Drang zur Toilette. Ich greife zum Toilettenpapier und stürme zum WC-Häuschen. Ich habe bereits Durchfall. Nun bin ich total im Streß. Der Laden ist voller Menschen. Die Kasse ist eine offene Schachtel und für jeden, der hinter die Theke kommt, zugänglich. Kraftlos kehre ich zu den schwatzenden Frauen zurück. Der Durchfal zwingt mich mehrmals auf die Toilette.
Anna hat mich im Stich gelassen, sie ist nicht gekommen. Bisher ist nicht ein bekanntes Gesicht aufgetaucht, dem ich nur halbwegs meine Situation auf Englisch erklären und um Hilfe bitten kann. Nach dem Mittag kann ich mich kaum mehr auf den Beinen halten.
Endlich erscheint die Frau des Lehrers. Ich schicke sie zu Mama, um nachzuschauen, ob die Burschen zu Hause sind. Zum Glück erscheint James mit jenem Burschen, der damals in meinem Lodging übernachtet hatte. Sie sind sofort bereit, den Laden zu führen, damit ich nach Hause kann. Mama schaut mich überrascht an und fragt, was los sei. Doch wie soll ich ihr antworten? Ich zucke mit den Schultern und sage: „Maybe Malaria.“
Sie schaut mich erschrocken an und faßt sich an den Bauch. Ich verstehe die Bedeutung, bin aber selbst ratlos und traurig. Sie kommt in meine Manyatta und kocht für mich schwarzen Tee, denn Milch sei nicht gut. Während sie auf das kochende Wasser wartet, spricht sie unaufhörlich zu Enkai. Mama betet für mich auf ihre Weise. Ich habe sie wirklich sehr gern, wie sie so dasitzt, mit ihren langen Brüsten und dem schmutzigen Rock. In diesem Moment bin ich froh, daß mein Mann eine so liebe, fürsorgliche Mutter hat, und möchte sie nicht enttäuschen.
Als unsere Ziegen nach Hause kommen, schaut der ältere Bruder besorgt zu mir herein und versucht, auf Suaheli eine Unterhaltung zu beginnen. Doch ich bin zu müde und schlafe dauernd ein. Mitten in der Nacht erwache ich schweißgebadet, als ich Schritte und das Einstecken von Speeren neben unserer Hütte vernehme. Mein Herz klopft wild, als das bekannte Grunzgeräusch ertönt und kurz darauf eine Gestalt in der Hütte erscheint. Es ist so dunkel, daß ich nichts erkenne. „Darling?“ frage ich hoffnungsvoll in die Dunkelheit. „Yes, Corinne, no problem“, ertönt die vertraute Stimme meines Mannes. Ein Stein fällt mir vom Herzen.
Ich erkläre meinen Zustand, und er ist sehr besorgt. Da ich bis jetzt keinen Schüttelfrost hatte, habe ich immer noch die Hoffnung, daß sich durch die sofortige Einnahme von Fansidar mein Zustand normalisiert. Die folgenden Tage bleibe ich zu Hause, und Lketinga und die Boys betreiben den Laden. Langsam erhole ich mich, da auch der Durchfall nach drei Tagen ein Ende hat. Nach einer Woche Herumliegen habe ich es satt und gehe nachmittags arbeiten. Doch der Laden sieht schlimm aus.
Es wurde kaum geputzt, und al es ist voller Maismehlstaub. Die Regale sind fast leer.
Die vier Zuckersäcke sind längst verkauft, und Mais gibt es gerade noch anderthalb Säcke. Das heißt, wir müssen wieder eine Fahrt nach Maralal starten. Wir planen sie in der folgenden Woche, da für die Jungen die kurzen Ferien ohnehin dann zu Ende sind und ich einige von ihnen gut nach Maralal mitnehmen kann.
Im Shop ist es ruhig. Sobald die Grundnahrungsmittel fehlen, bleiben die Kunden von weit her aus. Ich gehe Anna besuchen. Als ich zu ihrem Häuschen komme, liegt sie auf ihrem Bett. Auf die Frage, was mit ihr los sei, will sie zuerst keine Antwort geben. Mit der Zeit kriege ich heraus, daß auch sie schwanger ist. Sie sei erst im dritten Monat, hatte aber vor kurzem Blutungen und ist deswegen von der Arbeit ferngeblieben. Wir vereinbaren, daß sie wiederkommt, wenn die Burschen weg sind.
Der Schulbeginn rückt näher, und wir brechen auf. Diesmal bleibt der Laden geschlossen. Nach drei Tagen können wir den vollen Lastwagen nach Barsaloi losschicken, unser Helfer begleitet ihn. Lketinga fährt mit mir durch den Dschungel.
Glücklicherweise verläuft die Fahrt problemlos. Wir erwarten den Laster kurz vor Dunkelheit. Doch statt des Lasters kommen zwei Krieger und erzählen uns, der Lori stecke im letzten Flußbett fest. Wir fahren mit unserem Wagen die kurze Strecke und sehen uns die Bescherung an. In dem ausgetrockneten, breiten Fluß ist er kurz vor dem Ufer mit dem linken Rad im Sand abgesackt. Durch das lange Spulen hat es sich in den lockeren Sand gegraben.
Es stehen schon einige Leute am Ort der Misere, und zum Teil wurden bereits Steine und Äste untergelegt. Der Laster neigt sich durch das hohe Gewicht immer schräger, und der Fahrer erklärt, es nütze alles nichts mehr, es müsse hier abgeladen werden. Ich bin nicht sehr erfreut über diesen Vorschlag und möchte Pater Giuliano um Rat fragen. Giuliano ist nicht gerade begeistert bei meinem Auftauchen, da er bereits weiß, was geschehen ist. Dennoch steigt er in seinen Wagen und kommt mit.
Er probiert es mit einer Seilwinde, aber unsere Vierrad-Wagen schaffen es nicht, den Laster herauszumanövrieren. Nun müssen die hundert Doppelzentner-Säcke in unsere Wagen umgeladen werden. Wir können jeweils acht Säcke laden. Fünfmal fährt Giuliano, dann kehrt er genervt in die Mission zurück. Ich fahre noch siebenmal, bis wir al es im Shop haben. Indessen ist es Nacht geworden, und ich bin am Ende meiner Kräfte. Im Shop herrscht ein unvorstel bares Durcheinander, doch wir machen Feierabend und räumen erst am nächsten Morgen die Waren ein.
Häufig werden uns Ziegen– oder Kuhfel e zum Ankauf angeboten. Bis jetzt habe ich stets abgelehnt, aber die Frauen sind nicht zufrieden damit und verlassen zum Teil schimpfend den Laden, um die Felle bei den Somalis loszuwerden. Allerdings kaufen die Somalis seit kurzem die Felle nur von denen, die Mais oder Zucker bei ihnen beziehen. So entstehen täglich neue Diskussionen. Deshalb beschließe ich, ebenfal s Häute anzukaufen und lagere sie im hinteren Teil unseres Shops.
Keine zwei Tage vergehen, bis uns der schlaue Mini-Chief besucht und nach der Lizenz für den Handel mit Tierhäuten fragt. Natürlich haben wir keine, weil ich von deren Notwendigkeit nichts wußte. Und außerdem, meint er, könne er mir den Shop schließen, weil es nicht erlaubt sei, die Häute im selben Gebäude zu lagern wie die Lebensmittel. Es müßten mindestens fünfzig Meter Abstand dazwischen sein. Mir verschlägt es bei dieser Neuigkeit die Sprache, da die Somalis bisher ihre Häute ebenfal s im selben Raum hatten, was der Chief einfach bestreitet. Jetzt weiß ich auch, wer ihn auf uns gehetzt hat. Da ich mittlerweile fast achtzig Häute habe, die ich beim nächsten Mal in Maralal weiterverkaufen wil, muß ich Zeit gewinnen, um einen neuen abschließbaren Ort zu finden. Ich biete dem Chief zwei Sodas an und bitte ihn, mir bis morgen Zeit zu geben.
Nach längerem Hin und Her mit meinem Mann einigen sie sich, daß wir die Häute bis zum nächsten Tag aus dem Shop gebracht haben. Doch wohin damit? Immerhin sind die Fel e Bargeld. Ich gehe zur Mission, um Rat zu holen. Nur Roberto ist da und meint, er habe auch keinen Platz. Wir müssen auf Giuliano warten. Am Abend kommt er mit dem Motorrad vorbei. Zu meiner Freude bietet er mir sein altes Wasserpumpenhäuschen in der Nähe an, wo alte Maschinen gelagert sind. Es sei nicht viel Platz, aber besser als nichts, denn man könne es mit einem Schloß abschließen. Wieder habe ich ein Problem gelöst, und langsam wird mir klar, welch große Hilfe Pater Giuliano für uns ist.
Der Laden läuft gut, und Anna erscheint pünktlich. Es geht ihr wieder besser. An einem normalen Nachmittag herrscht plötzlich eine Riesenaufregung. Der Nachbarsjunge stürmt in den Shop und diskutiert aufgeregt mit Lketinga. „Darling, what happened?“
frage ich. Er antwortet, daß zwei Ziegen unserer Herde verlorengegangen sind und er sofort aufbrechen muß, um sie zu suchen, bevor es dunkel wird und die wilden Tiere sie erwischen. Gerade will er mit seinen beiden langen Speeren bewaffnet los, als das Hausmädchen des Buschlehrers mit bleichem Gesicht im Laden erscheint.
Auch sie spricht mit Lketinga, und ich verstehe nur, daß es um unseren Wagen und Maralal geht. Beunruhigt frage ich Anna: „Anna, what's the problem?“
Zögernd erzählt sie, daß die Frau des Lehrers zu Hause ein Kind erwartet, sie müsse sofort ins Spital, aber bei der Mission sei niemand da.
Die Frau des Lehrers
Darling, we have to go with her to Maralal“,
sage ich aufgeregt zu meinem Mann. Er meint jedoch, das sei nicht seine Aufgabe, er müsse seine Ziegen suchen. In diesem Moment verstehe ich ihn überhaupt nicht und frage wütend, ob ihm ein Menschenleben nicht mehr wert sei als das eines Tieres. Er sieht das nicht ein, es sei schließlich nicht seine Frau, aber seine Ziegen wären spätestens in zwei Stunden aufgefressen, und damit verläßt er den Shop. Ich bin sprachlos und verzweifelt, daß ausgerechnet mein gutmütiger Mann so kaltherzig sein kann.
Anna teile ich mit, daß ich mir die Frau ansehen und dann entscheiden werde. Ihre Blockhütte liegt zwei Minuten vom Shop entfernt. Beim Betreten der Hütte trifft mich fast der Schlag. Überal liegen blutdurchtränkte Tücher. Die junge Frau liegt zusammengekauert auf dem nackten Fußboden und stöhnt laut. Ich spreche sie an, da ich vom Laden her weiß, daß sie Englisch spricht. Stockend erzählt sie mir, die Blutungen hätten schon vor zwei Tagen begonnen, aber wegen ihres Mannes durfte sie nicht zum Arzt gehen. Er sei sehr eifersüchtig und deswegen gegen eine Untersuchung. Jetzt, nachdem er weggegangen sei, wil sie fort.
Sie schaut mich zum erstenmal an, und ich sehe blanke Angst in ihren Augen.
„Please, Corinne, help me, I am dying!“
Dabei hebt sie ihr Kleid hoch, und ich sehe ein kleines, blaues Armchen aus der Scheide hervorhängen. Mit aller Kraft reiße ich mich zusammen und verspreche, sofort den Landrover von zu Hause zu holen. Ich stürze aus dem Haus zum Shop und sage Anna, daß ich sofort nach Maralal fahre, sie soll den Shop schließen, falls mein Mann bis 19 Uhr nicht zurück ist.
Den Weg zur Manyatta renne ich und spüre kaum, wie mir die Dornenbüsche die Beine zerkratzen. Tränen des Entsetzens und auch der Wut auf meinen Mann laufen mir über das Gesicht. Wenn wir nur Maralal noch rechtzeitig erreichen! Zu Hause steht Mama da und versteht nicht, warum ich al e Wolldecken und sogar unser Fel aus der Manyatta reiße und im Landrover hinten ausbreite. Ich habe keine Zeit, ihr die Geschichte zu erklären. Hier geht es um Minuten. Ich kann kaum klar denken, als ich mit dem Wagen losbrause. Ein Blick auf die Mission bestätigt mir, daß niemand da ist, weil beide Fahrzeuge fehlen. Bei der Blockhütte halte ich an, um zusammen mit dem Mädchen der Frau in den Wagen zu helfen.
Es ist schwer, da sie nicht mehr stehen kann. Wir legen sie vorsichtig auf die beiden Decken, die nur gegen das kalte Blech Schutz geben und keinesfalls genügen werden, um die großen Schläge zu dämpfen. Das Mädchen steigt ebenfal s ein, und wir fahren los. Beim „Arzthäuschen“ halte ich an, um zu schauen, ob der Doktor viel eicht mitkommt. Aber auch er ist nicht da! Wo sind nur alle, wenn man sie einmal braucht? Statt dessen ist ein Fremder aus Maralal dort und wil mitfahren. Er ist kein Samburu.
Es geht um Leben und Tod, und trotzdem kann ich nicht so schnel fahren, da die Frau sonst hinten im Wagen herumrol t. Bei jedem Schlag schreit sie laut auf. Das Mädchen spricht leise auf sie ein, während sie den Kopf auf ihrem Schoß festhält.
Schweißgebadet muß ich mir die Tränen aus den Augen wischen. Aus Eifersucht läßt dieser Lehrer seine Frau verrecken! Er, der jeden Sonntag in der Kirche die Messe übersetzt, er, der schreiben und lesen kann. Ich könnte es kaum glauben, hätte ich nicht selbst die Reaktion meines Mannes erlebt. Bei ihm zählt offensichtlich ein Frauenleben weniger als das einer Ziege. Wäre ein Krieger in Not, wie der, den wir einen Monat in unserer Hütte hatten, Lketinga würde wahrscheinlich anders reagieren. Jetzt geht es jedoch nur um eine Frau, die nicht mal seine ist. Was geschieht, wenn bei mir Komplikationen auftreten?.
All diese Überlegungen schießen mir durch den Kopf, während der Wagen langsam vorwärtskommt. Die Frau verliert immer wieder für kurze Momente das Bewußtsein, und das Stöhnen hört auf. Wir sind nun bei den Felsen angelangt, und mir wird übel, wenn ich daran denke, wie es nun den Wagen hin– und herschütteln wird. Hier nützt alles langsame Fahren nichts mehr. Zum Hausmädchen sage ich, es soll die Frau halten, so gut es geht. Der Mann neben mir hat noch kein Wort von sich gegeben. Der Wagen klettert im Vierrad über die großen Felsbrocken. Die Frau schreit entsetzlich. Als wir es geschafft haben, wird sie augenblicklich wieder ruhig.
Ich fahre so schnell wie möglich durch den Dschungel. Kurz vor dem Todeshang muß ich bergauf den Vierrad einschalten. Der Wagen schleicht den Berg hinauf. In der Mitte des Hangs stottert plötzlich der Motor. Ich schaue sofort auf die Benzinuhr und bin beruhigt. Er kriecht normal weiter, doch dann stottert er wieder. Der Wagen ruckt und rumpelt gerade noch auf die Anhöhe, um dann völlig still zu stehen, direkt neben dem Plateau, auf dem ich schon einmal festsaß.
Verzweifelt versuche ich, den Motor erneut zu starten. Doch es rührt sich nichts.
Nun wird der Mann neben mir munter. Wir steigen aus und begutachten den Motor.
Alle Zündkerzen nehme ich heraus, doch sie sind in Ordnung.
Die Batterie ist aufgefüllt. Wo ist das Problem von diesem verdammten Wagen?
Ich schüttle al e Kabel, schaue unter den Wagen, doch ich kann die Ursache nicht finden. Wieder und wieder probiere ich es, doch nichts geht mehr. Nicht einmal das Licht funktioniert.
Mittlerweile wird es dunkel, und die Riesenbremsen fressen uns fast auf. Ich bekomme nun wirklich Angst. Hinten im Wagen stöhnt die Frau. Die Wolldecken sind voller Blut. Ich erkläre dem Fremden, daß wir hier verloren sind, weil diese Straße fast nicht benützt wird. Es bleibt nur die Möglichkeit, daß er in Maralal Hilfe holt. Zu Fuß schafft er es in anderthalb Stunden. Er weigert sich, ohne Waffe al ein loszugehen. Nun drehe ich völlig durch und beschimpfe ihn wütend, weil er nicht begreift, daß es so oder so sehr gefährlich ist, und je länger er wartet, desto dunkler und kälter wird es. Wir haben nur eine Chance, wenn er jetzt aufbricht. Endlich macht er sich auf den Weg. Frühestens in zwei Stunden werden wir Hilfe haben. Ich öffne den Wagen hinten und versuche, mit der Frau zu sprechen. Aber sie ist wieder für kurze Zeit bewußtlos. Es wird kalt, und ich ziehe meine Jacke an. Nun erwacht sie und verlangt nach Wasser. Sie hat großen Durst, ihre Lippen sind völlig aufgesprungen. Mein Gott! In der Hetze habe ich wieder einmal einen Riesenfehler gemacht. Wir sind ohne Trinkwasser! Ich durchsuche den ganzen Wagen, finde eine leere Colaflasche und mache mich auf den Weg, Wasser zu suchen. Es muß doch hier Wasser geben, so grün wie alles ist! Nach hundert Metern höre ich das Plätschern von Wasser, doch sehen kann ich im Dickicht nichts. Vorsichtig wage ich mich Schritt für Schritt ins Gebüsch. Nach zwei Metern fällt der Hang steil ab. Unten ist ein kleines Bächlein, das ich jedoch nicht erreichen kann, denn die glitschige Felswand käme ich nicht mehr hoch. Ich renne zum Wagen zurück und nehme das Seil von den Benzinfässern mit. Die Frau heult wie verrückt vor Schmerzen. Ich schneide ein Ende des Seils ein und binde die Flasche daran, um sie zum Wasser herunterzulassen. Unendlich langsam füllt sie sich. Als ich kurz darauf der Frau die Flasche an den Mund halte, merke ich, daß sie vor Hitze glüht. Gleichzeitig friert sie so, daß ihre Zähne klappern. Sie trinkt die ganze Flasche leer. Noch mal hole ich Wasser.
Zurück beim Wagen höre ich ein Schreien, wie ich es noch nie vernommen habe.
Das Mädchen hält die Frau fest und weint. Sie ist ja noch so jung, vielleicht 13 oder 14 Jahre alt. Ich schaue in das Gesicht der Frau, und ihr Blick verrät Todesangst.
„Ich sterbe, ich sterbe, Enkai!“ stammelt sie. „Please Corinne, help me!“
fleht sie wieder. Was soll ich nur machen? Ich war noch nie bei einer Geburt dabei, sondern bin selbst das erste Mal schwanger. „Please, take out this child, please, Corinne!“
Ich halte das Kleid hoch und sehe wieder das gleiche Bild. Das blau-violette Ärmchen hängt nun bis zur Schulter heraus.
Dieses Kind ist tot, geht es mir durch den Kopf. Es hat Seitenlage und kann ohne Kaiserschnitt gar nicht auf die Welt kommen. Unter Tränen erkläre ich ihr, daß ich nicht helfen kann, aber mit etwas Glück kommt in etwa einer Stunde Hilfe. Ich ziehe meine Jacke aus und lege sie über die zitternde Gestalt. Mein Gott, warum läßt du uns so allein? Was habe ich falsch gemacht, daß dieser Wagen uns ausgerechnet heute wieder im Stich läßt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich kann die gellenden Schreie kaum aushalten und laufe kopflos und verzweifelt in den dunklen Busch, kehre aber sofort wieder zum Auto zurück.
Die Frau verlangt in ihrer Todesangst mein Messer. Fieberhaft überlege ich, was ich machen soll, dann entscheide ich mich, es ihr nicht auszuhändigen. Plötzlich erhebt sie sich von der Decke und geht in die Hocke. Das Mädchen und ich starren entsetzt auf die mit dem Tod kämpfende Frau. Sie faßt mit beiden Händen in ihre Scheide und würgt und dreht an dem Arm, bis nach einiger Zeit ein blauviolettes, unterentwickeltes Kind auf der Wol decke liegt. Gleichzeitig fällt sie erschöpft zurück und bleibt völlig starr liegen. Ich fasse mich als erste und wickle das blutige, tote, etwa siebenmonatige Kind in einen Kanga. Dann flöße ich der Frau wieder Wasser ein. Sie zittert am ganzen Leib, doch strahlt sie nun völlige Ruhe aus. Ich versuche, ihr die Hände zu reinigen und spreche beruhigend auf sie ein. Dabei lausche ich angestrengt in den Busch. Nach einer Weile höre ich ein leises Motorengeräusch.
Ein Stein der Erleichterung fällt mir vom Herzen, als ich kurz darauf Scheinwerferlicht durch das Gebüsch erblicke. Ich halte meine Taschenlampe in die Höhe, damit sie uns rechtzeitig sehen. Es ist der Sanitäts-Rover vom Spital. Drei Männer steigen aus. Ich erkläre ihnen, was geschehen ist, und sie laden die Frau auf einer Bahre in ihr Auto, ebenso das Bündel mit dem toten Baby. Auch das Mädchen fährt mit. Der Fahrer des Rover schaut sich meinen Wagen an. Er dreht den Zündschlüssel und weiß sofort, was fehlt. Er zeigt mir ein Kabel, das hinter dem Steuerrad herunterhängt. Das Zündkabel ist herausgerissen. In nur einer Minute hat er es wieder befestigt, und der Wagen springt an. Während die anderen nach Maralal zurückfahren, begebe ich mich in die andere Richtung nach Hause. Völ ig erschöpft und verstört erreiche ich unsere Manyatta. Mein Mann will wissen, warum ich erst so spät zurückgekommen bin. Ich versuche zu erzählen und merke, daß er mir nicht glaubt. Verzweifelt über seine Reaktion begreife ich nicht, warum er mir so wenig Vertrauen entgegenbringt. Schließlich kann ich nichts dafür, daß der Wagen immer schlapp macht, wenn er nicht dabei ist. Ich lege mich schlafen und lasse mich auf keine weitere Diskussion ein.
Am nächsten Tag gehe ich lustlos arbeiten. Kaum habe ich geöffnet, erscheint der Lehrer und bedankt sich überschwenglich für meine Hilfe, fragt dabei aber nicht einmal, wie es seiner Frau ergangen ist. So ein Heuchler!
Etwas später kommt Pater Giuliano und läßt sich von mir berichten. Ihm tut es leid, was wir durchmachen mußten, und es ist für mich kein Trost, daß er mir die Fahrt großzügig entschädigt. Der Frau gehe es der Situation entsprechend gut, was er über Radiocall erfahren habe.
Der Streß im Laden nimmt mich mehr mit, als ich wahrhaben will. Seit diesem Erlebnis schlafe ich schlecht und träume in Hinblick auf meine Schwangerschaft nur schreckliche Dinge. Am dritten Morgen nach dem Ereignis bin ich so zerschlagen, daß ich Lketinga allein in den Shop schicke. Er soll mit Anna arbeiten. Ich sitze zu Hause mit Mama unter dem großen Baum. Nachmittags kommt der Arzt vorbei und erzählt mir, die Lehrersfrau sei über dem Berg, müsse aber noch ein paar Wochen in Maralal bleiben.
Wir unterhalten uns über das Geschehen, und er versucht, mein Gewissen zu beruhigen, indem er sagt, es sei nur so gekommen, weil sie dieses Kind gar nicht haben wollte. Sie hätte mit ihrer mentalen Kraft den Wagen zum Stillstand gebracht.
Zum Abschied fragt er mich, was mit mir los sei. Ich erwähne meinen schlappen Zustand, den ich den letzten Aufregungen zuschreibe. Besorgt warnt er mich vor einer eventuel en Malaria, weil meine Augen einen gelben Stich haben.
Angst um mein Kind
Abends wird bei uns ein Schaf geschlachtet. Noch nie hatte ich hier Schaffleisch, deshalb bin ich richtig neugierig. Mama bereitet unseren Anteil zu. Sie kocht mehrere Stücke einfach in Wasser. Tassenweise trinken wir den fetten, aber faden Sud.
Mama meint, das sei gut, wenn man schwanger ist und kräftiger werden muß.
Offensichtlich vertrage ich es nicht, denn in der Nacht bekomme ich Durchfall.
Gerade noch kann ich meinen Mann wecken, der mir hilft, das Tor vom Dornengestrüpp zu öffnen, dann schaffe ich keine zwanzig Meter mehr.
Der Durchfall nimmt kein Ende. Ich schleppe mich zurück zu unserer Manyatta, und Lketinga ist ernsthaft besorgt um mich und unser Kind. Am frühen Morgen erlebe ich das gleiche und muß anschließend erbrechen. Mich fröstelt trotz der enormen Hitze. Nun bemerke ich auch meine gelben Augen und schicke Lketinga zur Mission.
Ich habe Angst wegen des Kindes, denn ich bin sicher, daß das der Anfang der nächsten Malaria ist. Es dauert keine zehn Minuten, bis ich den Missionswagen höre und Pater Giuliano unsere Hütte betritt. Als er mich sieht, fragt er, was passiert ist.
Zum ersten Mal erzähle ich ihm, daß ich im fünften Monat schwanger bin. Er ist überrascht, weil er nichts davon bemerkt hatte. Sofort schlägt er vor, mich nach Wamba ins Missionsspital zu bringen, da ich sonst viel eicht das Kind durch eine Frühgeburt verlieren könnte. Ich packe gerade noch ein paar Sachen, dann fahren wir. Lketinga bleibt zurück, weil wir ja den Shop geöffnet haben.
Pater Giuliano besitzt einen Wagen, der komfortabler als meiner ist. Er fährt halsbrecherisch, doch er kennt die Straße sehr gut. Trotzdem habe ich Mühe, mich festzuhalten, weil ich mit einer Hand meinen Bauch stütze. Gesprochen wird nicht viel auf der knapp dreistündigen Fahrt zum Missionsspital. Wir werden von zwei weißen Schwestern erwartet. Von ihnen gestützt werde ich in ein Untersuchungszimmer geführt, wo ich mich auf ein Bett legen kann. Ich staune über die Sauberkeit und Ordnung. Dennoch erfaßt mich, so hilflos auf dem Bett liegend, eine tiefe Traurigkeit. Als Giuliano hereinkommt, um sich zu verabschieden, schießen mir die Tränen aus den Augen. Erschrocken fragt er, was los ist. Ich weiß es ja selbst nicht! Ich habe Angst um mein Kind. Außerdem habe ich meinen Mann mit dem Shop al ein gelassen. Er versucht, mich zu beruhigen und verspricht, jeden Tag nach dem Rechten zu sehen und über Radiocal der Schwester die Neuigkeiten durchzugeben. Bei all dem Verständnis, das er mir entgegenbringt, heule ich wieder los.
Er holt eine Schwester, und ich bekomme eine Spritze. Dann erscheint der Arzt, der mich untersucht. Als er hört, in welchem Monat ich schwanger bin, äußert er besorgt, ich sei viel zu dünn und habe zu wenig Blut. Das Kind sei deshalb viel zu klein. Dann folgt die Diagnose: Malaria im Anfangsstadium.
Ängstlich frage ich, welche Folgen das für mein Kind hat. Er winkt ab und meint, erst müsse ich mich erholen, dann passiert auch dem Kind nichts mehr. Wäre ich später gekommen, hätte der Körper infolge Blutarmut die frühzeitige Geburt selber eingeleitet. Aber es besteht gute Hoffnung, auf jeden Fall lebt das Kind. Bei diesen Worten bin ich so glücklich, daß ich al es daran setzen wil, so schnell wie möglich gesund zu werden. Ich werde in der Geburten-Abteilung in einem Vierbett-Zimmer einquartiert.
Draußen blühen rote Blumenbüsche, al es ist anders als in Maralal. Ich bin froh, so schnel gehandelt zu haben. Die Schwester kommt und erklärt mir, ich werde täglich zwei Spritzen bekommen und gleichzeitig eine Infusion mit Kochsalzlösung. Dies sei dringend nötig, sonst trockne der Körper aus. So ist also Malaria zu behandeln, und ich begreife, wie knapp ich in Maralal mit dem Leben davongekommen bin. Die Schwestern kümmern sich rührend um mich. Am dritten Tag bin ich endlich von der Infusion befreit. Die Spritzen muß ich allerdings zwei weitere Tage über mich ergehen lassen.
Im Geschäft sei al es bestens, höre ich von den Schwestern. Ich fühle mich wie neu geboren und kann es nicht erwarten, endlich nach Hause zu meinem Mann zu kommen. Am siebten Tag erscheint er mit zwei Kriegern. Ich freue mich sehr, wundere mich aber trotzdem, wieso er das Geschäft verlassen hat. „No problem, Corinne, my brother is there!“








