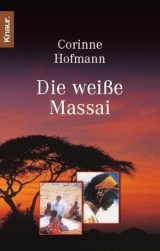
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Ausweglosigkeit
Plötzlich kommt mein Mann mit Napirai daher. Ich verstehe nicht, was das sol, denn ich habe ja den Wagen, und unser Shop ist immerhin einige Kilometer entfernt.
Er schaut auf seine Uhr und herrscht mich an, wo ich so lange bleibe. Möglichst gelassen erwidere ich, er sehe ja, daß ich erst jetzt fertig werde. Er setzt mir die völ ig verschwitzte Napirai auf den Schoß. Ihre Hosen sind vol. Ärgerlich frage ich, was er hier mit ihr zu suchen habe und wo unser Kindermädchen sei. Er hat sie und Wil iam nach Hause geschickt und den Shop einfach geschlossen. Er sei ja nicht verrückt und wisse, daß ich mich mit jemandem verabredet habe, sonst wäre ich schon längst wieder erschienen. Alle Einwendungen nützen nichts, Lketinga ist krank vor Eifersucht. Er ist überzeugt, daß ich vor dem Friseur ein Treffen mit einem anderen Krieger hatte.
So schnell wie möglich wil ich die Hotelanlage verlassen, und wir fahren direkt nach Hause. Die Lust am Arbeiten ist mir vergangen. Es wil mir nicht in den Kopf, daß ich keine dreieinhalb Stunden allein zum Friseur gehen kann, ohne daß mein Mann völ ig durchdreht. So kann es nicht mehr weitergehen. Voller Zorn und Haß schlage ich meinem Mann vor, er solle nach Hause fahren und eine zweite Frau heiraten. Finanziel werde ich ihn unterstützen. Aber er sol gehen, damit wir alle zur Ruhe kommen. Ich habe keinen anderen Lover und wil auch keinen. Ich will nur arbeiten und in Frieden leben. Er kann auch in zwei oder drei Monaten wiederkommen, und wir sehen weiter.
Doch meine Argumente erreichen Lketinga nicht. Er wolle keine andere Frau, denn er liebe nur mich. Er möchte, daß es wieder wie früher ist, bevor Napirai zur Welt kam. Daß er al es mit seiner verdammten Eifersucht zerstört hat, begreift er einfach nicht. Ich kann nur noch atmen, wenn er fort ist. Wir streiten, und ich heule und weiß keinen Ausweg mehr. Nicht einmal die Kraft, Napirai zu trösten, habe ich, da ich selbst so im Elend bin. Wie eine Gefangene komme ich mir vor. Ich muß mit jemandem sprechen.
Sophia wird mich verstehen! Schlimmer kann es nicht mehr kommen, und so steige ich in den Wagen und lasse Mann und Kind zurück. Er stellt sich mir in den Weg, doch ich brause einfach los. „You are crazy, Corinne!“
ist alles, was ich noch höre.
Sophia ist völlig vor den Kopf gestoßen, als sie mich sieht. Sie dachte, alles sei bestens, weil ich so lange nicht mehr vorbeigekommen bin. Als ich ihr das ganze Ausmaß erzähle, ist sie geschockt. In meiner Verzweiflung sage ich ihr, daß ich vielleicht zurück in die Schweiz gehe, weil ich Angst habe, es passiere eines Tages noch Schlimmeres. Sophia redet mir zu, jetzt, wo das Geschäft so gut geht und ich die Arbeitsbewilligung habe, solle ich mich zusammenreißen. Vielleicht geht Lketinga ja doch nach Hause, weil er sich in Mombasa nicht wohl fühlt. Wir besprechen vieles, doch innerlich bin ich ausgebrannt. Ich frage, ob sie Marihuana hat. Tatsächlich bekomme ich welches von ihrem Freund. Etwas erleichtert fahre ich zurück und bin schon auf den nächsten Krach gefaßt. Aber mein Mann liegt vor dem Haus und spielt mit Napirai. Er sagt keinen Ton. Ja, er wil nicht einmal wissen, wo ich war. Das ist völlig neu.
Im Zimmer drehe ich hastig einen Joint und rauche ihn. Nun geht es mir besser, und al es scheint leichter ertragbar zu sein. Heiter setze ich mich draußen hin und schaue meiner Tochter amüsiert zu, wie sie immer wieder versucht, auf einen Baum zu steigen. Als mein Kopf wieder klarer wird, kaufe ich Reis und Kartoffeln, um das Abendessen zu kochen. Der Joint verursacht ein großes Hungergefühl. Später bade ich Napirai wie gewöhnlich im Waschbecken, bevor auch ich mich in die
„Buschdusche“ zurückziehe. Die Windeln weiche ich wie immer über Nacht ein, damit ich sie morgens vor der Arbeit waschen kann. Dann gehe ich ins Bett. Mein Mann fährt Krieger zu einer Tanzaufführung.
Die Tage streichen dahin, und ich freue mich jeden Abend auf den Joint. Im Intimen läuft nun mehr, nicht weil ich Freude daran habe, sondern weil es mir gleichgültig ist. Ich lebe leer vor mich hin. Mechanisch öffne ich den Shop und verkaufe zusammen mit Wil iam, der immer unregelmäßiger erscheint, die Ware.
Dafür ist Lketinga nun fast den ganzen Tag im Shop. Die Touristen erscheinen mit Kameras und Videos, und bald sind wir auf vielen Filmstreifen festgehalten. Mein Mann verlangt nach wie vor Geld, was mich nicht mehr aufregt. Er versteht nicht, warum die Leute uns fotografieren wol en und sagt zu Recht, wir seien doch keine Affen.
Immer wieder fragen die Touristen, wo unsere Tochter ist, da sie annehmen, Napirai, die mit dem Kindermädchen spielt, gehöre zu ihr. Ich muß al en erklären, daß das mittlerweile sechzehnmonatige Kind unsere Napirai ist. Zusammen mit dem Kindermädchen lachen wir über die falsche Annahme, bis mein Mann sich schließlich Gedanken macht, wieso alle Leute dasselbe vermuten. Ich versuche, ihn zu beschwichtigen, die Verwechslungen könnten uns doch egal sein. Dennoch bohrt er bei den irritierten Kunden weiter, warum sie mich nicht gleich als Mutter erkennen, so daß einige erschrocken unser Geschäft wieder verlassen. Auch dem Mädchen gegenüber verhält er sich mißtrauisch.
Meine Schwester ist seit fast einem Monat zu Hause. Edy erscheint ab und zu, um nach Briefen von ihr zu fragen, was Lketinga mit der Zeit ganz anders sieht. Seiner Ansicht nach kommt Edy natürlich meinetwegen, und eines Tages ertappt er mich dabei, wie ich Edy Marihuana abkaufe. Er beschimpft mich wie eine Schwerverbrecherin und droht, mich bei der Polizei anzuzeigen.
Mein eigener Mann will mich ins Gefängnis bringen, obwohl er weiß, wie elend es dort zugeht! In Kenia sind die Bestimmungen über Drogen sehr streng. Mit Müh und Not kann Edy ihn davon abbringen, nach Ukunda zur Polizei zu fahren. Ich stehe fassungslos da und kann nicht einmal weinen. Schließlich brauche ich dieses Zeug, um ihn ertragen zu können. Ich muß ihm versprechen, nie mehr Marihuana zu rauchen, sonst zeigt er mich an. Er wil nicht mit jemandem zusammen sein, der die Gesetze in Kenia mißachtet. Miraa ist dagegen erlaubt und somit nicht dasselbe.
Mein Mann durchsucht meine Taschen und riecht an jeder Zigarette, die ich mir anzünde. Daheim erzählt er es Priscil a und jedem, der es hören wil. Alle sind natürlich entsetzt, und ich komme mir miserabel vor. Bei jedem Gang zur Toilette begleitet er mich. Zum Shop im Village darf ich schon gar nicht mehr. Ich bin nur noch in unserem Geschäft, und zu Hause hocke ich auf dem Bett. Das einzig Wichtige ist mein Kind. Napirai scheint zu spüren, daß es mir schlecht geht. Sie bleibt die meiste Zeit bei mir und plappert „Mama, Mama“ und ein paar unverständliche Worte. Priscil a hat sich von uns zurückgezogen. Sie will keinen Ärger.
Die Arbeit bereitet mir keine Freude mehr. Lketinga ist ständig um uns. Entweder im Shop oder von der China-Bar aus werde ich kontrolliert. Bis zu dreimal am Tag stel t er meine Tasche auf den Kopf. Einmal kommen wieder Schweizer Touristen.
Ich mag mich nicht groß mit ihnen unterhalten und erkläre, daß ich mich nicht wohl fühle und Magenschmerzen habe. Mein Mann kommt gerade hinzu, als eine Schweizerin Napirai bewundert und arglos die Ähnlichkeit zu dem Kindermädchen feststellt. Wieder kläre ich die Besucherin auf, als Lketinga fragt: „Corinne, why all people know, this child is not yours?“
Mit diesem Satz hat er meine letzte Hoffnung und meinen letzten Respekt vor ihm vernichtet.
Wie in Trance stehe ich auf und gehe ins Chinarestaurant hinüber, ohne auf die Fragen der anderen zu reagieren. Den Besitzer bitte ich um ein Telefongespräch. Ich lasse mich mit dem Swissair-Office in Nairobi verbinden und frage nach dem nächstmöglichen Flug für mich und mein eineinhalbjähriges Mädchen nach Zürich.
Es dauert eine Weile, bis ich die Auskunft erhalte, in vier Tagen sei noch Platz frei.
Mir ist klar, daß telefonische Buchungen von Privatpersonen nicht möglich sind, doch ich bitte die Dame eindringlich, mir die Plätze zu reservieren. Ich könne erst einen Tag vor Abflug die Tickets abholen und bezahlen. Aber es sei sehr wichtig, und ich käme auf jeden Fal. Mein Herz klopft bis zum Hals, als ich ihr „okay“ entgegennehme.
Langsam kehre ich zum Shop zurück und sage ohne Umschweife, daß ich ferienhalber in die Schweiz fliege. Lketinga lacht zuerst unsicher, um dann zu erklären, ohne Napirai könne ich gehen, so sei er sicher, daß ich wiederkomme.
Müde erwidere ich, daß mein Kind mit mir fliegt. Ich komme wieder, wie immer, aber ich brauche nach dem Shop-Streß Erholung, bevor die Hochsaison im Dezember beginnt. Lketinga ist nicht einverstanden und will mir auch keine Ausreiseerlaubnis unterschreiben. Trotzdem packe ich zwei Tage später. Priscil a und auch Sophia sprechen mit ihm. Alle sind überzeugt, ich komme wieder.
Flucht
Am letzten Tag lasse ich alles zurück. Mein Mann will, daß ich nur wenige Sachen für Napirai einpacke. Ich gebe ihm al e Kontokarten der Bank, damit er sieht, daß ich wiederkommen muß. Wer gibt schon freiwillig so viel Geld, einen Wagen und ein voll eingerichtetes Geschäft auf?
Hin– und hergerissen, ob er es glauben soll oder nicht, begleitet er Napirai und mich nach Mombasa. Kurz vor unserer Abfahrt nach Nairobi hat er immer noch nicht unterschrieben. Zum letzten Mal bitte ich ihn, denn fahren werde ich auf jeden Fall.
Ich bin innerlich so ausgebrannt, so gefühllos, daß keine Träne mehr kommt.
Der Fahrer startet den Motor. Lketinga steht neben uns im Bus und läßt sich von einem Mitreisenden zum wiederholten Mal mein beschriebenes Blatt übersetzen, auf dem zu lesen ist, daß ich die Erlaubnis meines Mannes, Lketinga Leparmorijo, habe, Kenia gemeinsam mit unserer Tochter Napirai für drei Wochen Urlaub in der Schweiz zu verlassen.
Der Busfahrer hupt zum dritten Mal. Lketinga kritzelt sein Zeichen auf das Papier und sagt: „I don't know, if I see you and Napirai again!“
Dann springt er aus dem Bus, und wir fahren los. Erst jetzt rol en meine Tränen.
Ich schaue aus dem Fenster und verabschiede mit jedem Blick die vorbeiziehenden, vertrauten Bilder.
Lieber Lketinga,
hoffentlich kannst Du mir verzeihen, was ich Dir jetzt mitteilen muß: Ich komme nicht zurück nach Kenia.
Inzwischen habe ich viel über uns nachgedacht. Vor mehr als dreieinhalb Jahren habe ich Dich so sehr geliebt, daß ich bereit war, mit Dir in Barsaloi zu leben. Ich habe Dir auch eine Tochter geschenkt. Aber seit dem Tag, an dem Du mir vorgeworfen hast, daß dieses Kind nicht von Dir ist, habe ich nicht mehr dasselbe für Dich empfunden. Auch Du hast dies bemerkt.
Nie habe ich jemanden anderen gewol t und habe Dich nie belogen. Aber in al diesen Jahren hast Du mich nie verstanden, vielleicht auch deshalb, weil ich eine
„Mzungu“ bin. Meine Welt und Deine Welt sind sehr verschieden, doch ich dachte, eines Tages stehen wir zusammen in der gleichen.
Aber jetzt, nach der letzten Chance, die wir in Mombasa hatten, sehe ich ein, daß Du nicht glücklich bist und ich erst recht nicht. Wir sind immer noch jung und können nicht so weiterleben. Im Moment wirst Du mich nicht verstehen, doch nach einiger Zeit wirst auch Du sehen, daß Du mit jemandem anderen wieder glücklich wirst. Für Dich ist es leicht, eine neue Frau zu finden, die in der gleichen Welt lebt. Aber suche jetzt eine Samburu-Frau, nicht wieder eine Weiße, wir sind zu verschieden. Du wirst eines Tages viele Kinder haben.
Ich habe Napirai mit mir genommen, denn sie ist das einzige, was mir geblieben ist. Auch weiß ich, daß ich nie mehr Kinder haben werde. Ohne Napirai könnte ich nicht überleben. Sie ist mein Leben! Bitte, bitte Lketinga, vergib mir! Ich bin nicht länger stark genug, um in Kenia zu leben. Dort war ich immer sehr al ein, hatte niemanden, und Du hast mich wie eine Verbrecherin behandelt. Du merkst es selber nicht, denn dies ist Afrika. Noch einmal sage ich Dir, ich habe nie etwas Unrechtes getan.
Nun mußt Du überlegen, was Du mit dem Shop machen willst. An Sophia schreibe ich ebenfalls, sie kann Dir helfen. Ich schenke Dir das ganze Geschäft. Aber wenn Du es verkaufen willst, mußt Du mit Anil, dem Inder, verhandeln. Von hier aus will ich Dir helfen, so gut ich kann, und wil Dich nicht fal en lassen. Falls Du Probleme hast, sage es Sophia. Die Shopmiete ist bis Mitte Dezember bezahlt, doch wenn Du nicht mehr arbeiten wil st, mußt Du unbedingt mit Anil sprechen. Auch den Wagen schenke ich Dir. Ich lege Dir für ihn ein unterzeichnetes Papier bei. Wenn Du den Wagen verkaufen wil st, bekommst Du mindestens noch 80000 Schillinge, aber Du mußt jemanden Guten finden, der Dir hilft. Danach bist Du ein reicher Mann.
Bitte, Lketinga, sei nicht traurig, Du wirst eine bessere Frau finden, denn Du bist jung und schön. Bei Napirai werde ich Dich in guter Erinnerung halten. Bitte versteh mich! Ich würde in Kenia sterben, und ich denke nicht, daß Du das willst. Meine Familie denkt nicht schlecht von Dir, sie haben Dich immer noch gern, doch wir sind zu verschieden.
Viele Grüße von Corinne und Familie
Lieber James,
ich hoffe, Du bist okay. Ich bin in der Schweiz und sehr traurig. Mir ist jetzt klar, daß ich nie mehr nach Kenia zurückkommen werde. Heute habe ich dies Lketinga geschrieben, denn ich bin nicht länger stark genug, um mit Deinem Bruder zu leben.
Ich fühlte mich sehr allein, weil ich eben weiß bin. Du hast uns erlebt. Ich habe ihm eine Chance in Mombasa gegeben, doch es ist nicht besser, sondern noch schlechter geworden. Dabei habe ich ihn einmal so sehr geliebt! Aber seit dem Krach wegen Napirai hat diese Liebe einen großen Riß bekommen. Seit diesem Tag haben wir uns von morgens bis abends nur noch gestritten. Seine Gedanken sind nur negativ. Ich glaube nicht, daß er weiß, was Liebe ist, denn wenn man jemanden liebt, kann man nicht solche Sachen sagen.
Mombasa war meine letzte Hoffnung, aber er änderte sich nicht. Es war wie im Gefängnis. Wir haben einen guten Laden eröffnet, doch ich glaube nicht, daß er allein dort arbeiten kann. Bitte fahre so schnell wie möglich nach Mombasa, und rede mit ihm! Er hat jetzt niemanden mehr und ist ganz allein. Wenn er den Shop verkaufen will, kann ich mit Anil telefonieren, aber ich muß wissen, was geschehen soll. Auch den Wagen kann er behalten. Please, James, geh so schnel wie möglich nach Mombasa, denn Lketinga braucht Dich sehr, wenn er meinen Brief bekommt.
Ich werde von der Schweiz aus helfen, so gut ich kann. Wenn er alles verkauft, wird er ein reicher Mann sein. Er muß aber vorsichtig sein, denn sonst wird die große Verwandtschaft al es Geld schnell verbrauchen. Ich weiß nicht, wie der Shop funktioniert ohne mich, aber bis jetzt hatten wir ein gutes Geschäft. Bitte gehe nachschauen, denn im Geschäft steckt viel Geld in Form von Goldschmuck und anderem. Ich wil nicht, daß man Lketinga betrügt. Hoffentlich können mir alle das, was ich tun mußte, verzeihen. Käme ich nach Kenia zurück, würde ich dort sehr schnel sterben.
Bitte erkläre al es Mama. Ich liebe sie und werde sie nie vergessen. Leider kann ich ja mit ihr nicht sprechen. Erzähle ihr, daß ich al es versucht habe, mit Lketinga zu leben. Doch sein Kopf lebt in einer anderen Welt. Bitte schreibe schnel zurück, wenn Du diesen Brief bekommen hast. Ich selber habe auch viele Probleme, denn ich weiß nicht, ob ich in der Schweiz bleiben kann. Wenn nicht, wird es Deutschland sein. Für die nächsten drei Monate lebe ich bei meiner Mama.
Liebe Grüße von Corinne
Lieber Pater Giuliano,
ich bin nun seit dem 6. Oktober 1990 in der Schweiz. Nach Kenia werde ich nicht zurückkommen. Ich bin nicht länger stark genug, um mit meinem Ehemann zu leben.
Dies habe ich ihm vor zwei Wochen in einem Brief mitgeteilt. Nun warte ich auf seine Antwort. Es wird ihn hart treffen, denn ich ließ ihn in der Meinung, daß ich nur ferienhalber in die Schweiz reise. Andernfalls hätte er mir nie erlaubt, zusammen mit Napirai das Land zu verlassen.
Wie Sie wissen, haben wir an der Südküste einen tollen Laden eröffnet. Wir hatten vom ersten Tag an ein gutes Geschäft. Doch mit meinem Ehemann ist es nicht besser geworden. Er war so eifersüchtig, auch wenn ich nur mit Touristen sprach. Er hat mir nie vertraut in all den Jahren. In Mombasa war es wie im Gefängnis. Die ganze Zeit haben wir nur noch gestritten, was auch nicht gut für Napirai war.
Das Herz meines Mannes ist gut, doch in seinem Kopf stimmt etwas nicht. Es ist sehr hart für mich, das zu sagen, doch ich bin mit dieser Meinung nicht allein. Alle unsere Freunde haben uns verlassen. Selbst einige Touristen bekamen Angst vor ihm. Es war nicht jeden Tag gleich schlimm, doch zuletzt fast täglich. Ich habe ihn mit allem zurückgelassen, Shop, Auto etc. Er kann al es verkaufen und als reicher Mann nach Barsaloi zurückkehren. Ich wäre glücklich, wenn er eine gute Frau und viele Kinder bekommen würde.
Ich lege noch ein paar Kenia-Schil inge in diesen Brief die sie der Mutter meines Mannes geben können. Auf der Barclays Bank habe ich noch Geld. Vielleicht könnten Sie dafür sorgen, daß die Mama dieses Geld erhält? Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. Bitte geben Sie mir Bescheid.
Ich habe Ihnen diesen Brief geschrieben, damit Sie mich verstehen, wenn Sie eines Tages von diesen Geschehnissen hören. Sie können mir glauben, ich habe mein Bestes versucht. Ich hoffe, auch Gott kann mir verzeihen.
Viele Grüße von Corinne und Napirai
Hallo Sophia!
Gerade eben habe ich Deinen und Lketingas Anruf erhalten. Ich bin sehr traurig und nur noch am Weinen. Ich habe Dir jetzt gesagt, daß ich nicht mehr zurückkomme. Es ist die Wahrheit. Es war mir klar, noch bevor ich die Schweiz erreicht hatte. Du kennst meinen Mann auch ein bißchen. So sehr habe ich ihn geliebt wie niemanden vorher in meinem Leben! Für ihn war ich bereit, ein richtiges Samburu-Leben zu führen.
Dabei wurde ich so oft krank in Barsaloi, doch ich blieb da, weil ich ihn liebte.
Vieles hat sich verändert, seit ich Napirai zur Welt brachte. Eines Tages hat er behauptet, dieses Kind sei nicht von ihm. Seit diesem Tag ist meine Liebe zerbrochen. Die Tage sind vergangen mit Höhen und Tiefen, und er hat mich oft schlecht behandelt.
Sophia, ich sage Dir bei Gott, ich hatte nie einen anderen Mann, nie! Dennoch mußte ich mir dies von morgens bis abends anhören. In Mombasa habe ich meinem Mann und mir noch eine Chance gegeben. Aber so kann ich nicht weiterleben. Er selbst merkt es nicht einmal! Ich habe alles aufgegeben, sogar mein Heimatland.
Sicher habe auch ich mich verändert, doch ich denke, das ist unter diesen Umständen normal. Es tut mir sehr leid für ihn und für mich. Wo ich in Zukunft bleiben kann, weiß ich noch nicht.
Mein größtes Problem ist Lketinga. Er hat nun niemanden mehr für den Shop, den er nicht managen kann. Bitte laß mich wissen, ob er ihn behalten will. Ich wäre froh, wenn er damit zurecht käme, wenn nicht, soll er alles verkaufen. Das gleiche gilt für den Wagen. Napirai bleibt bei mir. Ich weiß, sie ist so glücklicher. Bitte, Sophia, kümmere Dich ein bißchen um Lketinga, er wird nun viele Probleme haben. Leider kann ich ihm nicht viel helfen. Wenn ich nochmals nach Kenia käme, würde er mich niemals mehr in die Schweiz zurücklassen.
Sein Bruder James kommt hoffentlich nach Mombasa. Ich habe ihm geschrieben. Bitte hilf ihm mit Gesprächen. Mir ist bewußt, auch Du hast viele Probleme, und ich hoffe für Dich, sie werden sich bald lösen. Ich wünsche Dir, daß al es gut wird und Du auch wieder eine weiße Freundin findest. Napirai und ich werden Euch nie vergessen. Ich wünsche Dir al es Gute und viele Grüße Corinne
Ich danke al en meinen Freundinnen, die mich in der Zeit des Schreibens unterstützt haben, namentlich vor allem:
Hanny Stark, die mich motiviert hat, dieses Buch überhaupt zu schreiben und Anneliese Dubacher, die mein handschriftliches Manuskript in mühsamer Arbeit auf den Computer übertragen hat.
Buchtipps:
Stefanie Gercke
Ich kehre zurück nach Afrika
ISBN 3-426-61498-7
Als die junge Henrietta Ende der fünfziger Jahre auf Geheiß ihrer Eltern nach Südafrika zieht, ist dies eigentlich als Strafe gedacht. Doch Henrietta ist glücklich, daß sie der Enge und den Konventionen ihrer Heimatstadt entfliehen kann, und baut sich in dem fremden Land ein neues, glückliches Leben auf. Als sie den Schotten Ian kennenlernt, scheint ihr Glück vol kommen. Doch bald geraten sie mit dem System der Rassentrennung in Konflikt…
Der große Schicksalsroman einer Frau, die ihren Traum von Afrika zu verwirklichen sucht!
Knaur Taschenbuch Verlag
Leseprobe aus Stefanie Gercke
Ich kehre zurück nach Afrika
Dienstag, den 26. März 1968
Durch das Dröhnen der Flugzeugmotoren meinte sie die Stimme ihres Vaters zu hören, traurig und voller Sehnsucht. „Du bist in Afrika geboren, auf einer kleinen Insel im weiten, blauen Meer.“ Seine Worte waren so klar wie damals, vor fast dreiundzwanzig Jahren. Sie sah ihn am Fenster lehnen, das blind war von dem peitschenden Novemberregen, seine breiten Schultern nach vorn gefallen, und ihr war, als vernähme sie wieder die windverwehte Melodie von sanften kehligen Stimmen, als stiege ihr dieser Geruch von Rauch und feuchter, warmer Erde in die Nase. „Afrika“, hatte er geflüstert, und sie wußte, daß er den dunklen Novemberabend nicht sah, daß er weit weg war von ihr, in diesem fernen, leuchtenden Land, dessen Erinnerung ihm, ihrem turmgroßen, starken Vater, die Tränen in die Augen trieb.
Die Stirn gegen das kalte Fenster des großen Jets gepreßt, sah sie hinunter auf das Land, das sie liebte, ihr Paradies. Ein Schluchzen stieg ihr in die Kehle. Sie schüttelte ihre dichten, honigfarbenen Haare schützend vor das Gesicht. Niemand durfte ihr etwas anmerken, niemand durfte wissen, daß sie dieses Land für immer verließ, niemand! Besonders nicht der Kerl da vorne, der in dem hel en Safarianzug mit dem schwarzen Bürstenschnurrbart, der so ruhig an der Trennwand zur ersten Klasse lehnte. Vorhin, als sie einstieg, stand er zwischen den Sitzen in einer der letzten Reihen. Sein Genick steif wie ein Stock, ließ er seine Augen ständig über seine Mitpassagiere wandern. Von Gesicht zu Gesicht, jede ungewöhnliche Regung registrierend, ohne Unterlaß. Daran hatte sie ihn erkannt, an dem ruhelosen, lauernden Ausdruck seiner Augen. Einer von BOSS, dem Bureau of State Security, ein Agent der Staatssicherheit, der gefürchtetsten Institution Südafrikas. BOSS, die eine Akte über sie führten.
Tief unter ihr glitt die Küste von Durban dahin. Die Bougainvilleen leuchteten allenthalben wie rosafarbene Juwelen auf den sattgrünen Polstern gepflegter Rasenflächen. Ihre Augen ertranken in stil en Tränen.
Reiß dich zusammen, heulen kannst du später!
So verharrte sie lautlos, saß völlig bewegungslos, zwang sich, das Schluchzen hinunterzuschlucken. Sie tat es für ihre Kinder, ihre Zwil inge, Julia und Jan, den Mittelpunkt ihrer kleinen Familie, die ganz still neben ihr in den Sitzen hockten.
Ihre Gesichter, von der afrikanischen Sonne tief gebräunt, waren angespannt und blaß, ihre Augen in verständnisloser Angst aufgerissen. Obwohl sie sich bemüht hatte, sich nichts anmerken zu lassen, mußten sie dennoch etwas gespürt haben.
Sie waren gerade erst vier Jahre alt geworden. Viel zu jung, um so brutal aus ihrem behüteten Dasein gerissen zu werden, zu klein, um zu verstehen, daß von nun an nichts mehr so sein würde, wie es bisher war. Vor wenigen Wochen erst hatten sie mit einer übermütigen Kuchenschlacht ihren Geburtstag gefeiert, doch Henrietta hatte Mühe, sich daran zu erinnern, denn die folgenden Ereignisse töteten alles andere in ihr, ihre Gefühle, ihre Erinnerungen, ihre Sehnsüchte. Es war, als wüchse ein bösartiges Geschwür in ihr, das sie ausfül te und langsam von innen auffraß.
Das metal ische Signal des bordinternen Lautsprechers schnitt scharf durch das sie umgebende Stimmengesumm. Das Geräusch kratzte über ihre rohen Nerven, sie zuckte zusammen, fing die Bewegung aber sofort auf. Um keinen Preis auffallen! Nur nicht in letzter Sekunde die Fassung verlieren und den Mann gefährden, der dort unten, irgendwo in dem unwegsamen, feuchtheißen, schlangenverseuchten Buschurwald im Norden Zululands versuchte, über die Grenze nach Mocambique zu gelangen. Ihr Mann. Es war ihr plötzlich, als spüre sie seine Hand in der ihren. So stark war ihre Vorstellungskraft, daß sie seine Wärme fühlte. Sie strömte in ihren Arm und breitete sich wohlig in ihr aus, so als teilten sie denselben Blutkreislauf. Sie wußte, solange diese Hand die ihre hielt, konnte ihr nie etwas wirklich Furchtbares passieren. Ihr nicht und Julia und Jan nicht. Sie schloß die Augen und gab sich für einen Augenblick dieser kostbaren Wärme und Geborgenheit hin.
Doch ebenso plötzlich war es vorbei, es fröstelte sie. Eiskalte Angst ergriff ihre Seele. Denn sollte der Agent von Boss mißtrauisch werden, merken, daß sie auf der Flucht war und nicht die Absicht hatte, nach Südafrika zurückzukehren, würden sie ihn fangen, bevor er die Grenze überquert hatte. Verschnürt wie Schlachtvieh, würden sie ihn in ein vergittertes Auto werfen und dann in einem ihrer berüchtigten Gefängnisse verschwinden lassen. Als Staatsfeind unter dem 180-Tage-Arrest-Gesetz, einhundertachtzig Tage ohne Anklage, ohne Verurteilung und ohne die Möglichkeit für den Gefangenen, einen Anwalt oder auch nur seine Familie zu benachrichtigen. Nach 180 Tagen würden sie ihn freilassen aus der dumpfen, dämmrigen Zelle, zwei, drei Schritte in den strahlenden afrikanischen Sonnenschein machen lassen, die Freiheit des endlosen Himmels kosten, um ihn auf der Stel e für weitere 180 Tage zu inhaftieren. „Bis die Hölle zufriert“, pflegte Dr. Piet Kruger, Generalstaatsanwalt von Südafrika, zynisch zu bemerken. Irgendwann würden sie ihn mit gefälschten Anschuldigungen vor Gericht stellen und dann für viele Jahre qualvoll hinter Gittern verrotten, zum Tier verkommen lassen. Ihr wurde speiübel von den Bildern, die sich ihr aufdrängten.
Als aber die Stewardeß sie nach ihrem Getränkewunsch fragte, konnte sie lächeln, und ihre Stimme war klar und ohne Schwankungen. In den letzten Wochen mußte sie das lernen. Zu lächeln, obwohl ihr das Herz brach. Sie hatte Dinge gelernt und Dinge getan, von denen sie nie ahnte, daß sie dazu fähig sei. Sie hatte gelogen, getäuscht und jede Menge Gesetze gebrochen, mit lachendem Gesicht und einem stummen Schrei in der Kehle, der sie fast erstickte.
Der weiße Jet flog hinaus über die blaue Unendlichkeit des Indischen Ozeans. Der wie helles Gold schimmernde Strand, der um Natal liegt wie ein breites Halsband, wurde zu einem feinen, leuchtenden Reif, die Küste versank im Dunst der Ferne.
Kurz darauf legte sich das Flugzeug in eine scharfe Kurve landeinwärts, und sie erkannte Umhlanga Rocks an der aus dem dünnen Salzschleier steigenden Hügellandschaft und dem rot-weißen Leuchtturm, der vor dem traditionsreichen Oyster Box Hotel die Seefahrer vor den tückischen, felsbewehrten Küstengewässern warnte. Und weil sie wußte, wo sie suchen mußte, entdeckte sie das silbergraue Schieferdach ihres Hauses, oben am Hang, unter den Flamboyants. Sie sah es nur für den winzigen Bruchteil eines Augenblicks zwischen dem flirrenden Grün, dann versank es in dem Meer von Bäumen.
Vor etwas mehr als acht Jahren war sie hier gelandet, hungrig nach Leben nach den Einschränkungen der Nachkriegsjahre in Deutschland, gierig nach Freiheit, froh, endlich den erstickenden Vorschriften und Traditionen einer seelisch verkrüppelten Gesellschaft entronnen zu sein. So kam sie im Dezember 1959 nach Südafrika, noch nicht zwanzig Jahre alt, sprühend von Lebensenergie, erfül t von unbändiger Willenskraft, hier ihr Leben aufzubauen.
Sarahs dunkles Gesicht tauchte vor ihr auf, daneben das von Tita, gerahmt von ihren flammenden Locken, und hinter ihnen gruppierten sich die Menschen, die sie liebte und die sie jetzt verlassen mußte. „Ich kehre zurück, Afrika“, schwor sie und dachte dabei an Papa. „Einmal noch nach Afrika – ich werde nicht nur davon träumen.“ Eine übermächtige Wut packte sie auf al e, die ihr und ihrer Familie das antaten, Kampfgeist brach durch ihren Schmerz, doch sie grub ihre Fingernägel tief in die Handflächen. Noch mußte sie durchhalten, noch wenige Stunden. In knapp fünfundvierzig Minuten war die Landung auf dem Jan-Smuts-Airport in Johannesburg vorgesehen. Zwei Stunden später würde sie dann an Bord der British-Airways-Maschine dieses Land verlassen. Wenn sie mich nicht erwischen! Bis dahin muß ich weiter lächeln und lügen und mich verstellen.
Sie sah hinunter auf ihr Paradies, um sich jede Einzelheit einzuprägen. Das Flugzeug stieg steil und schnell, und Umhlanga verschwand hinter den fruchtbaren, grünen Hügeln von Natal. Zurück blieb der Abdruck dieses Bildes, das sich tief und unauslöschlich in ihr Gedächtnis grub.
Es begann vor langer Zeit, als Henrietta noch sehr klein war, als Entfernungen noch in Tagen und Wochen gemessen wurden, zu der Zeit, als sie die Welt bewußt wahrzunehmen begann.
Im sterbenden Licht eines dunklen, stürmischen Novembertages, auf dem dünnen Teppich über dem harten Parkettboden im Wohnzimmer ihrer Großmutter in Lübeck sitzend, wendete sie die steifen Seiten ihres Lieblingsbilderbuches über wilde Tiere in einem fremdartigen, grünen Blätterwald und badete ihre ungestüme Kinderseele in den leuchtenden, bunten Farben. Regen explodierte gegen die Fensterscheiben, und Wind heulte durch die kahlen Bäume, fegte fauchend um die Häuserecken. Ihr Vater lehnte seinen Kopf in den blauen Ohrensessel zurück. Seine Hände, die ein Buch hielten, sanken auf die Knie. „Afrika“, sagte er nach einer Weile leise, und nach einer langen, stil en Pause, „nur noch einmal Afrika.“ Seine hellen, blauen Augen blickten durch den grauen Regenvorhang, als sähe er ein Land und eine Zeit jenseits der kalten, unwirtlichen Novemberwelt.
Das kleine Mädchen auf dem Boden hob den Kopf, Lampenlicht vergoldete ihre Locken, und lauschte dem Nachhal der Worte. „Afrika?“ wiederholte sie fragend.
Ihr Vater sah hinunter auf seine Tochter und nickte. „Es ist nicht zu früh, du wirst es verstehen“, murmelte er und drückte sich mit seinen kräftigen Armen aus dem Sessel auf die Füße. Sein rechtes Bein war schwach und dünn wie das eines Kindes und mußte durch eine Metallschiene gestützt werden. Die Folgen eines Unfalls und einer verpatzten Operation, die ihn zum Krüppel gemacht hatten. Er stützte sich schwer auf seinen Stock und hinkte zum Glasschrank, der stets verschlossen war und Dinge von seltsamen, fremden Formen hinter den Spitzengardinen verbarg. Er holte einen fleckigen, vergilbten Leinensack heraus und legte ihn geöffnet in ihren Schoß. „Nimm es heraus.“








