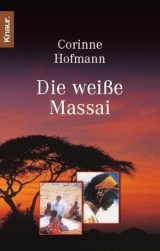
Текст книги "Die weisse Massai"
Автор книги: Corinne Hofmann
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Mein Massai-Freund starrt in das kochende Wasser und verfolgt gespannt, wie sich die starren Spaghettistäbchen langsam biegen. Für ihn ist es ein Rätsel, und er bezweifelt, daß das ein Essen wird. Während die Teigwaren garen, öffne ich mit einem Messer die Dose mit der Tomatensauce. Als ich den Inhalt in eine verbeulte Pfanne leere, fragt Lketinga entsetzt: „Is this blood?“
Jetzt bin ich diejenige, die lauthals lachen muß. „Blood? O no, Tomatensauce!“
antworte ich kichernd.
Inzwischen kommen Jelly und Eric schwitzend bei uns an. „Was, du kochst auf dem Boden?“ fragt Jel y überrascht. „Ja, meinst du, wir haben hier eine Küche?“
antworte ich.
Als wir die Spaghetti einzeln mit Gabeln herausfischen, geraten Priscil a und Lketinga völlig aus dem Häuschen. Priscilla holt ihre Nachbarin. Auch diese schaut auf die weißen Spaghetti, dann in den Topf mit der roten Sauce, fragt, auf die Teigwaren zeigend, „Worms?“ und verzieht das Gesicht zur Grimasse. Jetzt müssen wir lachen. Die drei glauben, wir äßen Würmer mit Blut, und rühren das Gericht nicht an. Irgendwie kann ich sie fast verstehen, denn je länger ich in die Schüssel schaue, desto mehr vergeht auch mir bei der Vorstel ung von Blut und Würmern der Appetit.
Beim Abwaschen stoße ich auf das nächste Problem. Es gibt weder Abwaschmittel noch eine Bürste. Priscilla löst diese Aufgabe, indem sie einfach „Omo“ benutzt und mit den Fingernägeln kratzt. Mein Bruder stel t nüchtern fest: „Schwesterherz, für immer sehe ich dich hier noch nicht. Auf jeden Fal benötigst du für deine schönen langen Nägel sicher keine Feile mehr.“ Irgendwie hat er recht. Den beiden bleiben noch zwei Tage Ferien, dann werde ich mit Lketinga al ein sein. An ihrem letzten Abend findet im Hotel wieder ein Massai-Tanz statt. Jelly und Eric haben das im Gegensatz zu mir noch nie erlebt. Lketinga macht auch mit, und wir drei warten gespannt auf den Beginn. Die Massai versammeln sich vor dem Hotel und deponieren dort Speere, Schmuck, Perlengürtel und Stoffe für den späteren Verkauf.
Es sind etwa fünfundzwanzig Krieger, die sich singend einfinden. Ich fühle mich verbunden mit diesen Menschen und bin so stolz auf dieses Volk, als wären alle meine Brüder. Es ist unglaublich, wie elegant sie sich bewegen und welche Aura sie verströmen. Mir schießen Tränen in die Augen bei diesem mir unbekannten Gefühl von Heimat.
Mir scheint, ich habe meine Familie, mein Volk gefunden. Beunruhigt über so viele wild bemalte und geschmückte Massai, raunt Jelly mir zu: „Corinne, bist du sicher, daß dies deine Zukunft ist?“ „Ja“, ist alles, was es für mich zu sagen gibt.
Gegen Mitternacht ist die Vorstellung beendet, und die Massai ziehen ab. Lketinga kommt und zeigt stolz das beim Schmuckverkauf verdiente Geld. Uns scheint es wenig zu sein, für ihn bedeutet es das Überleben für die nächsten Tage. Wir verabschieden uns herzlich, da wir Eric und Jelly nicht mehr sehen werden, denn am frühen Morgen verlassen sie das Hotel. Mein Bruder muß Lketinga versprechen wiederzukommen: „You are my friends now!“
Jel y drückt mich fest und meint weinend, ich sol e auf mich aufpassen, mir alles gut überlegen und in zehn Tagen in der Schweiz erscheinen. Anscheinend traut sie mir nicht.
Wir machen uns auf den Heimweg. Abertausende von Sternen stehen am Himmel, aber es scheint kein Mond. Doch Lketinga kennt den Weg durch den Busch trotz der Dunkelheit bestens. Ich muß mich an seinem Arm festhalten, damit ich ihn nicht aus den Augen verliere. Beim Village erwartet uns in der Finsternis ein kläffender Hund.
Lketinga stößt kurze scharfe Laute aus, und der Köter verzieht sich. Im Häuschen taste ich nach der Taschenlampe. Als ich sie endlich gefunden habe, suche ich Streichhölzer, um unsere Petroleumlampe anzuzünden. Einen kurzen Moment denke ich, wie einfach doch in der Schweiz alles ist. Da gibt es Straßenlampen, elektrisches Licht, und alles funktioniert scheinbar wie von selbst. Ich bin erschöpft und möchte schlafen. Lketinga hingegen kommt von der Arbeit, fühlt sich hungrig und sagt, ich solle ihm noch einen Tee zubereiten. Das hatte ich bis jetzt immer Priscilla überlassen! Im Halbdunkel muß ich zuerst Sprit nachfül en. Als ich das Teepulver anschaue, frage ich: „How much?“
Lketinga lacht und schüttet ein Drittel des Päckchens in das kochende Wasser.
Später kommt Zucker dazu. Aber nicht etwa zwei, drei Löffel, sondern eine volle Tasse. Ich staune und denke, daß man diesen Tee bestimmt nicht mehr trinken kann. Und doch schmeckt er fast so gut wie der von Priscilla. Nun verstehe ich auch, daß Tee durchaus eine Mahlzeit ersetzen kann.
Den nächsten Tag verbringe ich mit Priscilla. Wir wol en Wäsche waschen, und Lketinga beschließt, zur Nordküste zu fahren, um in Erfahrung zu bringen, in welchen Hotels Tanzaufführungen stattfinden. Er fragt nicht, ob ich mitkommen möchte.
Ich gehe mit Priscilla zum Ziehbrunnen und versuche, wie sie einen Zwanzig-Liter-Kanister mit Wasser zum Häuschen zu bringen, was sich als gar nicht so einfach herausstel t. Zum Auffüllen läßt man einen Eimer, der drei Liter faßt, etwa fünf Meter hinunter und zieht ihn nach oben. Dann schöpft man mit einer Blechdose das Wasser heraus und gießt es in die schmale Öffnung des Kanisters, bis dieser voll ist.
Es wird peinlich genau gearbeitet, damit nichts von dem kostbaren Naß verlorengeht.
Als mein Kanister gefül t ist, versuche ich, ihn die 200 Meter bis zur Hütte zu schleppen. Obwohl ich immer glaubte, robust zu sein, schaffe ich es nicht. Priscilla dagegen schwingt ihren Kanister mit zwei, drei Griffen auf den Kopf und marschiert ruhig und locker zur Hütte. Auf halber Strecke kommt sie mir wieder entgegen und bringt auch meinen Kanister nach Hause. Meine Finger schmerzen bereits. Das Ganze wiederholt sich ein paarmal, denn das hiesige Omo erweist sich als sehr schaumig. Die Handwäsche, dazu mit kaltem Wasser, bei schweizerischer Gründlichkeit, macht sich bald an meinen Fingerknöcheln bemerkbar. Nach geraumer Zeit sind sie völlig wundgescheuert, und das Omo-Wasser brennt. Die Fingernägel sind ruiniert. Als ich erschöpft mit schmerzendem Rücken aufhöre, erledigt Priscil a für mich den Rest.
Mittlerweile ist es später Mittag, und gegessen haben wir noch nichts. Was auch?
Im Haus haben wir keine Vorräte, denn sonst würden uns bald Käfer und Mäuse besuchen. Also kaufen wir täglich al es im Shop. Trotz der enormen Hitze machen wir uns auf den Weg. Dies bedeutet eine halbe Stunde Marsch, sofern Priscilla nicht mit jeder entgegenkommenden Person einen ausführlichen Schwatz hält.
Anscheinend ist es hier üblich, jeden mit „Jambo“ anzusprechen, um dann die halbe Familiengeschichte zu erzählen.
Endlich angekommen, kaufen wir Reis und Fleisch, Tomaten, Milch und sogar weiches Brot. Nun müssen wir den langen Weg zurückmarschieren, um anschließend zu kochen. Gegen Abend ist Lketinga immer noch nicht aufgetaucht.
Als ich Priscil a frage, ob sie weiß, wann er wiederkommt, lacht sie und meint: „No, I can't ask this a Massai-man!“
Erschöpft vom ungewohnten Arbeiten in der Hitze lege ich mich in das kühle Häuschen, während Priscil a gemächlich mit dem Kochen beginnt. Wahrscheinlich bin ich deshalb so schlapp, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe.
Ich vermisse meinen Massai, ohne ihn ist diese Welt nur halb so interessant und lebenswert. Dann endlich, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, schlendert er elegant auf die Hütte zu, und das bekannte „Hel o, how are you?“
ertönt. Ich antworte etwas beleidigt: „Oh, not so good!“, worauf er sofort erschrocken fragt: „Why?“ Etwas beunruhigt über sein Gesicht beschließe ich, nichts über seine lange Abwesenheit verlauten zu lassen, da dies bei unseren mangelnden Englischkenntnissen nur zu Mißverständnissen führen würde.
So antworte ich auf den Bauch zeigend: „Stomach!“ Er strahlt mich an und meint:
„Maybe baby?“
Ich verneine lachend. Auf diese Idee wäre ich wirklich nicht gekommen, weil ich mit der Pille verhüte, was er nicht weiß und sicher gar nicht kennt.
Bürokratische Hürden
Wir suchen ein Hotel auf, in dem sich ein Massai mit seiner weißen Frau aufhalten soll. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, bin aber sehr gespannt, denn ich könnte diese Frau einiges fragen. Als wir die beiden treffen, bin ich enttäuscht. Dieser Massai sieht wie ein „gewöhnlicher“ Schwarzer aus, ohne Schmuck und Traditionskleidung, dafür in teurem Maßanzug und um einige Jahre älter als Lketinga. Auch die Frau ist schon Ende vierzig. Alle sprechen durcheinander, und Ursula, eine Deutsche, meint: „Was, du willst hierherkommen und mit diesem Massai leben?“ Ich bejahe und frage schüchtern, was dagegen spreche. „Weißt du“, sagt sie,
„mein Mann und ich leben bereits fünfzehn Jahre zusammen. Er ist Jurist, hat aber trotzdem viel Mühe mit der deutschen Mentalität. Jetzt schau mal Lketinga an, der war noch nie in einer Schule, er kann nicht schreiben und lesen und kaum Englisch sprechen. Von den Sitten und Bräuchen in Europa und besonders von der perfekten Schweiz hat er überhaupt keine Ahnung. Das ist doch von vornherein zum Scheitern verurteilt!“ Die Frauen hier hätten gar keine Rechte. Für sie käme ein Wohnen in Kenia überhaupt nicht in Frage, Ferien hingegen seien großartig. Ich sol e Lketinga sofort andere Kleidung besorgen, so könne ich doch nicht mit ihm herumlaufen.
Sie erzählt und erzählt, und mein Herz sinkt immer tiefer bei so vielen möglichen Problemen. Auch ihr Mann meint, es sei besser, wenn Lketinga mich in der Schweiz besuchen könnte. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstel en, und mein Gefühl spricht dagegen. Trotzdem akzeptieren wir die angebotene Hilfe und machen uns am nächsten Tag auf den Weg nach Mombasa, um einen Paß für Lketinga zu beantragen. Als ich meine Zweifel äußere, fragt Lketinga, ob ich einen Mann in der Schweiz habe, sonst könne ich ihn ja problemlos mitnehmen. Dabei hatte er zehn Minuten vorher gesagt, er wolle Kenia überhaupt nicht verlassen, da er nicht wisse, wo sich die Schweiz befinde und wie meine Familie sei.
Auf dem Weg zur Paßstelle überkommen mich Zweifel, die sich später als berechtigt erweisen. Die friedlichen Tage in Kenia sind von diesem Moment an vorbei, der Officestreß beginnt. Zu viert betreten wir das Büro und stehen sicher eine Stunde in der wartenden Schlange, bevor wir in das gewünschte Zimmer vorgelassen werden. Hinter einem großen Mahagoni-Schreibtisch sitzt ein Beamter, der sich mit den Anträgen befassen sol. Zwischen Ursulas Mann und ihm entsteht eine Diskussion, von der Lketinga und ich gar nichts verstehen. Ich merke nur, wie sie immer wieder zu Lketinga in seiner exotischen Aufmachung herüberschauen.
Nach fünf Minuten heißt es „Let's go!“,
und wir verlassen verwirrt das Büro. Für fünf Minuten eine Stunde zu warten, empört mich.
Doch das ist erst der Anfang. Ursulas Mann meint, es müsse noch einiges geregelt werden. Auf keinen Fall könne Lketinga sofort mit mir fliegen, vielleicht, wenn al es klappt, in etwa einem Monat. Zuerst müßten wir Fotos machen, dann wiederkommen und Formulare ausfüllen, die al erdings momentan vergriffen und in etwa fünf Tagen wieder erhältlich seien. „Was, in einer so großen Stadt gibt es keine Paßantragsformulare“, entrüste ich mich und kann es kaum fassen. Als wir nach langer Suche endlich einen Fotografen finden, müssen wir mehrere Tage warten, bis wir die Fotos abholen können. Erschöpft von der Hitze und der ewigen Warterei, beschließen wir, zur Küste zurückzukehren. Die beiden anderen verschwinden im luxuriösen Hotel und meinen, jetzt wüßten wir ja, wo sich das Office befinde, und wenn es Probleme gäbe, seien sie hier anzutreffen.
Weil uns die Zeit davonläuft, gehen wir schon nach drei Tagen mit den Fotos ins Office. Wieder müssen wir warten, länger als das erste Mal. Je näher wir der Tür kommen, desto nervöser werde ich, weil sich Lketinga gar nicht wohl fühlt und mich Panik über mein geringes Englisch erfaßt. Endlich vor dem Officer, bringe ich mühsam unser Anliegen vor. Dieser schaut nach geraumer Zeit von seiner Zeitung auf und fragt, was ich denn mit so einem, dabei schaut er abschätzig auf Lketinga, in der Schweiz wolle. „Holidays“, erwidere ich. Der Officer lacht und meint, solange dieser Massai nicht zivilisiert angezogen sei, bekomme er gar keinen Paß. Da er keine Ausbildung und keine Ahnung von Europa habe, müsse ich eine Kaution in Höhe von 1000 Schweizer Franken hinterlegen und gleichzeitig ein gültiges Flugticket mit Hin– und Rückflug besorgen. Erst wenn ich dies erledigt hätte, könne er mir das Antragsformular geben.
Jetzt frage ich, entnervt von der Arroganz dieses Fettsacks, wie lange es noch dauere, wenn ich al es erledigt hätte. „Etwa zwei Wochen“, antwortet er, bedeutet uns mit der Hand, das Büro zu verlassen, und greift gelangweilt nach seiner Tageszeitung.
Soviel Unverschämtheit verschlägt mir die Sprache. Statt alles abzublasen, stachelt mich sein Verhalten erst richtig an, um ihm zu zeigen, wer hier gewinnen wird. Vor allem wil ich nicht, daß sich Lketinga minderwertig vorkommt. Außerdem möchte ich ihn bald meiner Mutter vorstellen können.
Ich verrenne mich immer mehr in diese fixe Vorstel ung und beschließe, mit Lketinga, der mittlerweile ungeduldig und enttäuscht ist, ins nächste Reisebüro zu gehen und alles Notwendige zu erledigen. Wir treffen auf einen freundlichen Inder, der die Situation erfaßt und mich ermahnt aufzupassen, da viele weiße Frauen auf ähnliche Weise ihr Geld verloren hätten. Ich vereinbare mit ihm, uns eine Bestätigung über das Flugticket auszustellen, und deponiere das nötige Geld bei ihm. Er gibt mir eine Quittung und das Versprechen, mir den Betrag zurückzuerstatten, wenn es mit dem Paß nicht klappen sol te.
Irgendwie weiß ich, daß es waghalsig ist, aber ich verlasse mich auf meine gute Menschenkenntnis. Wichtig ist, daß Lketinga weiß, wo er hingehen kann, wenn er den Paß hat, um das Abflugdatum anzugeben. „Wieder einen Schritt weiter!“ denke ich kämpferisch.
Auf einem nahe gelegenen Markt kaufen wir für Lketinga Hosen, Hemd und Schuhe. Das ist nicht einfach, denn sein Geschmack und meiner sind sehr gegensätzlich. Er möchte rote oder weiße Hosen. Weiße, denke ich, sind im Busch unmöglich und rot ist nicht gerade eine „männliche“ Farbe für westliche Kleidung.
Das Schicksal kommt mir zu Hilfe, alle Hosen sind zu kurz für meinen Zweimetermann. Nach langem Suchen finden wir endlich Jeans, die passen. Bei den Schuhen fängt es wieder von vorne an. Er trug bis jetzt nur Sandalen, die aus alten Autoreifen gefertigt sind. Wir einigen uns auf Turnschuhe. Nach zwei Stunden ist er neu eingekleidet, und mir gefällt er trotzdem nicht. Sein Gang ist nicht mehr schwebend, sondern schleppend. Er allerdings ist richtig stolz, zum ersten Mal im Leben lange Hosen, ein Hemd und Turnschuhe zu besitzen.
Natürlich ist es zu spät, um noch mal zum Büro zu gehen, und so schlägt Lketinga vor, zur Nordküste zu fahren. Er will mir Freunde vorstellen und mir zeigen, wo er gewohnt hat, bevor er sich bei Priscilla einquartierte. Ich zögere noch, da es schon vier Uhr ist und wir dann in der Nacht zur Südküste zurück müßten. Wieder einmal sagt er: „No problem, Corinne!“
Also warten wir auf ein Matatu nach Norden, doch erst im dritten Bus finden wir ein winziges Plätzchen. Bereits nach wenigen Minuten läuft mir der Schweiß herunter.
Glücklicherweise erreichen wir bald ein wirklich großes Massai-Dorf, wo ich zum ersten Mal auf geschmückte Massai-Frauen treffe, die mich freudig begrüßen. Es ist ein Kommen und Gehen in den Hütten. Ich weiß nicht, staunen sie mehr über mich oder das neue Outfit von Lketinga. Alle begrapschen das hel e Hemd, die Hosen, und sogar die Schuhe werden bewundert. Die Farbe des Hemdes wird langsam, aber sicher dunkler. Zwei, drei Frauen versuchen gleichzeitig, auf mich einzureden, und ich sitze stumm lächelnd da und verstehe gar nichts.
Zwischendurch kommen wieder viele Kinder in die Hütte. Sie staunen oder kichern mich an. Mir fällt auf, wie schmutzig al e sind. Plötzlich sagt Lketinga: „Wait here“, und schon ist er weg. Mir ist nicht sehr wohl. Eine Frau bietet mir Milch an, die ich angesichts der Fliegen ablehne. Eine andere schenkt mir ein Massai-Armband, das ich freudig anziehe. Offensichtlich arbeiten alle an irgendwelchen Schmuckstücken.
Etwas später erscheint Lketinga wieder und fragt mich: „You hungry?“
Diesmal antworte ich ehrlich mit ja, denn ich habe wirklich Hunger. Wir gehen ins nahe gelegene Buschrestaurant, das ähnlich wie das in Ukunda ist, nur viel größer.
Hier gibt es eine Abteilung für Frauen und weiter hinten eine für die Männer. Ich muß natürlich zu den Frauen, und Lketinga verzieht sich zu den anderen Kriegern. Die Situation gefällt mir nicht, ich wäre lieber in meinem Hüttchen an der Südküste. Ich bekomme einen Teller vorgesetzt, in dem Fleisch und sogar einige Tomaten in einer saucenähnlichen Flüssigkeit schwimmen. Auf einem zweiten Teller liegt eine Art Fladen. Ich beobachte, wie eine andere Frau das gleiche „Menü“ vor sich hat und mit der rechten Hand den Fladen zerstückelt, dann in die Sauce tunkt, dazu noch ein Stück Fleisch nimmt und al es mit der Hand in den Mund schiebt. Ich mache es ihr nach, benötige jedoch dazu beide Hände. Augenblicklich wird es still, alle schauen mir beim Essen zu. Mir ist das peinlich, zumal zehn oder mehr Kinder um mich versammelt sind und mit großen Augen zusehen. Dann reden alle wieder durcheinander, und doch fühle ich mich weiter beobachtet. So schnell wie möglich schlinge ich al es herunter und hoffe, daß Lketinga bald wieder auftaucht. Als nur noch die Knochen übrig sind, gehe ich zu einer Art Faß, aus dem man Wasser schöpft und sich über die Hände schüttet, um sie vom Fett zu befreien, was natürlich illusorisch ist. Ich warte und warte, und endlich kommt Lketinga. Am liebsten würde ich ihm um den Hals fallen. Doch er schaut mich komisch, ja fast böse an, und ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Daß auch er gegessen hat, sehe ich an seinem Hemd. Er sagt: „Come, come!“
Auf dem Weg zur Straße frage ich: „Lketinga, what's the problem?“
Bei seinem Gesichtsausdruck wird mir bange. Daß ich der Grund für seine Verärgerung bin, erfahre ich, als er meine linke Hand nimmt und sagt: „This hand no good for food! No eat with this one!“
Ich verstehe zwar, was er sagt, aber weshalb er deswegen ein solches Gesicht macht, weiß ich nicht. Ich frage nach dem Grund, aber ich bekomme keine Antwort.
Ermüdet von den Strapazen und verunsichert durch dieses neue Rätsel, fühle ich mich unverstanden und möchte nach Hause in unser Häuschen an der Südküste.
Dies versuche ich Lketinga mitzuteilen, indem ich sage: „Let's go home!“
Er schaut mich an, wie weiß ich nicht, denn ich sehe wieder nur das Weiße der Augen und den leuchtenden Perlmuttknopf. „No“, sagt er, „all Massai go to Malindi tonight.“
Mir bleibt fast das Herz stehen. Wenn ich ihn richtig verstehe, will er tatsächlich wegen eines Tanzes heute noch weiter nach Malindi. „It's good business in Malindi“, höre ich. Er merkt, daß ich nicht sehr begeistert bin und fragt mich sofort in besorgtem Ton: „You are tired?“
Ja, müde bin ich. Wo genau Malindi liegt, weiß ich nicht, und Kleider zum Wechseln sind auch nicht hier. Er meint, kein Problem, ich könne bei den
„Massailadies“ schlafen, und morgen früh sei er wieder hier. Das macht mich wieder völlig wach. Hier bleiben, ohne ihn und ohne nur ein Wort sprechen zu können, diese Vorstellung erfüllt mich mit Panik. „No, we go to Malindi together“, beschließe ich. Lketinga lacht endlich wieder, und das vertraute „No problem!“
ertönt. Mit einigen anderen Massai steigen wir in einen öffentlichen Bus, der wirklich bequemer ist als diese halsbrecherischen Matatus. Wir sind in Malindi, als ich aufwache.
Als erstes suchen wir ein Einheimischen-Lodging, weil nach der Show wahrscheinlich al es ausgebucht sein wird. Viel Auswahl gibt es nicht. Wir finden eines, in dem sich bereits andere Massai einquartiert haben, und bekommen den letzten leeren Raum. Er ist nicht größer als drei mal drei Meter. An zwei Betonwänden steht ein Eisenbett mit dünnen, durchhängenden Matratzen und jeweils zwei Wolldecken darauf. Von der Decke hängt eine nackte Glühbirne herunter, und zwei Stühle stehen verloren im Raum. Wenigstens kostet es fast nichts, pro Nacht umgerechnet vier Franken. Uns bleibt gerade noch eine halbe Stunde Zeit, bevor die Vorführung der Massai-Tänzer beginnt. Ich gehe schnell eine Cola trinken.
Als ich kurz darauf in unser Zimmer zurückkomme, staune ich nicht schlecht.
Lketinga sitzt auf einem der durchhängenden Betten, die Jeanshose bis zu den Knien heruntergezogen und reißt ärgerlich daran herum. Offensichtlich wil er sie ausziehen, weil wir gleich los müssen und er natürlich nicht in europäischer Kleidung auftreten kann. Bei diesem Anblick kann ich nur mühsam mein Lachen unterdrücken.
Da er die Turnschuhe an hat, gelingt es ihm nicht, die Jeans darüberzuziehen. Nun hängt die Hose an seinen Beinen und geht weder rauf noch runter. Lachend knie ich nieder und versuche, die Schuhe wieder aus den Jeansbeinen herauszukriegen, wobei er schreit: „No, Corinne, out with this!“
auf die Hose zeigend. „Yes, yes“,
antworte ich und versuche zu erklären, daß er zuerst wieder hineinsteigen muß, dann die Schuhe ausziehen soll, erst dann könne er sich der Hose entledigen.
Die halbe Stunde ist längst um, und wir hetzen zum Hotel. In seinem bewährten Outfit gefällt er mir tausendmal besser. Er hat schon große Blasen an den Fersen von den neuen Schuhen, die er natürlich ohne Socken tragen wollte. Wir erreichen gerade noch rechtzeitig die Show. Ich setze mich zu den weißen Zuschauern, die mich zum Teil abschätzig mustern, da ich immer noch dieselben Kleider wie am Morgen anhabe, die sicher nicht schöner und sauberer geworden sind. Auch rieche ich nicht so frisch wie die eben geduschten Weißen, von meinen verklebten langen Haaren ganz zu schweigen. Trotzdem bin ich wahrscheinlich die stolzeste Frau in diesem Raum. Beim Anblick der tanzenden Männer überkommt mich dieses mir nun schon bekannte Gefühl der Dazugehörigkeit.
Als die Show und der Verkauf vorbei sind, ist es fast Mitternacht. Ich wil nur noch schlafen. Im Lodging möchte ich mich notdürftig waschen, doch Lketinga kommt, gefolgt von einem weiteren Massai, in unseren Raum und meint, sein Freund könne doch im zweiten Bett schlafen. Ich bin nicht gerade erfreut über die Vorstel ung, mit einem fremden Mann diese drei mal drei Meter zu teilen, aber ich sage nichts, um nicht unhöflich zu erscheinen. Also quetsche ich mich in meinen Kleidern mit Lketinga auf das schmale, durchhängende Bett und schlafe trotzdem irgendwann ein.
Morgens kann ich endlich duschen, zwar nicht sehr luxuriös mit spärlichem Wasserstrahl, dazu noch eiskalt. Trotz der dreckigen Kleider fühle ich mich auf der Fahrt zurück zur Südküste etwas besser.
In Mombasa kaufe ich mir ein einfaches Kleid, da wir im Office wegen des Passes und der Formulare vorbeischauen wol en. Heute klappt es tatsächlich. Nach dem Begutachten des vorläufigen Tickets und der Bescheinigung über das Depotgeld erhalten wir endlich ein Antragsformular. Beim Versuch, die vielen Fragen zu beantworten, stel e ich fest, daß ich die meisten kaum verstehe, und beschließe deshalb, das Papier mit Ursula und ihrem Mann auszufüllen. Nach fünf Stunden Fahrt sind wir schließlich wieder an der Südküste in unserem Häuschen. Priscilla hat sich bereits große Sorgen gemacht, da sie nicht wußte, wo wir die Nacht verbracht haben. Lketinga muß ihr erklären, warum er in der europäischen Aufmachung daherkommt. Ich lege mich etwas hin, weil es draußen wirklich heiß ist. Hunger habe ich auch. Sicher bin ich schon um etliche Kilo leichter geworden.
Mir bleiben noch sechs Tage bis zum Heimflug, und ich habe mit Lketinga noch nicht über eine gemeinsame Zukunft in Kenia gesprochen. Alles dreht sich nur um diesen blöden Paß. So mache ich mir Gedanken, was ich hier anfangen könnte. Zum Leben benötigt man bei diesem bescheidenen Stil nicht viel Geld, und trotzdem brauche ich eine Aufgabe und zusätzliche Einnahmen. Da kommt mir die Idee, in einem der vielen Hotels ein Ladenlokal zu suchen. Ich könnte ein oder zwei Schneiderinnen beschäftigen, Schnittmuster von Kleidern aus der Schweiz mitbringen und hier eine Schneiderei betreiben. Schöne Stoffe gibt es im Überfluß, gute Näherinnen ebenfalls, die für etwa 300 Franken im Monat arbeiten, und verkaufen ist meine absolute Stärke.
Von dieser Idee begeistert, rufe ich Lketinga ins Häuschen und versuche sie ihm zu erklären, merke aber bald, daß er mich nicht versteht. Doch das erscheint mir jetzt wichtig, und deshalb hole ich Priscil a hinzu. Sie übersetzt, und Lketinga nickt nur ab und zu. Priscil a erklärt mir, ohne Arbeitsbewilligung oder Heirat könne ich mein Vorhaben nicht verwirklichen. Die Idee sei gut, denn sie kenne hier einige Leute, die mit einer Maßschneiderei gutes Geld verdienen. Ich frage Lketinga, ob er denn eventuel an einer Heirat interessiert sei. Entgegen meinen Erwartungen reagiert er zurückhaltend. Er meint auch recht vernünftig, da ich ein so gutgehendes Geschäft in der Schweiz habe, solle ich dies nicht verkaufen, sondern statt dessen lieber zwei-oder dreimal im Jahr zu „holidays“ kommen, er werde immer auf mich warten!
Nun werde ich etwas ungehalten. Nachdem ich drauf und dran bin, in der Schweiz alles aufzugeben, macht er mir Ferienvorschläge! Ich bin enttäuscht. Er merkt es sofort und sagt, natürlich zu Recht, daß er mich nicht richtig kenne und ebensowenig meine Familie. Er brauche Zeit zum Überlegen. Auch ich müsse nachdenken, und außerdem käme er eventuell in die Schweiz. Ich sage nur: „Lketinga, wenn ich etwas mache, dann richtig und nicht halb.“ Entweder möchte er, daß ich komme und er empfindet ähnlich wie ich, oder ich versuche, al es zu vergessen, was zwischen uns geschehen ist.
Am nächsten Tag suchen wir Ursula und ihren Mann im Hotel auf, um das Formular auszufüllen. Wir treffen sie aber nicht an, weil sie auf eine mehrtägige Safari gegangen sind. Wieder einmal verfluche ich mein spärliches Englisch. Wir suchen jemand anderen zum Übersetzen. Lketinga wil nur einen Massai, anderen traut er nicht.
Wir fahren wieder nach Ukunda und hocken Stunden im Teehaus, bis endlich ein Massai auftaucht, der lesen, schreiben und Englisch sprechen kann. Seine überhebliche Art gefällt mir zwar nicht, doch gemeinsam mit Lketinga füllt er alles aus, meint aber gleichzeitig, ohne Schmiergeld funktioniere hier nichts. Da er mir seinen Paß zeigt und anscheinend schon zweimal in Deutschland war, glaube ich ihm. Er fügt hinzu, durch meine weiße Haut steige das Schmiergeld gleich ins Fünffache. Am nächsten Tag werde er mit Lketinga gegen ein kleines Entgelt nach Mombasa fahren und al es erledigen. Mißmutig willige ich ein, denn langsam habe ich keine Geduld mehr, mich mit dem arroganten Officer herumzuschlagen. Für nur 50 Franken will er al es erledigen und Lketinga sogar bis zum Flughafen begleiten.
Ich übergebe noch etwas Schmiergeld, und die beiden fahren los nach Mombasa.
Endlich gehe ich wieder einmal an den Strand und lasse mich von der Sonne und dem guten Hotelessen verwöhnen, das natürlich zehnmal soviel kostet wie in den lokalen Restaurants. Gegen Abend kehre ich ins Häuschen zurück, wo mich Lketinga bereits grimmig erwartet. Aufgeregt frage ich, wie es in Mombasa war. Er aber will nur wissen, wo ich war. Lachend antworte ich ihm: „Am Strand und essen im Hotel!“
Er will weiter wissen, mit welchen Leuten ich mich unterhalten habe. Ich denke mir nichts und erwähne Edy und zwei andere Massai, mit denen ich ein paar Worte am Strand gewechselt habe. Sein Gesicht wird nur langsam freundlicher, und er sagt nebenbei, daß es mit dem Paß etwa drei bis vier Wochen dauern wird.
Ich freue mich und versuche, viel von der Schweiz und meiner Familie zu erzählen.
Auf Eric freue er sich, gibt er mir zu verstehen, aber was die anderen Leute betrifft, wisse er nicht, was auf ihn zukomme. Auch mir ist bei der Vorstel ung, wie die Menschen in Biel auf ihn reagieren werden, nicht ganz wohl. Schon der Verkehr auf den Straßen, die ausgefallenen Lokale und der ganze Luxus werden ihn verwirren.
Meine letzten Tage in Kenia verbringen wir etwas ruhiger. Wir schlendern ab und zu ins Hotel, an den Strand oder verbringen den Tag im Village mit verschiedenen Leuten, Tee trinkend und kochend. Als der letzte Tag anbricht, bin ich traurig und versuche, die Fassung zu bewahren. Auch Lketinga ist nervös. Viele bringen mir irgendein Geschenk, meistens Massai-Schmuck. Meine Arme sind fast bis zu den Ellenbogen hoch geschmückt.
Lketinga wäscht mir nochmals die Haare, hilft mir beim Packen und fragt andauernd: „Corinne, real y you will come back to me?“
Anscheinend glaubt er nicht, daß ich wiederkomme. Er meint, viele Weiße behaupten dies und kommen nicht mehr, oder wenn, dann nehmen sie sich einen anderen Mann. „Lketinga, ich wil keinen anderen, only you!“
beteuere ich immer wieder. Ich werde viel schreiben, Fotos schicken und ihm Nachricht geben, wenn ich alles erledigt habe. Immerhin muß ich jemanden finden, der mir das Geschäft abkauft und jemanden, der meine Wohnung und die gesamte Einrichtung übernimmt.
Er soll mir über Priscil a mitteilen, wann er kommt, fal s er den Paß erhält. „Wenn es nicht klappt oder du wirklich nicht in die Schweiz wil st, kannst du es mir ruhig mitteilen“, sage ich zu ihm. Ich werde ungefähr drei Monate brauchen, bis ich alles erledigt habe. Er fragt mich, wie lange drei Monate sind: „How many ful moons?“
„Dreimal Vol mond“, gebe ich lachend zur Antwort. Wir verbringen am letzten Tag jede Minute gemeinsam und beschließen, bis vier Uhr morgens in die Bush-Baby-Bar zu gehen, um nicht zu verschlafen und die Zeit zu nutzen. Wir reden, zeigen, deuten die ganze Nacht, und immer wieder die gleiche Frage, ob ich wirklich wiederkomme.
Ich verspreche es zum zwanzigsten Mal und merke, wie aufgewühlt auch Lketinga ist.
Eine halbe Stunde vor Abfahrt treffen wir, begleitet von zwei weiteren Massai, im Hotel ein. Die verschlafenen, wartenden Weißen schauen uns irritiert an. Mit meiner Reisetasche und den drei geschmückten Massai mit ihren Rungus muß ich wohl ein sonderbares Bild abgeben. Dann muß ich einsteigen. Lketinga und ich fallen uns noch einmal in die Arme, und er sagt: „No problem, Corinne! I wait here or I come to you!“








