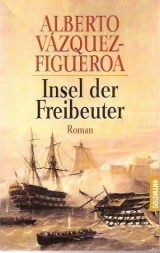
Текст книги "Insel der Freibeuter"
Автор книги: Alberto Vazquez-Figueroa
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
»Könnt Ihr mir den Gefallen tun und diesen Brief meinem Verlobten überbringen?« bat sie inständig. »Sie haben ihn vor einem Jahr eingezogen, und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Die Schiffe kommen bei ihrer Rückkehr aus Westindien hier nicht vorbei.«
Sebastian nahm das grobe Papier, auf dem mit fast kindlicher Schrift zu lesen stand: »Pompeyo Medina. Westindien.«
»Aber in welchem Teil Westindiens ist er denn?« wollte er wissen.
»Das weiß ich nicht«, entgegnete das Mädchen mit rührender Offenheit. »Doch Westindien kann ja nicht sehr groß sein, und ich bin sicher, daß Ihr ihn findet. Er ist groß, hat braune Haare, riesige dunkle Augen und am Kinn ein tiefes Grübchen.« Sie zeigte ein faszinierendes Lächeln, als sie fragte: »Werdet Ihr ihm meinen Brief geben?«
»Ich werde tun, was ich kann«, versprach der Margariteno.
»Danke!«
Schon auf dem Rückweg drehte sie sich nach hundert Metern noch einmal um und rief ihnen fröhlich zu:
»Und sagt ihm, daß ich immer auf ihn warten werde. Immer!«
Dann verschwand sie endgültig, ohne sich noch einmal umzudrehen. Sebastian blickte ihr nach, als hätte er gerade eine Fata Morgana erlebt.
Als er schließlich zurückkam, scharten sich seine Männer erwartungsvoll um ihn.
»Was wollte diese Verrückte?« fragte Lucas Castano geradezu neugierig.
Sebastian zeigte ihm den Brief:
»Wahrscheinlich ein Jahr weiterträumen.«
Als sie drei Tage später die Jacare endlich wieder zu Wasser ließen und Kurs nach Süden einschlugen, stieß der neue Kapitän einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus, daß die Gefahr vorüber war, doch fragte er sich noch oft, wie es so seltsame Orte wie diese Insel geben konnte und so unschuldige Mädchen wie das mit dem Brief.
Ein steifer Nordostwind trieb sie, ohne daß sie sich groß anstrengen mußten, nach Westen. Über dem ruhigen, dunklen Meer wölbte sich ein klarer, wolkenloser Himmel. Und so gingen die Tage friedlich dahin, bis der Ausguck einen treibenden Leichnam direkt voraus meldete.
Sie betrachteten ihn, während er langsam steuerbord vorbeitrieb.
Es handelte sich um die von Fischen schon sehr angenagte Leiche eines mageren Jungen, der schon einige Tage im Wasser gelegen haben mußte. Der Zwischenfall wäre nicht unbedingt der Rede wert gewesen, wäre nicht drei Stunden später ein neuer Toter aufgetaucht. Und auf diesen folgte ein weiterer, und wieder einer, bis man von einer wahren Prozession von Leichen hätte sprechen können, die mit dem Gesicht nach unten in einem immer ruhigeren Meer dahintrieben.
Und alle waren schwarz.
Männer, Frauen und Kinder. Alle schwarz.
Einigen hatten die in der Umgebung kreisenden Haie einen Arm oder ein Bein abgerissen, und bei einem kleinen Mann schwammen die blutigen Eingeweide wie eine Familie von Quallen herum.
Selbst die rauhen Seewölfe, die an Gewalt und Tod gewöhnt waren, glaubten einem dantesken Schauspiel beizuwohnen, denn eines war klar: Die Menschen waren keines gewaltsamen Todes gestorben, sondern zweifellos unschuldige Opfer eines tragischen Schiffbruchs, der keinen verschont hatte.
Bald mußten sie jedoch feststellen, daß keine Spur eines Schiffbruchs zu entdecken war. Keine Planke, nicht einmal ein leeres Faß oder ein Segelfetzen… Nichts!
Nur Tote.
»Ein Sklavenschiff«, rief plötzlich Nick Cararrota aus.
Sebastian Heredia wandte sich dem häßlichen Malteser zu, der als bester Fechter an Bord galt und von dessen bewegter Vergangenheit man nur so viel wußte, daß er alles getan hatte, was auf dieser Welt nur verboten oder illegal sein konnte.
»Was soll das heißen, ein Sklavenschiff?« wollte er wissen.
»Daß vor uns wahrscheinlich ein Schiff fährt, das Sklaven aus Senegal geladen hat.« Der narbengesichtige Kerl spuckte in Richtung einer der Leichen aus. »Wenn die Ware krank wird, wirft man sie über Bord, noch bevor sie den Löffel abgegeben hat.«
»Warum das denn?«
»Wenn sie halbtot im Hafen ankommt, kauft sie keiner, und wenn sie an Bord stirbt, zahlt die Versicherung nicht.« Er fletschte seine schlechten Zähne wie ein hungriger Wolf. »Wenn der Kapitän die Kranken aber ins Wasser wirft, damit sie die übrige Fracht nicht anstecken, wird das als legal angesehen, und die Versicherung ersetzt die Auslagen.«
»Bist du sicher?« fragte Lucas Castano verblüfft. »Sollen wir vielleicht glauben, daß es eine Versicherung für solche Risiken gibt?«
»Natürlich! In London.«
»Und woher weißt du das?«
Der Malteser begnügte sich mit einem Schulterzucken und grinste fast belustigt, während er ironisch fortfuhr:
»Ich verstehe schließlich mein Metier «
»Bist du mal auf einem Sklavenschiff gefahren?«
»Nur ein einziges Mal«, gab Cararrota ohne jegliche Scham zu, »und ich kann dir sagen, man verdient dabei zwar Geld wie Heu, aber es ist der elendste Beruf, den ich kenne. Und ich kenne verdammt viele! Nicht um alles Geld in der Welt würde ich noch einmal auf einem dieser verfluchten Schiffe anheuern.«
Der Wind schlief ein.
Und es wurde Nacht.
Das Meer verwandelte sich in einen riesigen Spiegel, in dem bald der Mond glänzte, und es schien, als hätten sich alle Elemente verschworen, den Männern der Jacare ein immer höllischeres Spiel zu bieten.
Über die Reling gebeugt betrachtete Sebastian die halbe Nacht lang ein versteinertes Meer. Jeden Augenblick fürchtete er eine neue phosphoreszierende Masse zu sehen, denn um die Leichen wimmelten so viele winzige Fische im Wasser herum, daß es gespenstisch im Mondlicht leuchtete.
Er konnte es einfach nicht fassen, daß ein Mensch so tief sinken konnte, einen kranken Jungen lebendig ins Wasser zu werfen, um für dessen Leben ein paar Pfund von einer Versicherung einzustreichen.
»Die haben es nicht verdient zu leben«, sagte er zu sich selbst. »Die haben es wirklich nicht verdient.«
Kurz vor Sonnenaufgang war in der Ferne ein Stöhnen zu hören. Der Ausguck riß Lucas Castano aus dem Schlaf, und dieser weckte wiederum den Margariteno auf. Sebastian befahl sofort, Fackeln zu entzünden, Schaluppen ins Wasser zu lassen und nach etwaigen Schiffbrüchigen zu suchen.
Sehr schnell hatten sie ihn gefunden. Es war ein riesiger Schwarzer, der aber so erschöpft und starr war, daß er, kaum an Bord gezogen, in eine Ohnmacht fiel, aus der er erst am Vormittag erwachte.
Sein Bericht, den er in einer seltsamen Mischung aus englischen, spanischen und portugiesischen Wortfetzen stammelte, gespickt mit zahlreichen Wörtern aus irgendeinem gottverlassenen afrikanischen Land, bestätigte die Aussage des Maltesers. Das einzige, was man wirklich verstehen konnte, war, daß der Kapitän ihn wegen unaufhörlichen Durchfalls über Bord hatte werfen lassen.
Als sie wissen wollten, wie viele Leute an Bord waren, konnte er noch nicht einmal eine ungefähre Zahl nennen.
»Muita!« war alles, was er sagte. »Muita people!«
Sebastian Heredia ging zu seiner Kajüte zurück und dachte über das Gehörte nach. Schließlich steckte er seinen Kopf wieder heraus und gab einen barschen Befehl:
»Die Masten hoch und alle Segel setzen! Wir machen Jagd auf diese Hurensöhne.«
Das Sklavenschiff konnte nicht viel Vorsprung haben, doch wehte nicht die leiseste Brise, was das Segeln auch für ein so behendes Schiff wie die Jacare zum aussichtslosen Unterfangen machte. Allein von dem Augenblick, in dem man in der Ferne voraus einen Leichnam ausmachen konnte, bis zu dem Moment, da dieser sich achtern aus den Augen verlor, verging eine Ewigkeit.
Plötzlich fiel dem Margariteno eine Geschichte ein, die seine Mutter ihm erzählt hatte: das Märchen vom kleinen Jungen, der sich im Wald verirrt und Steinchen streuend den Rückweg findet.
Das Sklavenschiff hinterließ eine ähnliche Spur und verriet damit seine genaue Route, und tatsächlich entdeckte der Ausguck schließlich erfreut im Westen einen Punkt am Horizont.
Bei Anbruch der Nacht hatten sie das Schiff allerdings noch immer nicht erreicht, und als es dunkel wurde, drehte der Verfolgte unvermittelt nach Süden ab, um ihnen auszuweichen. Doch jetzt half ihnen ein rächender Vollmond, in dessen Licht sie das Sklavenschiff sehen konnten, bevor es sich backbord davonstehlen konnte.
Im Morgengrauen waren sie nur eine knappe Meile von seiner Steuerbordseite entfernt. Bald wehte ein dermaßen grauenvoller Gestank herüber, daß selbst einige der erfahrensten Seeleute, die mit Gleichmut die schlimmsten Stürme ertrugen, kurz davor waren, sich zu übergeben.
»Aber was ist denn das?« wollte Zafiro Burman wissen. »Was ist das nur für ein Gestank?«
»Der Duft der Sklavenschiffe«, entgegnete in aller Seelenruhe der Malteser. »Er hat mich monatelang verfolgt, obwohl ich mir die Kleider vom Leib gerissen, das Haar abrasiert und mich hundertmal gebadet habe. Wie ich schon sagte: die elendste Arbeit auf Erden.«
Kurz vor Sonnenaufgang ließ Kapitän Jacare Jack die Krokodilsflagge mit dem Totenkopf hissen und einen Warnschuß vor den Bug des schwarzen Schiffs setzen, das alle an Bord für den riesigsten, häßlichsten und schwerfälligsten Seelenverkäufer hielten, der je auf den Weltmeeren gesegelt war.
Kein Schoner, keine Brigantine, keine Fregatte, keine Korvette, sondern eine Art Kreuzung zwischen alter Karavelle und Rumpelkasten, allerdings zu breit und zu kurz. Die drei asymmetrisch angeordneten Masten waren unterschiedlich hoch, und das ganze Schiff war ein einziges unförmiges Chaos, als hätte man es ohne jeglichen Plan und mit den unfähigsten und unordentlichsten Zimmerleuten der Küste gebaut.
Warum jemand diesen Schrotthaufen zu Wasser gelassen hatte, war ebenso unerklärlich, doch hier war er, schaukelte hin und her wie in einem Sturm, obwohl der Ozean an diesem Tag so ruhig war wie ein Ölsee.
Die Besatzung machte nicht die geringsten Anstalten, zu fliehen oder zu kämpfen. So ging die jacare längsseits, und ein halbes Dutzend Männer sprangen an Bord, als müßten sie sich kopfüber in eine Kloake stürzen. Der Geruch von heißem Schweiß, Kot und Urin schlug ihnen wie eine gewaltige Ohrfeige entgegen.
Dieses Schiff war die Hölle.
An Bord angelangt verstand man allerdings, warum die Ausrüster es auf so absurde Weise hatten bauen lassen. Das war kein Schiff, mit dem man von einem Ort zum anderen fuhr, sondern eine Art riesiger schwimmender Sarg, in dessen vier übereinanderliegenden Lagerräumen man so viele Sklaven wie möglich unter den schlimmsten Bedingungen einpferchte.
Männer, Frauen und Kinder lagen ausgestreckt auf schweren Tischen, die etwas geneigt waren, damit Urin und Exkremente zum Boden abfließen konnten. Hand– und Fußgelenke waren mit dicken Eisenketten gefesselt, so daß sie nicht die geringste Bewegung machen konnten.
Schulter an Schulter lagen sie aneinandergereiht. Kaum ein Meter Höhe trennte sie von der nächsten Menschenschicht, und das alles in einer Hitze, die über fünfzig Grad betragen mußte, und mit so wenig Luft, daß es ein Wunder war, überhaupt noch einen Menschen am Leben anzutreffen.
Die nicht minder übelriechende Besatzung bestand aus einem walisischen Kapitän und zwölf rohen Männern. Als man sie gereizt zur Rede stellte, warum sie diese armen menschlichen Wesen so grausam behandelten, schien sich der Kapitän zu erstaunen.
»Menschliche Wesen? Was für menschliche Wesen? Sind doch nur Neger!«
»Sind Neger vielleicht keine Menschen?«
»Natürlich nicht!« gab der andere mit verblüffender Sicherheit zurück.
»Was dann?«
»Sklaven.«
»Sklaven? Nichts weiter?«
»Es waren Sklaven, wir haben sie als Sklaven gekauft, und wir bringen sie nach Jamaika, um sie dort als Sklaven zu verkaufen.« Der Waliser zuckte die Schultern, als hätte er damit alles erklärt. »Was sollten sie sonst sein außer Sklaven?«
»Verstehe… Wie viele habt ihr?«
»In Dakar sind wir mit 780 aufgebrochen, doch etwa hundert sind unterwegs gestorben.«
»Gestorben, oder habt ihr sie lebendig ins Wasser geworfen?«
»Was tut das zur Sache? Sie waren krank! Wir haben ihnen Leiden erspart, als wir sie ins Meer warfen, denn sie haben sich fast zu Tode geschissen.« Der widerliche Kerl schnalzte verächtlich mit der Zunge. »Ein Sklave mit Durchfall bringt keinen müden Heller ein und macht nur Probleme.«
Der frischgebackene Kapitän Jacare Jack dachte eine lange Zeit nach, wobei er sich in einem vergeblichen Versuch, dem Gestank zu entgehen, die Nase zuhielt. Schließlich deutete er auf die übrige Besatzung, deren schwimmende, stinkende Schande man ironischerweise auf den absurden Namen Four Roses getauft hatte.
»Keiner von Euren Männern leidet an Durchfall?«
»Nicht daß ich wüßte…« beeilte sich sein Gegenüber mit der Antwort, sichtlich pikiert.
»Schade, denn sonst hätte ich einen wunderbaren Grund gehabt, euch alle über Bord werfen zu lassen.« Er machte eine kurze Pause, während der er sich genüßlich am Kopf kratzte, und fuhr schließlich im gleichen Ton fort. »Aber wenn ich’s mir recht überlege, brauche ich gar keinen Vorwand. Ich lasse euch ins Meer werfen, weil ihr alle Hurensöhne seid.«
»Das könnt Ihr nicht machen!« protestierte der Kapitän. »Wir haben uns ergeben, und die Gesetze der Piraten sehen vor…«
»Von Sklavenschiffen steht nichts in den Vorschriften der Bruderschaft der Küste, deshalb tu ich, was mir gefällt. Wem gehören die Sklaven?«
Der Waliser zögerte einige Augenblicke, doch dann schien er zu begreifen, daß ihm Lügen hier nicht weiterhalf, und antwortete mißmutig:
»Der Casa de Contratación in Sevilla.«
Jetzt schien der Margariteno überrascht zu sein. Er und Lucas Castano, der neben ihm stand, schauten sich erstaunt an, und er entgegnete schließlich mit Härte: »Das ist gelogen. Die Gesetze verbieten es der Casa, mit Sklaven zu handeln.«
»Das mag schon sein, aber ich arbeite seit fünf Jahren für sie. Nicht offiziell, aber wenigstens drei ihrer Gesandten zählen zu den Ausrüstern des Schiffs.«
»Wer alles?«
»Das kann ich Euch nicht sagen.«
»Natürlich könnt Ihr das!« erregte sich der Margariteno. »Ich lasse Euch so oder so ins Meer werfen, doch gibt es zwei Arten: mit oder ohne hundert Peitschenhiebe.« Er drohte mit dem Finger. »Also sagt mir diese Namen!«
Der Waliser zögerte aufs neue, blickte seine Männer an und kam zu dem Schluß, daß er ausgespielt hatte. Er murmelte mit einer fast unmerklichen Geste des Gleichmuts:
»Gines Alvarado, Hernando Pedrárias und Borja Centeno.«
»Pedrárias Gotarredona, der Gesandte auf Margarita?« Da der Kapitän heftig nickte, drang Jacare Jack weiter. »Seid Ihr sicher?«
»Ihm lege ich einmal im Jahr Rechenschaft ab.«
»Wie sieht er aus?«
»Mittelgroß, kräftig, blond und mit sehr hellen Augen.«
»Kennt Ihr seine Frau?«
»Verheiratet ist er nicht, aber er lebt mit einem Weib zusammen, das sehr schön sein muß.«
»Hat er Kinder?«
»Eine Tochter.« Der Waliser legte eine kurze Pause ein und fuhr fort: »Eigentlich ist sie fast schon eine Frau.« Abschätzig verzog er den Mund. »Offensichtlich aber nicht seine Tochter, sondern die der Hure.«
»Ich sehe, Ihr sagt die Wahrheit.« Der Margariteno wandte sich zu Lucas Castano und befahl ihm ohne leisestes Zögern: »Ab ins Meer mit ihm!«
Ohne Umschweife packte der Angesprochene den Waliser, der keinerlei Widerstand leistete, am Kragen, schleifte ihn an die Bordkante und warf ihn ins Wasser.
Sebastian Heredia sah zu, wie der Kapitän abtrieb und dabei schweigend mit den Armen ruderte. Dann wandte er sich der übrigen, zu Tode erschrockenen Mannschaft der Four Roses zu, und nachdem er die vier Fähigsten ausgewählt hatte, verkündete er mit ungerührtem Ton:
»Diese vier folgen mir mit dem Schiff. Der Rest der Mannschaft wird dem Kapitän Gesellschaft leisten. Anschließend befreit ihr die Sklaven und laßt sie an Deck.«
»Sie passen nicht alle drauf«, gab Nick Cararrota zu bedenken. »Und wenn du sie freiläßt, werden sie sich auf uns stürzen. Es sind verdammt viele.«
Jacare Jack dachte einige Augenblicke nach, dann ließ er den riesigen Schwarzen an Bord kommen, den sie in der Nacht zuvor gerettet hatten, und erklärte ihm, so gut er konnte, daß er sie auf dem Festland absetzen wollte.
»Wenn ihr tut, was ich euch sage, werdet ihr frei sein und könnt ein neues Leben anfangen. Aber wenn ihr Probleme macht, dann schicke ich euch mit Kanonenschüssen auf den Grund des Meeres. Ist das klar?«
Der andere nickte, stieg in die Laderäume hinab und blieb eine lange Weile unten. Als er zurückkehrte, lächelte er glücklich.
»Wenn du ihnen die Ketten abnimmst, werden sie der Reihe nach Luft schöpfen. Es wird keine Probleme geben.«
»Also einverstanden!« Der Margariteno wandte sich den vier Sklavenhändlern zu, die ihn mit einem Funken Hoffnung in den Augen betrachteten. »Folgt unserem Kielwasser! Wenn ihr eure Sache gut macht, könnt ihr vielleicht eure Haut retten. Ansonsten wißt ihr, was euch erwartet.«
Minuten später löste sich die Jacare von der Four Roses und setzte ihre langsame Fahrt nach Westen fort. Das stinkende Schiff folgte ihr mit einer guten Meile Abstand. Auf dem Deck wimmelte es nunmehr von schwarzen schwitzenden Körpern, die fröhlich mit den Händen winkten, während sie ein seltsames Danklied anstimmten.
Im Kielwasser des Sklavenschiffs blieben der walisische Kapitän und acht seiner Männer zurück, die verzweifelt mit den Armen ruderten, um sich über Wasser zu halten, während um sie herum bereits die Haie zu kreisen begannen.
Wieder allein in seiner Kajüte, betrachtete Sebastián durch die Achterluke das grausige Schiff, das mit einer guten Meile Abstand dem Kielwasser der Jacare folgte, und dachte lange Zeit über die Ereignisse des Tages nach. Besonders machte ihm zu schaffen, daß der Mensch, der sein Leben und das unzähliger Margaritenos zerstört hatte, sich nicht nur als Tyrann, sondern jetzt auch als Sklavenhändler erwiesen hatte, der sich mit dem Leiden Hunderter dieser Menschen bereicherte.
»Sind doch nur Neger!«
Diese verächtliche Bemerkung wollte ihm nicht aus dem Kopf gehen. Zwar hatte er schon als Kind die Sklaverei in den Kolonien als etwas Normales erlebt, doch wie haltlos diese schreiende Ungerechtigkeit war, hatte er bisher noch nicht nachvollziehen können.
Die wenigen Sklaven, die er bislang kennengelernt hatte, standen auf der sozialen Leiter kaum tiefer als die meisten Fischer von Juan Griego, die unter den harten Gesetzen der Casa de Contratación ihr Leben fristen mußten. Niemals war ihm in den Sinn gekommen, daß man diese Unglücklichen gewaltsam aus ihrem Heim und dem Kreis ihrer Familie gerissen hatte, um in den Besitz einer jeden Person überzugehen, die bereit war, den Preis dafür zu bezahlen.
»Neger« war auf Margarita stets gleichbedeutend mit »Sklave« gewesen, aber erst, seit er gesehen hatte, wie man sie wie wilde Tiere unter Deck der Four Roses einpferchte, war Jacare Jack klargeworden, was Sklaverei wirklich bedeutete.
Nicht einmal Schweine zerrte man so zum Schlachthof. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben wurde dem blutjungen Kapitän bewußt, daß die Gesellschaft sich nicht in Reiche und Arme, Priester und Piraten, Soldaten und Zivilisten teilte.
Unterdrücker und Unterdrückte, das kam der Sache schon viel näher, und das, was Sebastian an diesem Morgen beobachtet hatte, legte den Schluß nah, daß die Gier der Unterdrücker keine Grenzen kannte. Schließlich gab es Männer wie Hernando Pedrárias, denen eine fast absolute Macht nicht zu reichen schien, da sie zu den unvorstellbarsten Ungerechtigkeiten fähig waren, um dadurch noch ein wenig reicher zu werden.
Sebastián fragte sich, ob er, Anführer einer ruchlosen Bande von Seewölfen, so tief sinken könnte, mit Menschen zu handeln, und kam zu dem Schluß, daß er zwar ohne Skrupel acht Menschen in den Tod schicken konnte wie vorhin, doch allein bei dem Gedanken, auch nur einen der wehrlosen Afrikaner zu verkaufen, wurde ihm übel, auch wenn viele von ihnen, wie Cararrota versicherte, die Sklaverei als völlig selbstverständliche Lebensweise akzeptierten.
»Die meisten werden schon als Sklaven ihrer Stammeshäuptlinge geboren«, hatte er einmal erläutert. »Eigentlich ändert sich nur die Hautfarbe ihres Herrn, und oft werden sie von den Weißen schonungsvoller behandelt. Das Schlimmste ist stets die Überfahrt, da die Händler den größten Profit herausschlagen wollen und aus den Schiffen wahre Tierkäfige machen.«
»Würde es dir vielleicht gefallen, Sklave zu sein?« fauchte ihn Lucas Castano mißmutig an.
»Was bin ich anderes gewesen, bevor ich mich dazu entschlossen habe, Wegelagerer, Sklavenhändler oder Pirat zu werden?« gab der andere bitter zurück. »Von früh bis spät habe ich mich für einen Hungerlohn abgerackert, und von der Hautfarbe abgesehen ging es mir kaum anders als diesen Unglücklichen.« Er warf seinen Zuhörern einen griesgrämigen Blick zu, um in einem fast vorwurfsvollen Ton zu schließen: »Wer von euch noch nie in ähnlicher Weise ausgebeutet worden ist, der soll die Hand heben.«
Keiner meldete sich, und wenn Sebastian an die harten Zeiten dachte, in denen die verwünschte Casa de Contratación von seinem Vater verlangte, ein ums andere Mal zwischen den Haien nach Perlen zu tauchen, die sie ihm dann zum läppischen Preis von Perlmutt abkaufte, mußte er zugeben, daß der Malteser tatsächlich recht hatte und sich ihr damaliges Leben nur wenig von dem eines beliebigen afrikanischen Sklaven unterschied.
Als sie eine Woche später endlich die Küste des Festlands erblickten, ließ der Kapitän daher eine Abordnung der Schwarzen an Bord der Jacare kommen, die als Älteste unter ihren Gefährten das größte Ansehen genossen.
»Ich habe beschlossen, euch im Golf von Paria an Land zu bringen. Dort könnt ihr in den Wäldern der Orinoco-Mündung verschwinden. Ihr bekommt Waffen, damit ihr überleben könnt.« Er musterte sie der Reihe nach, während er fortfuhr: »Den Spaniern wird es gar nicht gefallen, eine Gruppe geflohener Sklaven frei herumlaufen zu sehen, denn wenn sich das herumspricht, werden sich euch viele Sklaven anschließen. Ihr müßt eure Freiheit mit Blut und Feuer verteidigen. Doch dafür müßt ihr euch erst einmal einen Anführer wählen, denn mehr kann ich nicht mehr für euch tun.«
»Du hast schon so viel getan«, warf der große Schwarze ein, den sie aus dem Meer gerettet und auf den passenden Namen Moises getauft hatten. »Du hast uns das Leben gerettet, dafür werden wir dir ewig dankbar sein.«
»Am besten dankt ihr mir, indem ihr euch nicht noch einmal versklaven laßt«, entgegnete der Margariteno lächelnd. »Ich sehe, daß ihr unterschiedlichen Stämmen angehört und viele verschiedene Sprachen sprecht, doch werdet ihr nur frei sein, wenn ihr eure Unterschiede für immer vergeßt.«
»Wie viele Verfolger wird man schicken?«
»Keine Ahnung«, räumte Sebastian Heredia ein, »doch es werden einfache Soldaten sein, die Urwald und Hitze hassen. Daher werden die Sümpfe stets eure besten Verbündeten sein. Laßt euch auf keine offene Schlacht ein, sondern lockt die Verfolger immer tiefer ins Dickicht, bis sie der Suche müde sind. Dieser Kontinent ist sehr groß, und wenn ihr es schafft, daß sie euch vergessen, ist genügend Platz für alle da.«
»Wähle du unseren Anführer«, bat der älteste der Sklaven, wobei er bedeutungsvoll auf Moises blickte. »Keiner wird deine Entscheidung in Frage stellen.«
Der junge Kapitän wandte sich den Gefährten des Schwarzen zu.
»Seid ihr damit einverstanden?«
Schweigend nickten sie.
»Na schön! Wenn das so ist, wähle ich Moises. Er hat viel Mut bewiesen, als er sich über Wasser hielt, während die Haie um ihn kreisten, und ich bin sicher, daß er euch mit ebensoviel Mut zum Sieg führen wird. Gott mit euch!«
»Welcher Gott?«
Jacare Jack musterte verblüfft den kleinen Mann, der eine so merkwürdige Frage gestellt hatte, und zuckte schließlich die Schultern.
»Alle Götter. Je mehr, desto besser. Ihr werdet sie brauchen.«
Am Abend gingen sie in einer stillen und einsamen Bucht vor Anker, die von dichter Vegetation umgeben war. Dann brachte man die Sklaven der Reihe nach an Land. Viele aber zogen es vor, sich kopfüber ins Wasser zu stürzen und fröhlich zum Strand zu schwimmen. Nachdem man ihnen alles übergeben hatte, was man an Waffen, Munition und Proviant gefahrlos entbehren konnte, setzte die Jacare ihre Fahrt fort, nach wie vor mit der langsamen und stinkenden Four Roses im Kielwasser.
Ohne seine menschliche Fracht erinnerte das Sklavenschiff an eine auf dem Wasser schaukelnde Nußschale. Sie hatte so wenig Tiefgang, daß man so gut wie keine Segel setzen konnte aus Angst, das wie eine Feder im Wind manövrierunfähig treibende Schiff würde kentern.
Nach vier mühsamen Tagen ließ man den unförmigen Pott mitten in der Bucht von Porlamar vor Anker gehen. Auf dem einzigen Segel, das er gehißt hatte, stand mit riesigen ungelenken Buchstaben geschrieben zu lesen: »Pedrárias, Sklavenhändler. Das ist dein Schiff.«
Sofort strömten fast alle Einwohner am Strand zusammen.
Über Stunden hinweg verharrte die Roses an Ort und Stelle, damit auch die Bewohner der benachbarten Dörfer herbeieilen konnten, um sie zu sehen. Die Kanonen der Jacare – die in sicherer Entfernung beigedreht hatte – sorgten in der Zwischenzeit dafür, daß niemand das riesige Segel bergen konnte. Kurz vor Sonnenuntergang feuerten die gleichen Kanonen auf das Schiff, und wenige Augenblicke später brannte der düstere Sarg wie Zunder.
Seine vier Mann Besatzung stürzten sich rechtzeitig ins Wasser und schwammen langsam zur Küste, wo sie unverzüglich von einer Abteilung Soldaten abgeführt wurden. Als der stinkende Pott schließlich vollständig untergegangen war, lichtete die Jacare die Anker und ging auf Kurs Nordost.
In der folgenden Nacht näherte sich eine Schaluppe in aller Stille der Festung La Galera. Mit drei seiner besten, bis an die Zähne bewaffneten Männer sprang Sebastián Heredia an Land, stieg still und leise die breite Steintreppe empor und klopfte diskret an die Pforte von Hauptmann Sancho Mendana.
Der Offizier schien nicht überrascht zu sein, ihn zu sehen.
»Hab dich schon erwartet«, murmelte er lächelnd. »Ich habe mir gedacht, daß du vorbeikommen wirst nach all dem Zirkus, den dein Schiff in Porlamar veranstaltet hat.«
»Hat sich ja schnell herumgesprochen.«
»Auf der ganzen Insel redet man von nichts anderem mehr.«
»Pedrárias, der Sklavenhändler.«
»Wenn das stimmt, ist er seinen Posten los.«
»Es stimmt…«, befand der Margariteno, um unvermittelt das Thema zu wechseln und gespannt zu fragen: »Habt Ihr meinen Vater gesehen?«
Hauptmann Mendana nickte.
»Eines schönen Tages stand er vor eurem alten Haus und wollte die jetzigen Bewohner hinauswerfen. Ich habe es geschafft, daß sie ihn nicht angezeigt haben, und ihn mit einem Freund nach Boca del Rio geschickt, doch seit zwei Wochen ist er verschwunden.«
»Glaubt Ihr, daß er meine Mutter sucht?«
»Gut möglich.«
»Weiß Pedrárias, daß er wieder auf der Insel ist?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber dieser gottverdammte Hurensohn hat seine Augen und Ohren überall. Früher oder später erfährt er es doch.«
»Ich muß meinen Vater vor Pedrárias finden.«
Der Offizier machte es sich in einem zerschlissenen Lehnstuhl bequem, zündete sich bemerkenswert bedächtig seine riesige Pfeife an, und als der Tabak richtig brannte, erwiderte er.
»Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen, doch versprechen kann ich nichts. Pedrárias haßt mich und wird jeden Vorwand nutzen, mich abzusetzen.« Er schnalzte mit der Zunge und verzog angewidert seinen Mund. »Und die Zeiten sind schlecht für Leute ohne Einkommen.«
»Das waren sie immer.«
»Heute ist es schlimmer. Die Casa setzt Sklaven ein, um nach Perlen zu tauchen, und obwohl die meisten dabei krepieren oder ersaufen, sind es so viele, daß die traditionellen Taucher keine Arbeit mehr haben. Ganze Familien mußten auswandern, um nicht zu verhungern.«
»Und keiner tut was?«
»Was sollten sie schon tun? Pedrárias ist hier wie ein Vizekönig, und wenn man ihm nicht sicher nachweisen kann, daß er wirklich ein Sklavenhändler ist, wird keiner ihm die Macht entreißen.«
»Es war sein Schiff, das ich versenkt habe.«
Hauptmann Mendana musterte ihn, ohne seine Verblüffung zu verbergen.
»Du willst das gewesen sein? Nach allem, was erzählt wird, hat Kapitän Jacare Jack den Pott versenkt. Wenigstens war es sein Schiff.«
Die Antwort des Jungen klang ungewöhnlich ernst:
»Um Euch zu belügen verdanke ich Euch zu viel, und ich bin sicher, Ihr werdet es niemandem weitererzählen, was ich Euch jetzt sage.« Sebastián machte eine kurze Pause, bevor er leise hinzufügte: »Inzwischen bin ich Kapitän Jacare Jack, und das Schiff gehört mir.«
Der Offizier brauchte eine Weile, bevor er einen leisen erstaunten Pfiff ausstieß, musterte sein Gegenüber von Kopf bis Fuß, als fiele es ihm unendlich schwer zu akzeptieren, daß jener kleine Junge, dem er manche schmerzhafte Kopfnuß verpaßt hatte, heute ein gefürchteter Piratenführer war. Beiläufig, als hätte das alles nicht die geringste Bedeutung, fuhr er fort:
»Das ändert die Lage, und wenn ich dich noch einmal auf der Insel erwische, laß ich dich aufhängen.«
»Das weiß ich.«
»Niemals hätte ich geglaubt, daß so was aus dir werden würde«, versetzte Sancho Mendana mit sichtlichem Bedauern. »Es hat mir gefallen, dich als meinen eigenen Sohn anzusehen, und obwohl ich zugeben muß, daß sie dich dazu getrieben haben, kann ich einfach nicht akzeptieren, daß aus dir etwas geworden ist, was ich verabscheue.«
»Verabscheut Ihr die Piraten mehr als die Beamten der Casa oder die Sklavenhändler?«
»Nicht mehr, aber ebenso. Die ehrlichen Menschen in diesem Teil der Welt leben in ständiger Furcht, daß Leute von eurem Schlag sie mitten in der Nacht überfallen, ihre Frauen schänden, ihre Söhne umbringen und ihre Häuser anzünden. Kein Pirat, nicht einmal du, verdient etwas anderes als eine Schlinge um den Hals.«
»Tut mir leid, Euch so sprechen zu hören«, entgegnete der Junge betrübt. »Ich schätze Euch.«
»Ich dich auch. Doch du bist es, der sich außerhalb des Gesetzes gestellt hat.«
»Gesetz?« klagte der Margariteno. »Was für ein Gesetz? Das Gesetz, das mir alles genommen hat, was ich besaß?«
»Deine Mutter hat dich aus freien Stücken verlassen, und ich denke, es gibt kein Gesetz dagegen«, gab ihm der andere zu bedenken und legte die Pfeife zur Seite, als wollte sie ihm plötzlich nicht mehr schmecken. »Es war bestimmt nicht gerecht, deinen Vater einzusperren, darum habe ich euch auch bei der Flucht geholfen, aber zu akzeptieren, daß du zum Piratenkapitän wirst, ist was ganz anderes. Geh in dich! Noch ist es Zeit.«
Sebastián Heredia schüttelte den Kopf.







