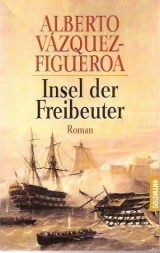
Текст книги "Insel der Freibeuter"
Автор книги: Alberto Vazquez-Figueroa
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
»Ich nehme es. Aber nur so lange, wie es dauert, das Herrenhaus zu errichten, das wir gesehen haben.«
»Die Negrita von Bardinet?« fragte der andere entsetzt. »Das ist nicht Euer Ernst!«
»Das ist mein voller Ernst.«
»Aber dieses Haus ist verflucht.«
»Die Herrin war verflucht, nicht das Haus. Könnt Ihr es mir verschaffen?«
»Natürlich!« kam es wie aus der Pistole geschossen zurück. »Ich kann Euch sogar die ursprünglichen Baupläne besorgen. Den Bau übernehmen wir.«
»Dann gibt es nichts mehr zu bereden. Wir sind uns einig.«
Zurück auf der Jacare berichtete er seinem Vater und seiner Schwester in Anwesenheit von Lucas Castano von der Abmachung, die er getroffen hatte.
»La Negrita zu bauen, zu möblieren und einzurichten wird euch die Zeit vertreiben«, schloß er. »Und ich kann euch versichern, das ist der schönste Ort, den ihr jemals gesehen habt.«
»Was wird das alles kosten?« fragte Celeste sofort.
»Das ist meine Angelegenheit.«
»Aber hast du denn genug Geld?«
»Falls nicht, werde ich es mir beschaffen«, lautete die gelassene Antwort. »Es geht das Gerücht um, daß sich eine große Armada versammelt, um die spanische Flotte abzufangen, wenn sie Kuba verläßt. Wir könnten uns anschließen.«
»Weißt du, was das bedeutet?« warf der Panamese ein.
»Das weiß ich«, erwiderte Sebastián Heredia. »Das heißt, daß unsere Flagge neben denen der Korsaren flattern wird, was der Alte stets verabscheut hat. Aber was können wir sonst tun, wenn die Männer keine Lust mehr haben, Frachtschiffe anzugreifen. Allein können wir es weder mit der Flotte aufnehmen noch eine Festung angreifen. Oder etwa doch?«
»Nein. Natürlich nicht«, räumte sein Stellvertreter ein. »Aber wenn ein Korsar den Angriff auf die Flotte leitet, wird das ein Massaker, aus dem wir kaum einen Vorteil ziehen werden.« Er deutete auf die Galeone, die nicht weit vor Anker lag. »Wenn allerdings De Graaf der Anführer ist, können wir darüber nachdenken. Er ist schlau, und Gold interessiert ihn mehr als Blutvergießen.«
»Kennst du ihn?«
Lucas Castano machte eine Geste, als wolle er nicht zuviel verraten.
»Ich habe mal mit ihm gesprochen. Der Alte schätzte ihn, und sie haben sich oft gemeinsam betrunken.«
»Ich kann es nicht glauben, daß ihr Pläne schmiedet, die Flotte anzugreifen oder mit dem Abschaum der Welt gemeinsame Sache zu machen«, warf Miguel Heredia unvermittelt ein. Es mußte ihm sehr unangenehm sein, dem Sohn offen entgegenzutreten. »Bist du dir im klaren, wohin dich das führen kann?«
»Daß ich ein richtiger Pirat werde, Vater. Das haben wir doch schon diskutiert«, lautete die säuerliche Antwort. »Du mußt das ein für allemal begreifen: Was ich mache, mache ich richtig. Schau dich doch um! Abgesehen von diesen vier Zuckerschonern siehst du hier nur Piratenschiffe. Wir können nur mit den Wölfen heulen.«
»In diesem Fall sollten wir fortsegeln…« murmelte Celeste.
»Wohin denn?« fragte ihr Bruder. »Martinique ist mehr oder weniger das gleiche auf französisch. Tortuga ist bloß noch eine Ruine, ein armseliges Banditennest, und überall sonst flattert die spanische Fahne, was heißt, daß man uns dort jeden Augenblick aufhängen könnte.« Er tätschelte zärtlich ihre Hand. »Wohin also sollen wir segeln, Kleine? Gib mir einen Tip, und ich verspreche dir, darüber nachzudenken.«
Der junge Kapitän der Jacare hatte natürlich recht. Wenn sie alle den Rest ihres Lebens in der Neuen Welt verbringen wollten, gab es nicht viele Orte, an denen nicht eines schönen Morgens der Galgen auf sie wartete.
Wenn sich ein neuer Nachbar in irgendeiner spanischen Besitzung in Übersee niederließ, dann holte die Casa de Contratación von Sevilla erst einmal Informationen über Vorfahren und Herkunftsort ein und verglich diese Daten mit denen ihres zentralen Archivs. Auf diese Weise konnte sie auch noch den letzten Einwohner der Kolonien kontrollieren.
Ohne Erlaubnis mit Unterschrift und Stempel eines Beamten der Casa war es einem Bürger fast unmöglich, von einem auch nur einigermaßen zivilisierten Ort an den anderen umzuziehen.
Es war nur zu gut bekannt, daß die Zeit, der Eifer und die bemerkenswerte Anstrengung, welche die Spanier in Westindien aufbrachten, um sich vor möglichen inneren Feinden zu »verteidigen«, nichts mit der Gleichgültigkeit gemein hatte, mit der man, wenn es darauf ankam, äußere Feinde bekämpfte. Die spanischen Richter schienen unendlich viel glücklicher dabei zu sein, einen elenden Hühnerdieb einzusperren, statt einen brutalen Freibeuter aufzuhängen, der eine Galeone voller Schätze versenkt hatte.
Dieser Widersinn lag vielleicht in der Tatsache begründet, daß besagte Richter offenbar die nicht so abwegige Meinung vertraten, daß die Bestrafung eines Hühnerdiebs andere Hühnerdiebe abschrecken würde, während ein Freibeuter, den man aufknüpfte, nicht verhinderte, daß neue Piraten neue Schiffe versenkten.
Eine attraktive junge Frau, die das unverzeihliche Verbrechen begangen hatte, sich mit über zweitausend Perlen der Casa aus dem Staub zu machen, hatte daher keinerlei Chance, irgendwo in den riesigen, von der Casa kontrollierten Territorien unbemerkt zu bleiben. Sich anderswo als auf Barbados oder Jamaika niederzulassen war daher ein unmöglicher Traum.
»Niemand von uns hätte sich je vorstellen können, Flüchtling vor dem Gesetz zu werden«, bemerkte Sebastian in der gleichen Nacht beim Abendessen, als die Musiker des Nachbarschiffs eine ihrer kurzen Pausen einlegten. »Doch genau das sind wir jetzt, und je früher wir uns damit abfinden, um so besser.«
Celeste setzte behutsam den Silberpokal ab, aus dem sie gerade trank und auf dem der Totenkopf und das Krokodil eingraviert waren, musterte ihren Bruder verwirrend lange und wollte schließlich wissen:
»Sag mir eins, und sei bitte ehrlich: Warst du schon entschlossen, ein Pirat zu werden, bevor wir uns wiedergesehen haben?«
»Natürlich! Eigentlich war ich es schon.«
»Und könnte meine Anwesenheit dazu beitragen, daß du dieses Geschäft eines Tages aufgibst?«
»Wahrscheinlich.« Der Junge deutete auf seinen Vater. »Jetzt habe ich zwei gute Gründe, mich zurückzuziehen, wenn ich genug Geld zusammen habe.«
»Gut!« sagte das Mädchen. »In diesem Fall denke ich, daß du recht hast und wir nicht mehr darüber sprechen sollten.« Sie blickte ihren Vater von der Seite an. »Unsere Aufgabe wird sein, dir den Aufenthalt an Land so angenehm zu gestalten, daß du die Lust verlierst, wieder in See zu stechen.« Sie hob den Pokal: »Auf den jüngsten Piratenkapitän der Geschichte!«
Lucas Castano unterbrach sie.
»Mach lieber den gerissensten daraus. Der jüngste Kapitän in der Geschichte war Mombars.«
»Der Todesengel?« fragte Sebastian überrascht.
»Genau der«, bestätigte der Panamese. »Mit achtzehn Jahren gehörte ihm schon ein Schiff, und er hatte höchstpersönlich über vierzig Menschen umgebracht. Schon damals war er ein Monster, mit buschigen pechschwarzen Augenbrauen und langem, braunem Kraushaar. Er sah aus wie ein Dämon aus der Unterwelt. Er trank nicht, spielte nicht, und auch Frauen rührte er nicht an. Seine Besatzung bestand fast ausschließlich aus den wildesten Indios der Region. Sein größtes Vergnügen bestand darin, einen Gefangenen aufzuschlitzen und seine Eingeweide an einen Baum zu nageln. Dann mußte der Mann losrennen, während sich seine Gedärme entrollten wie eine Schlange.«
»Gütiger Gott!« entsetzte sich das Mädchen und stellte den Pokal erneut mit zitternder Hand auf das Tischtuch. »Solche Menschen kann es doch nicht geben!«
»Und ob es die gibt!« beharrte der Panamese. »Genau so ist Mombars. Und L’Olonnois steht ihm in nicht viel nach. Beide sind sie verrückt, aber der Todesengel schießt den Vogel ab.«
»Gestern nacht hat mir eine Dirne vorgeschlagen, auf seinem Schiff anzuheuern.«
Lucas Castano schaute ihn ungläubig an:
»Soweit ich weiß, hat er sich an einen geheimen Ort zurückgezogen. Es geht sogar das Gerücht um, daß die Wilden ihn gefressen haben. So ist es L’Olonnois auf der Insel Baru ergangen. Bist du sicher, daß sie Mombars gemeint hat?«
»Das hat sie. Offensichtlich braucht er einen guten Navigator und ist bereit, dafür ein Vermögen auszugeben.«
»Das trifft sich nicht schlecht«, räumte der Panamese nachdenklich ein. »Mombars’ Problem ist immer die Navigation gewesen. Weder er noch seine verdammten Wilden haben auch nur einen Schimmer, wie man eine Seekarte liest.« Fast flüsternd, als fürchtete er, daß ihn jemand hören könnte, fuhr er fort: »Da geht es ihm wie L’Olonnois. Der hat im Lauf seines Lebens nicht weniger als vier Schiffbrüche erlitten und dabei zahlreiche Männer und viele Millionen verloren. Macht eigentlich Sinn: Wenn Mombars sich dazu entschließt, sein Versteck zu verlassen und wieder aktiv zu werden, dann braucht er zunächst mal einen guten Navigator. Und wenn er einen braucht, dann ist Port-Royal der beste Ort, um einen zu finden. Das wäre ja phantastisch!«
»Was ist daran phantastisch, wenn er so ein sadistischer Mörder ist, wie du sagst?« wollte Celeste Heredia ein wenig verwirrt wissen.
Lucas Castano blickte sie an, als ob er sie nicht gehört hätte. Sein Geist war weit weg, in irgendeine Idee vertieft, die ihm fortwährend im Kopf herumging, und als er schließlich in die Wirklichkeit zurückkehrte, schenkte er ihr ein seltsames Lächeln.
»Entschuldige! Ich war mit den Gedanken ganz woanders!«
Er nahm einen tiefen Schluck, bevor er im gleichen vertraulichen Ton fortfuhr: »Phantastisch daran ist, daß Mombars nur ans Töten, Foltern und Verstümmeln denkt. Daher hat er niemals auch nur einen Heller seines Beuteanteils verschleudert. Es heißt, daß der Ballast seines Schiffs aus peruanischen Silberbarren besteht. Trompeten, Boiler, Geschirr und Türgriffe sollen sogar aus purem Gold sein. Leute, die an Bord gewesen sind, beteuern, daß die Ira de Dios in Wahrheit ein schwimmender Märchenpalast ist.«
»Was willst du damit andeuten?« fragte Miguel Heredia. »Denkst du vielleicht daran, ihn zu berauben?«
»Wer einen Verbrecher beraubt, bekommt hundert Jahre Ablaß«, lautete die belustigte Antwort. »Und eine Flotte anzugreifen, die über dreitausend Kanonen geladen hat, ist viel gefährlicher, als es mit einem einzigen Schiff aufzunehmen, dessen Kapitän geistig nur in der Lage ist zu zerstören, und in Panama landet, wenn er nach Kuba will.«
»Du bist verrückt!«
»Verrückt?« gab der Panamese zurück. »Natürlich! Jeder, der ein Geschäft betreibt, das ihn früher oder später an den Galgen bringt, muß verrückt sein.« Er beugte sich vor, und sein Ton wurde drängender: »Überlegt euch doch nur einen Augenblick lang, ob wir nicht eine Möglichkeit finden können, diesem Idioten eine Falle zu stellen… Das wäre so, als fiele uns die halbe Flotte in die Hände.«
»Was weißt du von ihm?« wollte Celeste mit beunruhigendem Interesse wissen.
»Sicher ist nur, daß er aus einer Aristokratenfamilie im Languedoc stammt. Als Kind hat er Bartolome de las Casas gelesen und war danach überzeugt, daß alle Spanier Ungeheuer sein mußten, die aus Zerstreuung Indios vierteilen ließen. Das hat ihm offenbar den Geist verwirrt, und bald ist er mit einem Onkel, der Korsar war, aufs Meer hinausgefahren und hat aller Welt verkündet, er sei der >Todesengel<, dem Gott befohlen habe, die Spanier zu vernichten. Daher sein Name und der seines Schiffs.«
»Der >Todesengel< auf der Zorn Gottes!« murmelte Miguel Heredia sichtlich beeindruckt. »Und einen solchen Kerl willst du betrügen? Du mußt lebensmüde sein!«
»Hör mal…!« gab Lucas Castano zurück, ohne die Ruhe zu verlieren. »Das Leben hat mich gelehrt, daß sich ein >Todesengel< oft leichter betrügen läßt als ein armer Teufel, denn der arme Teufel ist stets darauf gefaßt, daß man ihn betrügen könnte, während das einem >Todesengel< nicht einmal im Traum einfallen würde. Hier ist nicht Gewalt, sondern List gefragt.« Er deutete vielsagend auf Sebastián. »Und darin bist du immer ein wahrer Meister gewesen, hier auf der Jacare.«
Nachdem er all seinen »Besitz« gegen einen schlichten Kreditbrief des jüdischen Geldverleihers Samuel eingetauscht hatte, kehrte Don Hernando Pedrárias Gotarredona nach Cumaná zurück, wo er befriedigt feststellte, daß sein getreuer Sekretär Lautario Espinosa alle Anweisungen genauestens befolgt hatte. Im nahen Golf von Paria lag eine stolze Brigg vor Anker, bewaffnet mit 32 vierundzwanzigpfündigen und 28 sechsunddreißigpfündigen Kanonen.
Ihr Kapitän, Joáo de Oliveira, ein schielender und sehr schmutziger Mann aus Lissabon, war bekannter unter dem Namen Tiradentes, da er die Gewohnheit hatte, eine schwere Verfehlung damit zu bestrafen, daß er dem Missetäter einen Zahn zog. An der Küste Brasiliens genoß er einen gewissen Ruf, weniger seiner Heldentaten wegen, sondern vielmehr, weil er der erste »Christ« war, der geradezu eine Sucht entwickelte, die bitteren Blätter zu kauen, mit denen die Indios der Anden Hunger– und Durstgefühle bekämpften. Tiradentes hatte im Bordell von Candela Fierro sein Quartier aufgeschlagen, weil er an Land keinen Schlaf fand, wenn er nicht wenigstens drei Huren im Bett hatte. Als der Ex-Gesandte der Casa de Contratación von Sevilla bei ihm auftauchte, mußte er die Mädchen förmlich mit Tritten aus dem Zimmer treiben und fand nichts dabei, noch splitternackt geräuschvoll in ein Becken zu urinieren.
»Ich versichere Euch, die Botafumeiro ist wahrscheinlich das beste Schiff auf dieser Seite des Ozeans.«
»Besser als die Jacare?« wollte Don Hernando sofort wissen. Er beugte sich aus dem Fenster und betrachtete den Fluß, um das schamlose Schauspiel hinter seinem Rücken nicht mit ansehen zu müssen.
»Ich kenne die Jacare nicht«, entgegnete der Portugiese, während er sich in aller Gemächlichkeit ankleidete. »Aber wie ich gehört habe, segelte sie mit allen Winden gut. Das kann ich auch, aber meine Feuerkraft ist doppelt so groß.« Er ließ ein Rülpsen hören, das nach billigem Fusel stank. »Der Zustand meiner Besatzung ist allerdings prekär. Ich brauche Leute.«
»Wie viele?«
»Mindestens achtzig. Vor allem Männer für Segel und Geschütze.«
»Ich glaube nicht, daß wir die in Cumaná finden werden.«
»Natürlich nicht!« bestätigte Tiradentes, zog sich die Stiefel an und sprang auf die Beine. »Das habe ich schon versucht, aber es gibt nur zwei Häfen, in denen man eine gute Mannschaft anheuern kann: Tortuga und Port-Royal. Ich persönlich bin für Tortuga.«
Die bloße Erwähnung der kleinen Insel, auf der sich pro Quadratmeter die meisten Todfeinde der Casa de Contratación von Sevilla aufhielten, war schon genug, Don Hernando Pedrárias den Magen umzudrehen. Er starrte in das spöttische Lächeln eines abstoßenden Mannes, dessen riesige Zähne die Kokablätter für immer schwarz gefärbt hatten.
»Tortuga?« wiederholte er sichtlich beunruhigt. »Haltet Ihr es für ratsam, dort vor Anker zu gehen, wo unsere Mission darin besteht, ein Piratenschiff zu verfolgen und zu vernichten?«
Der andere spuckte in das Urinbecken, ohne das fast beleidigende Lächeln abzustellen.
»Port-Royal wäre schlimmer! Alle, die vor Tortuga ankern, wären glücklich, sich gegenseitig beim geringsten Anlaß zu versenken, und kein Pirat wird den Tod eines Jacare Jack beklagen. Im Gegenteil: Sie würden auf seinem Grab tanzen. Gehen wir einen trinken.«
Dankbar begrüßte Don Hernando Pedrárias die Gelegenheit, das Zimmer, in dem es nach Schweiß, Wollust und Urin roch, verlassen zu können. Als sie im Schatten eines Samanbaums Platz nahmen, dessen Wurzeln der Fluß Manzanares umspülte, ging es ihm schon wieder besser.
Einen Augenblick lang schoß ihm jener andere Manzanares bei Madrid durch den Kopf, in dem er als Junge des öfteren mit den Söhnen des Herzogs von Alhumada gebadet hatte, und er mußte sich fragen, wie er nur so tief hatte sinken können.
Der Portugiese schien zu begreifen, daß der andere Zeit zum Nachdenken brauchte. Nach längerem Schweigen fragte Don Hernando mißmutig:
»Was ist, wenn sie mich in Tortuga an Bord entdecken?«
»Dann eröffnen sie das Feuer auf die Botafumeiro«, kam es rasch zurück. »Aber deswegen braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen, denn ich bin dort der einzige, der weiß, wer Ihr seid. Sobald Ihr an Bord kommt, müßt Ihr Euren Namen ändern.«
»Meinen Namen kann ich wohl ändern, aber nicht den Akzent. Ich spreche nur Spanisch.«
»Wahrscheinlich wimmelt es in Tortuga nur so vor spanischen Renegaten. Die meisten Steuermänner sind abtrünnige Spanier, denn sonst kämen sie in diesem Archipel nicht zurecht. Sie sind praktisch die einzigen, die Zugang zu den Seekarten der Casa hatten.«
Die berühmten Seekarten oder Routenbücher, auf denen Winde, Strömungen und gefährliche Untiefen der Karibischen See verzeichnet waren, zählten verständlicherweise zu den besonders eifersüchtig gehüteten Geheimnissen ihrer Zeit. Eine lange Abfolge erfahrener Kartographen hatte diese Routenbücher mit unendlicher Geduld auf der Grundlage der zahllosen, unschätzbar wertvollen Daten zusammengetragen, die ihnen die spanischen Seefahrer in anderthalb Jahrhunderten Navigation an den unbekannten und gefährlichen Küsten der Neuen Welt zur Verfügung gestellt hatten.
Die Navigatorenschule der Casa de Contratación war die einzige Einrichtung, die per Dekret ungehinderten Zugang zu diesem unschätzbar wertvollen Archiv hatte. Ein Navigator, der sich die wesentlichen Informationen dieser Routenbücher im Gedächtnis einprägen konnte, war daher zweifellos ein privilegierter Mann, für dessen Dienste bisweilen astronomische Summen gezahlt wurden.
Ohne die Hilfe eines solchen Mannes riskierte selbst der beste Kapitän, mitten in der Nacht auf eine der unzähligen kleinen Inseln aufzulaufen, die kreuz und quer in der gesamten Karibik verstreut waren. Korallenriffe versenkten wesentlich mehr Piratenschiffe als die Kriegsschiffe der Krone.
Einen Navigator »der Casa« an Bord zu haben war die beste Lebensversicherung, und ein Ausrüster, der auf die Dienste eines solchen Mannes zählen konnte, hatte eine wesentlich größere Aussicht, eine gute Besatzung zusammenzustellen, als einer, der sich mit einem Abenteurer begnügen mußte, der bei der geringsten Unachtsamkeit auf ein Riff laufen konnte.
»Ich werde Seine Exzellenz darum bitten, uns einen guten Navigator zur Verfügung zu stellen«, schlug Pedrárias nach einer Weile vor. »So wie ich das sehe, kommen wir sonst nicht weiter.«
»Großartige Idee. Ich habe gar nicht gewagt, sie Euch vorzuschlagen«, erwiderte der Portugiese. »Ein Mann der Küste gibt nicht gern seine Grenzen zu, aber ehrlich gesagt, in der Karibik fühle ich mich verloren.«
Seine Exzellenz Don Cayetano Miranda Portocarreo verspürte wenig Lust, seinen ehemaligen Untergebenen zu empfangen, entschied sich dann aber auf dessen Drängen doch, ihm einige Minuten seiner kostbaren Zeit zu opfern.
»Martin Prieto ist der einzige Navigator, der im Augenblick zur Verfügung steht, ein ehrenwerter Familienvater, auf den ich nicht verzichten kann. Schon gar nicht kann ich ihn verpflichten, an einem schmutzigen Piratenabenteuer teilzunehmen. Ihr werdet verstehen, daß ich Euch auch keine Routenbücher zur Verfügung stellen kann. Sie könnten schließlich in schlechte Hände fallen.« Wie es seine Gewohnheit war, blickte er auf das Bildnis von Monsignore Rodrigo de Fonseca, und fügte nach langem Nachdenken hinzu: »Ich kann Euch höchstens den Zutritt zur Krypta gestatten und Martin Prieto darum bitten, daß er Euch über die wichtigsten Routen informiert. Aber eines muß Euch klar sein: Ihr dürft nichts aufschreiben und müßt mir Euer Ehrenwort geben, daß Ihr nichts von dem, was man Euch dort zeigt, einem anderen weitergeben werdet.«
Die Krypta war ein großer, in das Felsfundament der Festung San Antonio gehauener Saal, der so hermetisch abgeschlossen war, daß man schon tonnenweise Sprengstoff gebraucht hätte, um ihn auf anderem Wege zu betreten als über eine Wendeltreppe, die durch zwei schwere Eisengitter und eine massive Holzpforte führte. Ein Soldat, der Tag und Nacht am Eingang Posten stand, hatte den strikten Befehl, das Archiv in Brand zu stecken, falls auch nur die leiseste Gefahr bestand, es könne in feindliche Hände fallen.
Im Archiv herrschte eine trockene Luft mit stets gleichbleibender Temperatur, um die unschätzbar wertvollen Dokumente vor Fäulnis zu bewahren. Jedesmal, wenn der strenge Martin Prieto eintrat, um ein Buch zu entnehmen, erhellte der Wächter mit einer Kerze den Raum, ohne auch nur einen Augenblick die Schwelle zu verlassen, und wachte streng darüber, daß der Navigator nur jeweils eine Seekarte oder ein Routenbuch mit nach draußen nahm.
Zehn Meter höher und wieder bei Tageslicht, nahmen der Navigator und Hernando Pedrárias an einem langen Tisch Platz. Mit Hilfe einer großen Vogelfeder erklärte der eine dem anderen die Merkmale der Karten und Bücher, die er dabei kaum berührte.
Den stets finster dreinblickenden Martin Prieto schien die Anwesenheit des Ex-Gesandten der Casa in gewisser Weise abzustoßen. Der Karibikexperte, der seine Lektionen auch mit geschlossenen Augen hätte erteilen können, gab sich alle Mühe, seine immensen Kenntnisse einem Neuling einzutrichtern, der kaum Steuer– von Backbord unterscheiden konnte, aber sehr wohl wußte, daß er um sein Leben lernte, und dessen graue Zellen sich daher alle Mühe gaben, diesen riesigen Berg an Kenntnissen zu verarbeiten.
Wie viele Hunderte von Inseln, Inselchen und gefährlichen Riffen es zwischen den Bahamas und Tobago oder zwischen Tampico und Martinique gab, wie groß Kuba war oder welche Winde und Strömungen die Mona-Passage zwischen Puerto Rico und Hispaniola je nach Jahreszeit beherrschten: Das alles waren Daten, die in wenigen Tagen kaum zu behalten waren, und manchmal glaubte Don Hernando Pedrárias, daß ihm der Schädel platzte.
»Wie lange habt Ihr gebraucht, um dies alles zu lernen?« fragte er Martin Prieto eines Nachts nach einer erschöpfenden Sitzung, die 15 Stunden gedauert hatte.
»Ich lerne noch immer«, lautete die ehrliche Antwort eines Mannes, der dreißig Jahre seines Lebens dem Studium gewidmet hatte. »Noch heute fühle ich mich nicht in der Lage, innerhalb der Jungferninseln zu segeln, ohne bei Anbruch der Nacht beizudrehen.«
»Wenn das so ist, was kann ich dann in zwei Wochen lernen?«
Kein Wunder, daß er keine Antwort erhielt. Nicht einmal der fähigste Schüler hätte sich in einer so kurzen Zeit mehr als nur einen flüchtigen Eindruck von den wahren Umrissen der Karibik oder den Längen– und Breitengraden der großen Inseln verschaffen können. Als Don Hernando Pedrárias daher schließlich in das Bordell von Candela Fierro zurückkehrte, war er fest davon überzeugt, nunmehr noch weniger als vorher über diesen Winkel der Welt zu wissen, in dem er lebte.
Als er dem Portugiesen gegenübertrat, bemühte er sich dennoch, unverzagt zu wirken.
»Im Augenblick habe ich eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie wir nach Tortuga kommen. Danach werden wir weitersehen.«
Drei Tage später lichteten sie die Anker. Als sie durch die Dragon-Passage zwischen Trinidad und dem Festland segelten, beschlich den Ex-Gesandten der Casa de Contratación der Verdacht, daß Joäo de Oliveira noch stark untertrieben hatte, als er den Zustand der Besatzung seines mächtigen Schiffs als »prekär« bezeichnete.
Die 41 unterernährt wirkenden Männer waren mit der schweren Takelage völlig überfordert, als sie in die heftigen Ozeanwinde gerieten. Unterdessen mühte sich ein rachitischer Mann am Steuer, das Schiff auf Kurs zu halten. Den übelriechenden Kapitän Tiradentes schien das alles aber nicht zu kratzen, sondern eher zu amüsieren. Nachdem er eine Prise Koka ausgespuckt hatte, bellte er mit sichtlicher Ironie:
»Nur Mut, ihr Hurensöhne! Wenn wir jetzt auf die Jacare stoßen, versenkt die uns mit ein paar Fürzen!«
Anschließend brach er in schallendes Gelächter aus, als wäre die Tatsache, daß das mächtige Schiff jeden Augenblick auf die Riffe der Punta las Penas auflaufen konnte, für ihn nur ein amüsanter Witz. Don Hernando Pedrárias konnte sich einen bitteren Blick auf den Bugspriet nicht verkneifen, während er sich vorstellte, wie sein Kopf wohl nach dem dritten Tag am Galgen aussehen würde.
»Verfluchte Celeste!« murmelte er immer wieder. »Tausendmal verflucht sollst du sein!«
Kurz danach mußte er sich über die Reling beugen und alles von sich geben, was er in den letzten Stunden zu sich genommen hatte. Danach zog er sich in seine enge Koje zurück. Es war ihm ziemlich egal geworden, ob die Brigg plötzlich kentern und ihn für immer auf den Grund des Ozeans schicken würde.
Joáo de Oliveira entschloß sich klugerweise dazu, um Inseln und Riffe einen großen Bogen zu machen. Er steuerte beharrlich einen Nordwestkurs und mied die Routen der Handels– und Piratenschiffe. Nur zu gut wußte er, daß er mit seiner spärlichen Besatzung einem Angriff wenig entgegenzusetzen hatte, egal, wie groß der Tiefgang und die Bewaffnung des Gegners war.
Unter keinen Umständen hätte der Kapitän dem neuen Herrn der Botafumeiro gestanden, daß der »prekäre« Zustand seiner Besatzung darauf zurückzuführen war, daß drei Viertel kurze Zeit zuvor am Dengue-Fieber gestorben waren. Nicht einmal der verzweifeltste Mann hätte unter diesen Umständen den Mut besessen, in See zu stechen.
Und jetzt wagte sich Kapitän Tiradentes ohne Navigator, mit nur wenigen Marsgasten, ohne einen einzigen Toppsgast und mit einem unfähigen Mann am Steuer, der Schlangenlinien fuhr, in eine Karibische See, die ihm völlig unbekannt war, auf der Suche nach einer Insel, von der man in allen Häfen der Welt sprach, von deren genauer Position er jedoch keinen blassen Schimmer hatte.
»Im Norden von Hispaniola«, hatte man ihm gesagt.
Na schön. Aber wo genau lag dieses Hispaniola?
Zwei Jahre zuvor hatte der schmierige Joáo de Oliveira – wie unzählige Söldnerkapitäne vor ihm – einen krassen Fehler begangen und zu einem sicherlich überhöhten Preis eine angeblich echte Seekarte erworben, auf der die Antillen exakt verzeichnet waren. Doch bald mußte er feststellen, daß er sich eine plumpe Fälschung eingehandelt hatte, oder, was noch schlimmer war, eine »spanische Fälschung«, die ihn geradewegs ins Verderben schicken konnte.
Schon seit langer Zeit hatte die Casa de Contratación nämlich die üble Angewohnheit, von Zeit zu Zeit falsche Seekarten und Routenbücher auf den »Markt« zu werfen, die in die Hände von Piraten und Korsaren fallen sollten. Wenn diese den ausgeklügelten Anweisungen folgten, zerschellten sie früher oder später auf einem der so gefürchteten Riffe.
Nur die besten spanischen Navigatoren konnten solche »Fallen« auf Anhieb entlarven. Das war der Grund, warum die »Renegaten« auf dem chaotischen Arbeitsmarkt der aktiven Seeräuberei so astronomisch hohe Summen kassierten.
Kapitän Tiradentes hatte zwar eine Karte, auf der die genaue Lage von Hispaniola und Puerto Rico verzeichnet war, doch hätte er niemals seine Hand dafür ins Feuer gelegt, daß besagte Inseln tatsächlich innerhalb der angegebenen Längen– und Breitengrade lagen.
Als ihm also Don Hernando Pedrárias mit absoluter Sicherheit bestätigte, daß zwischen der Punta de Penas und dem im Nordwesten liegenden Puerto Rico nur tiefe See lag, befahl er diesen Kurs und hoffte geduldig, daß vor seinem Bug schließlich eine ferne Küste auftauchen würde.
Trotzdem ließ er den Ausguck im Mastkorb und am Davit nie unbemannt, und bei Anbruch der Nacht befahl er, das Großsegel zu reffen, und fuhr lediglich mit dem Focksegel weiter. Alle Lichter an Bord waren gelöscht und alles lauschte gespannt in die Nacht hinaus, um jedes Geräusch, das nach Brandung klang, zu entdecken.
In der vierten Nacht, in der absolute Stille und Finsternis herrschten, erhellten plötzlich immer mehr Sterne den Horizont. Schnell mußte Kapitän Oliveira verblüfft feststellen, daß es sich dabei keinesfalls um Sterne handelte, sondern um Hunderte von besorgniserregenden Lichtern, die mit bemerkenswerter Geschwindigkeit auf seine Steuerbordseite zukamen.
»Sáo Bento, hilf!« rief er entgeistert aus. »Die Flotte!«
In der Tat konnte es sich nur um die mächtige spanische Flotte handeln, die in diesem Jahr mit Verspätung Sevilla verlassen hatte und im Konvoi, ihres Kurses und ihrer Stärke gewiß, nach San Juan de Puerto Rico segelte, von wo aus sie später Südkurs nach Cartagena de Indias einschlagen würde.
Die Flotte!
Die komplette Mannschaft der Botafumeiro betrachtete fasziniert von der Luvreling aus das stolze Schauspiel, das die majestätische Armada bot, und einige Augenblicke lang fühlte sogar Hernando Pedrárias selbst einen gehörigen Stolz, in einem Land geboren zu sein, das zu einer solchen militärischen Machtdemonstration fähig war.
Schließlich wandte er sich an den Portugiesen, der in kurzen Abständen Flüche ausstieß, ohne dabei auch nur einen Augenblick darauf zu verzichten, seine Kokablätter weiterzukauen, und fragte ihn:
»Was gedenkt Ihr zu tun?«
»Zwischen ihnen zu kreuzen«, tönte es entschlossen zurück.
»Zwischen dieser Unmenge von Schiffen zu kreuzen?« rief er aus. »Seid Ihr verrückt geworden? Sie werden uns entern.«
»Nicht, wenn wir geschickt manövrieren. Ich habe nicht genügend Leute, um alle Segel zu setzen, Fahrt aufzunehmen und sie hinter uns zu lassen.« Er spuckte über die Reling. »Und wenn wir unseren jetzigen Kurs halten, überrollen sie uns einfach.« Er wandte sich an den Mann am Steuerrad, der in der Dunkelheit kaum auszumachen war. »Hart Steuerbord! Und ihr dort, Groß– und Besansegel setzen.« Und als sich die Männer schon entfernten, fügte er mit schallendem Gelächter hinzu: »Und macht sicherheitshalber die Rettungsboote los!«
So brisant die Situation auch war und so sehr ihn schon seit der ersten Begegnung der Mann aus Lissabon anwiderte, Don Hernando Pedrárias konnte nicht umhin, die absolute Kaltblütigkeit des Kapitäns zu bewundern, den es offensichtlich kolossal amüsierte, auf eine Unmenge riesiger Schiffe zuzusteuern, die wie blinde Büffel vorwärts stürmten. Er mußte ihnen in finsterer Nacht ausweichen, und dabei konnte er lediglich auf seine eigene Geschicklichkeit und eine Handvoll halbgenesener Männer zählen, die kaum ausreichten, um auch nur die Hälfte der Segel zu setzen.
»Drei Mann ans Steuer!« rief er, als seine eigene Galionsfigur nur noch eine knappe Meile von den Galionsfiguren der Vorhut trennte. »Zwei Grad Backbord! Alle Segel anziehen!«
Der erfahrene Kapitän Joáo de Oliveira wußte, daß die schwere Flotte wie gewöhnlich mit allen Segeln fuhr, um die Rückenwinde zu nutzen. In ihrem Windschatten würde er praktisch nicht mehr von der Stelle kommen. Daher beschloß er, mehr Fahrt zu machen, solange er noch genügend Wind dazu hatte, um sich selbst auf die ankommenden Schiffe zu stürzen, nicht frontal, sondern im Winkel von etwa 40 Grad im Verhältnis zu den Positionslichtern der ersten Linie.







