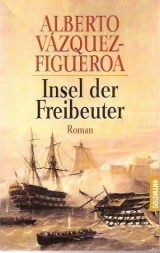
Текст книги "Insel der Freibeuter"
Автор книги: Alberto Vazquez-Figueroa
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Auf diese Weise wurde einerseits zwar das Risiko eines Zusammenstoßes beträchtlich größer, wenn der Kapitän in der Dunkelheit die wahre Länge der Galeonen, zwischen denen er kreuzen wollte, nicht rechtzeitig erkannte, andererseits behielt er damit eine gewisse Kontrolle über die Botafumeiro, die ansonsten wie ein im Wasser treibender Korken hilflos den Fregatten des Begleitschutzes aus der zweiten und dritten Linie ausgeliefert gewesen wäre, die sie im Handumdrehen in Stücke geschossen hätten.
Die Davitwachen eines so großen Flottenverbands waren logischerweise vor allem damit beschäftigt, den vorgeschriebenen Abstand zu den Positionslichtern der übrigen Schiffe zu halten und den Steuermännern die Kursänderungen zuzurufen. Im übrigen vertrauten sie darauf, daß sie auf kein Hindernis stoßen konnten, solange sie ihrem Flaggschiff blind folgten.
Daß da plötzlich eine Brigg aus der Finsternis auftauchte, traf die Wachen daher völlig unvorbereitet. So sehr sich das Schiff auch bemühen konnte, der Flotte auszuweichen, ein Desaster innerhalb des Verbands, in dem kein nicht vorher von Signalen angekündigtes Manöver möglich war, schien nahezu unausweichlich.
Während die Minuten verstrichen und die Entfernung zur Flotte schrumpfte, gewann die Botafumeiro an Fahrt und stürzte sich wie ein Blitz auf das erste der Lichter. An Bord schlugen inzwischen alle Herzen bis zum Hals, denn beim kleinsten Fehler würde die Botafumeiro unweigerlich ein massives Handelsschiff rammen, das ihr an Tonnage um das Doppelte überlegen war.
Nur eine knappe halbe Meile lag zwischen den Bordseiten der Flottenschiffe, ebenso groß war der Abstand zwischen den Linien: nicht gerade berauschend viel Platz, um auf offener See zu manövrieren, besonders dann nicht, wenn man die Länge der jeweiligen Schiffe in der Dunkelheit schätzen mußte.
»Ein Grad Backbord!« befahl der Lissaboner schließlich. »Die Taue fest anziehen!«
Im letzten Augenblick öffnete Joáo de Oliveira den Winkel etwas weiter und ließ ein großes, über acht Meter hohes Schiff in seinem Kielwasser passieren, wobei der Klüverbaum des Spaniers fast den Achtersteven der Botafumeiro streifte. Nun steuerte er die Botafumeiro direkt auf die mittleren Positionslichter des zweiten Schiffs zu. Bis er es erreicht hätte, würde dieses ihn überholt haben. Als er den schwachen Schein der großen Achterlaternen ausmachen konnte, wußte er, daß die Gefahr für den Augenblick gebannt war. Nachdem er wieder einmal ausgespuckt hatte, murmelte er:
»Steuer geradeaus!«
Hastig ließen die vier Männer das Steuerrad kreisen. Kurz darauf schrie der Portugiese aus vollem Halse:
»Nach zwei Minuten volle Wende Steuerbord! Paßt auf die Mastbäume auf!«
Der Befehl ging von Mund zu Mund.
Alle an Bord, der kränkliche schwarze Koch eingeschlossen, beeilten sich, den Befehl auszuführen. Sie wußten, daß es um ihr Leben ging, und so drehte sich die Brigg bald wie eine elegante Ballerina um sich selbst.
Das ganze Manöver spielte sich in dem Zwischenraum ab, den sich zwei Fregatten der zweiten Linie ließen.
Bis sie von neuem den nunmehr von Backbord kommenden Wind eingefangen und das Manöver in entgegengesetzter Richtung wiederholt hatten, verging beängstigend viel Zeit, und aus der Angst wurde Panik, als ein Wachposten auf einer der Fregatten etwas Ungewöhnliches zu bemerken schien und Alarm gab.
Fast unmittelbar darauf begannen die Kanonen zu donnern. Es waren allerdings nur warnende Pulversalven, denn mit gezieltem Kreuzfeuer hätten sich die Schiffe der Flotte bei ihrer Formation gegenseitig versenkt.
Im Schein des Mündungsfeuers zeichnete sich nunmehr die Botafumeiro ab, die von neuem vor dem Bug eines der Kriegsschiffe aus der dritten Reihe zu kreuzen begann, und kaum hatte sie damit begonnen, feuerte die riesige Galeone, welche die Formation abschloß und wie ein Schäferhund ihre Herde vor sich her zu treiben schien, eine regelrechte Breitseite, die um ein Haar auf dem Deck der Botafumeiro eingeschlagen hätte, die sich wie ein Hase auf der Flucht in die Nacht bewegte.
Knapp zehn Minuten lang verfolgte das riesige Schiff die flüchtende Botafumeiro und deckte sie mit einem ohrenbetäubenden Geschützfeuer ein. Bald jedoch mußte der Spanier eingesehen haben, daß die Beute den Aufwand nicht lohnte. Daher ging er bald Backbord, um seine ursprüngliche Position am Ende der Flotte wieder einzunehmen.
»Gott sei uns gnädig!« rief Don Hernando Pedrárias aus, als er seine Stimme wiedererlangt hatte und ihm die Beine nicht mehr zitterten. »Das war die Cagafuego!«
»Die Cagafuego?« fragte Joáo de Oliveira erstaunt. »Ich dachte, die ist im Pazifik und schützt die Philippinenroute.«
»Sie ist vor einem Jahr zurückgekehrt.«
»Gut zu wissen, auf daß wir nicht noch einmal den Weg dieser Bestie kreuzen! Beinahe hätte sie uns das Licht ausgeblasen.«
Cagafuego war der Spitzname, den die Piraten gewöhnlich dem bestbewaffneten Schiff der spanischen Flotte gaben. Meistens war das eine Galeone mit über neunzig Kanonen und 500 Mann Besatzung.
Eine Stunde später verloren sich die Lichter der Flotte in der Ferne, und die Botafumeiro ging wieder auf ihren ursprünglichen Kurs zurück. Jetzt allerdings gab der Portugiese nicht den Befehl, die Segel anzuziehen, sondern folgte einfach dem Kielwasser der Flotte. Wenn die spanischen Steuermänner sicher waren, daß ihnen in diesen Gewässern bei Nacht keine Gefahr drohte, dann galt dies auch für das Schiff des Portugiesen.
Zwei Tage später passierten sie bei Tagesanbruch die Mona-Passage zwischen Puerto Rico und Santo Domingo. Ohne Hast segelten sie nunmehr die Küste von Hispaniola entlang, bis sie schließlich am folgenden Morgen in einen tiefen Hafen einliefen. Die aufmerksamen Augen der Wachposten verfolgten sie von der uneinnehmbaren Festung aus, deren Errichtung »Gouverneur« Le Vasseur vor einem halben Jahrhundert am gleichen Tag befohlen hatte, an dem ihn die Spanier aus Santo Domingo vertrieben hatten.
An Tortuga war die lange Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Die einst strahlende Festung der Bukaniere, in der das Gold der Piraten und Korsaren einst in Strömen floß und wahre Heerscharen von Huren und Glücksrittern ernährte, verfiel ebenso rasant wie das pulsierende Port-Royal zu florieren begann.
Tortuga war nun einmal kaum mehr als ein kahler Felsen in Sichtweite einer von spanischen Truppen beherrschten Küste, während sich auf Jamaika die Engländer so festgesetzt hatten, daß sie nicht einmal die Spanier mehr vertreiben konnten.
Eine Welt des Verfalls konnte gelegentlich ihren eigenen Charme besitzen, besonders dann, wenn sie auf eine glorreiche Vergangenheit zurückblicken konnte. Doch unter den Helden der Vergangenheit Tortugas hatte es nur blutdürstige Mörder gegeben, und unter den Heldinnen gab es keine, die nicht in tausend Betten geschlafen hatte. So boten Gebäude, Menschen, ja sogar Festungen lediglich den traurigen Anblick des vorzeitigen Ruins.
Gerade mal ein halbes Dutzend Schiffe verlor sich in der weiten Bucht, und schon auf den ersten Blick konnte man erkennen, daß es keine Handelsschiffe mit wertvoller Fracht waren, die man gegen Zucker und Rum hätte eintauschen können, und auch keine stolzen Korsarenschiffe, die bereit waren, gegen die Spanier zu kämpfen, sondern lediglich Küstensegler ohne großen Tiefgang. Mit diesen Schiffen überfielen die Bukaniere Hispaniola und kehrten von dort blutbefleckt zurück, die Schiffe bis zur Reling voll mit toten Schweinen.
Das geräucherte Fleisch, das bei den Schiffsbesatzungen als schmackhafter Proviant so beliebt war, luden die Jäger dann wieder auf ihre Schiffe und setzten Kurs auf Jamaika. Drei Tage später kamen sie dort an, verkauften ihre Ware und verschleuderten ihren Gewinn in den Bordellen und Spielhöllen von Port-Royal, das ihnen den Glanz der ruhmreichen Jahre geraubt hatte.
Die meisten von ihnen kehrten niemals zurück.
Als Don Hernando Pedrárias und Kapitän Tiradentes schließlich die wurmstichige Pier betraten und ein einsamer, zahnloser und vom Skorbut befallener Bettler mit ausgestreckter Hand ein Almosen verlangte, blickten sie sich ernüchtert in die Augen.
»Die Schildkröte ist alt geworden…«, kommentierte der Portugiese mit seinem ihm eigenen Sinn für Humor. »Ich denke, hier werden wir nicht finden, was wir suchen.«
Mit Sonne, Wind, Sand und Salz pflegt die Natur am häufigsten zu zerstören, was Menschenhände aufgebaut haben, und bei dieser verfluchten Insel, die so viel unschuldiges Blut auf dem Gewissen hatte, schien diese Natur beschlossen zu haben, alle verhaßten Zeugnisse dieser traurigen Vergangenheit auszulöschen.
Die majestätische Festung Le Vasseurs fiel allmählich in Trümmer, der »Hafen« versank langsam, und die meisten der einst luxuriösen Gasthäuser, Schenken und Freudenhäuser waren kaum noch mehr als eine Ansammlung von Brettern ohne Anstrich, die seit dem letzten Hurrikan keine Fenster mehr hatten.
»Schöner Or’! Ja Seno!« konnte sich der Portugiese nicht verkneifen, indem er den Akzent des Bordkochs imitierte. »Schön und berühmt!«
Von neuem spuckte er aus, um damit auszudrücken, was er in Wahrheit von einer Insel hielt, von der man ihm schon als Kind Wunderdinge erzählt hatte. Schließlich entschloß er sich jedoch dazu, in der am besten erhaltenen Hafenschenke Platz zu nehmen. Seine schmutzige Kleidung, seine schmierigen zerzausten Haare und seine braunen Hauer paßten geradezu vorzüglich zu den schmutzigen Stühlen, den schmierigen Tischen und den braunen Nägeln der verwahrlosten Bedienung, die vor langer Zeit sicher einmal ein Piratenliebchen gewesen war.
»Was darf’s denn sein?« fragte sie.
»Rum.«
»Merde«, murmelte die Wirtin sichtlich verärgert. »Rum. Immer nur Rum! Seit die verdammten Engländer diesen >Teufelstöter< erfunden haben, will kein Mensch mehr ein anständiges Gesöff haben.«
Die bittere Klage war in gewisser Weise berechtigt. Seit dem verfluchten Tag, an dem ein irischer Säufer in Barbados auf die Idee gekommen war, den Zuckersaft des Zuckerrohrs zu destillieren, hatte sich der Geschmack der Antillenbevölkerung in punkto Alkohol wie durch Zauberhand geändert.
Tatsächlich hatten manche Männer, die oft monatelang auf See waren, nichts anderes im Kopf als das starke Feuerwasser, das anfänglich killdevil oder »Teufelstöter«, später rumbullion (in etwa »Durcheinander«) und schließlich abgekürzt nur noch Rum genannt wurde. Wenn sie an Land gingen, wollten sie nur eins: sich möglichst schnell und billig zu betrinken.
Die milden, verwässerten Weine, die aus Frankreich und Spanien importiert wurden, waren nicht nur zu teuer, oft wurden sie auch auf der langen und heißen Überfahrt schal oder sauer. Ein ganz anderes Kaliber war da ein guter Krug Rum aus Westindien, der umgehend für Euphorie sorgte, ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen war, wenn man sich mit voller Absicht betrinken wollte.
Der Rum hatte sich daher zum unangefochtenen König aller westindischen Schenken aufgeschwungen. So kehrte die Wirtin trotz ihrer Proteste und Flüche denn auch bald mit zwei riesigen Krügen des stärksten »Teufelstöters« zurück, setzte sie so hart auf den Tisch, daß reichlich Rum überschwappte, und fragte geradezu aggressiv:
»Noch etwas?«
Der Portugiese nickte:
»Wir brauchen Männer.«
»Männer? Was für Männer?«
»Schwindelfreie Toppsgaste mit Mumm in den Knochen und erfahrene Kanoniere, die gutes Geld verdienen wollen.«
»Wenn es in diesem Drecksnest noch mutige Männer gäbe, hätten sie schon vor langer Zeit das verfluchte Port-Royal in Brand gesteckt«, murmelte das häßliche Weib und zog geräuschvoll den Rotz hoch. »Wie hoch ist mein Anteil?«
»Eine Dublone pro Kopf.«
Die zottelige Hexe nickte zustimmend.
»Ich werde sehen, was sich machen läßt.«
Tiradentes richtete drohend den Finger auf sie.
»Aber bring mir keinen Abschaum. Ich will erfahrene Leute.«
Die Frau lachte nur und zeigte dabei ihr lückenhaftes Gebiß.
»Auf Tortuga haben sie alle Erfahrung. Aber Abschaum sind sie auch alle.«
In der gleichen Nacht zeigte sie, daß sie sehr gut wußte, wovon sie sprach. Von den hundert Vagabunden, die sich in der Schenke beim Kapitän der Botafumeiro vorstellten, hatten die meisten mehr als genug Erfahrung, aber sie waren auch echter Abschaum.
Rum, Hunger, Skorbut, Syphilis und einige berauschende Pilze, die einen halb verrückt machten, hatte diese herrenlose Bande in ein Panoptikum menschlichen Abfalls verwandelt, der aber allen Enthusiasmus zeigte, die geringste Gelegenheit beim Schopf zu packen und einen kahlen Felsen zu verlassen, von dem sie sich nichts mehr erhoffen konnten.
»Die Bezahlung ist gut«, ermahnte der Portugiese einen nach dem anderen, der vor ihm Platz nahm. »Aber wenn du dich entschließt, bei mir anzuheuern, mußt du folgendes wissen: Alkohol, Pilze, Glücksspiel und Frauen sind an Bord verboten. Und bei mir gibt es nur eine einzige Strafe: Dem Missetäter reiße ich einen Zahn aus. Je schwerer das Vergehen, desto mehr Zähne. Und wenn keine Zähne mehr da sind, hänge ich ihn auf. Geh, und denk darüber nach. Wenn du mit der Arbeit und dem Reglement einverstanden bist, dann komm morgen an Bord.«
Sebastián Heredia nahm wieder die nicht uneigennützig -aber offensichtlich enthusiastisch – gewährten Dienste der roten Astrid in Anspruch. Nachdem sie sich lange Zeit im riesigen Bett der Hütte geliebt, gestreichelt und gewälzt hatten, ließen sie sich im Sand des Strands nieder, um eine der riesigen stinkenden Zigarren zu teilen, die das Mädchen so gern rauchte.
»Hast du dir meinen Vorschlag von gestern nacht noch einmal durch den Kopf gehen lassen?« wollte die Hure wissen, während sie die Millionen Sterne betrachtete, die über ihren Köpfen funkelten. »Die Sache mit Mombars?«
»Hör mal, meine Liebe…«, entgegnete der Margariteno, als wolle er sich in Geduld üben, um sich den angenehmen Augenblick nicht verderben zu lassen. »Ich habe dir schon gesagt, daß ich eine gute Arbeit an Bord eines guten Schiffs habe. Warum soll ich mir das Leben komplizieren?«
»Was ist das denn für ein Schiff?«
»Die Jacare.«
»Die Jacare?« fragte Astrid überrascht und stützte sich auf einen Ellenbogen, um ihn besser betrachten zu können. »Dieser armselige Kahn da draußen in der Bucht? Das nennst du ein >gutes Schiff
»Das beste.«
»Daß ich nicht lache! Diese Nußschale versenkt die la de Dios doch mit einer Breitseite.«
»Das muß sich erst mal zeigen!« gab Kapitän Jacare Jack herausfordernd zurück und sah ihr direkt in die Augen. »Was die Jacare ausmacht, sind nicht ihre Kanonen, sondern etwas, was kein anderes Schiff hat.«
»Und das wäre?«
»Sicherheit.« Er wies auf die Bucht hinter ihrem Rücken hinaus. »Die Jacare ist das einzige Schiff, das schon über zwanzig Jahre lang auf Jagd geht, ohne daß ihr je auch nur das Geringste passiert wäre. Hundert Kanonen an Bord helfen dir gar nichts, wenn ein einziger Felsen dein Schiff binnen Sekunden versenken kann, und das wird der Jacare niemals passieren.«
»Und warum nicht? Sie ist doch nicht unsinkbar.«
»Das nicht, Kleine. Unsinkbar ist sie nicht, aber der Alte besitzt die beste Sammlung Routenbücher der Antillen. Mit dem, was er in seiner Kajüte aufbewahrt, könnte man mit geschlossenen Augen gefahrlos bis in den letzten Winkel der Karibik segeln.«
»Wie ist er in deren Besitz gelangt?«
»Reiner Zufall! Eines Nachts hat er einen getarnten Pott geentert, auf dem man das Archiv von Sevilla dem Hafenkommandanten von San Juan schickte. Was wie eine große Kiste mit alten Büchern aussah, war in Wahrheit der größte Schatz, von dem ein Pirat nur träumen kann.« Er ließ sich wieder auf den Sand fallen, als hielte er die Diskussion damit für beendet. »Aus diesem Grund wird die Jacare das beste Schiff der Antillen bleiben, bis sie irgendwann auseinanderfällt.«
»Verdammte Hure, die mich geboren hat!« rief die schamlose Rothaarige aus. »Wenn das stimmt, dann zahlt jeder Kapitän eine Million Pfund für dieses Archiv. Hast du daran noch nie gedacht?«
»Natürlich, mein Schatz! Natürlich! Aber der Alte sitzt in seiner Kajüte wie eine Glucke über den Büchern. Beim geringsten Anzeichen von Gefahr läßt er sie ins Meer fallen, denn er ist der einzige, der sie hier oben hat, in seinem Kopf.« Ein ums andere Mal tippte er sich an die Stirn. »Jahrelang hat er sie studiert, und jetzt kennt er sie auswendig. Meine Hoffnung ist, daß er sich eines Tages zur Ruhe setzt und sie mir überläßt.«
Astrid schüttelte ihre flammende Mähne.
»Er wird sie verkaufen.«
»Das bezweifle ich«, entgegnete Sebastián ungerührt. »Er weiß, wenn er sie verkauft, wird man Kopien anfertigen, und viele sind der Meinung, daß nicht jeder Idiot in der Karibik herumsegeln sollte, als würde er sie wie seine Westentasche kennen.«
»Warum nicht?«
»Du liebe Zeit! Stell dir mal vor, dein Freund Mombars kreuzt durch die Karibik ohne Angst, irgendwo aufzulaufen? Der würde solche Schlachtfeste veranstalten, bis die Krone sich schließlich gezwungen sähe, eine richtige Flotte in die Antillen zu schicken. Nein, der Alte hat schon recht. Dieser Schatz muß in guten Händen bleiben.«
Er begann sie zu streicheln und zu küssen, um sich wieder dem Liebesspiel im Sand hinzugeben und erklärte damit die Unterhaltung definitiv für beendet. Die Rothaarige ließ ihn gewähren, zunächst in Gedanken versunken. Bald aber schloß sie sich dem erregenden Spiel mit ehrlicher Hingabe an, bis die beiden schließlich völlig erschöpft waren.
Kurze Zeit danach sprang Sebastian auf.
»Ich muß gehen! Halt mir Samstag abend frei.«
Er kehrte zum Strand zurück, wo ihn bereits Justo Figueroa erwartete. Neben ihm stand eine kleine Kutsche mit zwei ungeduldigen Pferden. Kurze Zeit darauf tauchte ein Boot aus der Finsternis auf, aus dem Celeste Heredia und ihr Vater stiegen.
Er küßte sie zärtlich und überreichte ihnen einen Schlüsselbund.
»Ihr könnt es nicht verfehlen!« sagte er ihnen zum Abschied. »Folgt einfach der Küstenstraße, bis ihr an dem abgebrannten Haus vorbeikommt. Gut zwei Meilen später werdet ihr eine große blauweiße Villa finden. Die ist es.«
»Wann kommst du uns besuchen?« wollte seine Schwester wissen.
»Sobald ich kann.«
»Wie ist es letzte Nacht gelaufen?«
»Ich habe den Köder ausgelegt. Jetzt muß sie den nächsten Schritt machen. Ich denke, wir werden bald wissen, ob sie wirklich mit Mombars in Kontakt steht oder nicht.«
»Paß gut auf dich auf!« empfahl ihm Miguel Heredia.
Sebastián tätschelte den dichten, bereits weißen Bart, den sich sein Vater in letzter Zeit hatte wachsen lassen und der ihm das Aussehen eines strengen Patriarchen verlieh.
»Mach dir keine Sorgen!« entgegnete er mit Humor. »Der einzige, der sich Gedanken machen muß, ist der alte Kapitän Jacare Jack, der das ganze Archiv im Kopf hat. Und wenn er den treffen will, muß er schon nach Aberdeen fahren.«
»Nimm die Sache nicht zu leicht«, sagte sein Vater. »Dieser Mombars ist irre, und die Irren sind stets unberechenbar.« Er blinzelte ihm zu. »Das weiß ich aus Erfahrung.«
Am Horizont war ein erster Lichtschein zu sehen. Schnell würde der Morgen anbrechen. Dann tummelten sich die »ehrbaren« Einwohner der Stadt auf den Straßen. Daher drängte er die beiden, in die Kutsche zu steigen.
»Vertrau mir! Ich verspreche dir, wenn die Sache zu brenzlig wird, vergesse ich die Ira de Dios und ihr goldenes Geschirr. Und jetzt los! Man soll uns lieber nicht zusammen sehen.«
Er sah zu, wie die kleine Kalesche in der Ferne verschwand, und nachdem er sich vergewissert hatte, daß sie den Weg nach Caballos Blancos eingeschlagen hatte, stieg er in das Boot, das auf ihn wartete, um an Bord der Jacare zurückzukehren.
Lucas Castano empfing ihn am Fuß der kleinen Treppe.
»Und?« wollte er wissen.
»Der Köder ist ausgelegt. Jetzt heißt es abwarten, ob der Fisch anbeißt.«
»Er wird anbeißen«, versetzte der Panamese. »Früher oder später wird er anbeißen.«
»Ein bewaffneter Mann soll vor der Tür der Kajüte Wache stehen«, befahl Sebastian. »Unauffällig, aber man muß ihn von Land aus mit einem guten Fernglas sehen können. Wir müssen den Anschein erwecken, daß sich drinnen ein Schatz verbirgt.«
»Gestern nacht hat uns Kapitän Scott wieder besucht. Er bestand darauf, den Alten zu sehen. Sie waren gute Freunde.«
»Das nächste Mal flüsterst du ihm ins Ohr, daß der Alte ihn nicht sehen will, weil er Ziegenpeter hat.«
»Mumps?« entgegnete sein Stellvertreter perplex. »Aber das ist doch eine Kinderkrankheit!«
»Das weiß ich. Aber es heißt, wenn man sich als Erwachsener ansteckt, wird man davon unfruchtbar. Sag Kapitän Scott, daß der Alte deshalb niemanden sehen will, und ich garantiere dir, daß ihm sofort die Lust darauf vergeht.« Er schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Und jetzt leg ich mich schlafen. Rum, Tabak und die Rothaarige haben mich geschafft.«
Den ganzen Tag über ruhte er sich aus wie der Rest der Flotte, der in der Bucht ankerte. Am Abend versammelte er seine gesamte Besatzung vor dem Achterkastell.
»Wie ihr wißt, ist meine Schwester nicht mehr an Bord, also kann uns auch das Pech nicht mehr verfolgen, fetzt möchte ich, daß ihr nach wie vor jedem, der euch danach fragt, versichert, daß sich der Kapitän immer noch in seiner Kajüte eingeschlossen hat. Den Grund dafür kann ich euch nicht erklären, doch eins verspreche ich euch: Wenn ihr mir aufs Wort gehorcht, kann ich euch die wertvollste Beute verschaffen, von der ihr je geträumt habt.«
»Was für eine Beute denn?« wollte Mubarrak el Moro, der zweite Steuermann, sofort wissen, ein maßloser Schürzenjäger, der deswegen stets pleite war.
»Beute ist Beute«, tönte es barsch zurück. »Und mit dem Anteil, der dir zusteht, kannst du dir einen eigenen Harem leisten, bis du keinen mehr hochkriegst.«
»Allah möge dich erhören.«
»Tu, was ich sage, und er wird mich erhören.«
Als die meisten schon dabei waren, zum Strand zu rudern, wandte er sich Lucas Castano zu.
»Jetzt bist du dran. Aber sieh dich vor. Die ist nicht blöd.«
»Kann ich sie mir vornehmen?«
Der Margariteno warf ihm einen Blick zu, den man als Bitte oder Widerspruch auffassen konnte.
»Mensch Lucas! Bei dem Angebot von Frauen…!«
»Na ja, du hast sie so über den grünen Klee gelobt.« Er lachte schelmisch. »Und wenn nicht ich, dann besorgt es ihr ein anderer.«
»Mach, was du willst, aber behalt’s für dich. Und jetzt hau ab, und paß auf, daß alles wie ein Zufall wirkt.«
Es war dunkel geworden, und in der Bucht spiegelten sich die Lichter der Stadt. Kaum war das Boot von Lucas Castano aus dem Blick verschwunden, begann eine romantische Musik zu spielen, die wie immer vom hohen Deck des Schiffs von Laurent de Graaf herüberwehte.
Sebastián aß allein zu Abend. Dabei vermißte er seinen Vater und seine Schwester. Heute begann für die beiden ein Leben in Sicherheit, und was immer auch geschehen mochte, immer würden zwei Menschen auf seine Rückkehr warten. Seine Existenz gewann plötzlich eine neue Dimension. Jetzt war er kein armer Junge mehr, der dazu verdammt war, einen alten Kranken zu pflegen, sondern ein Piratenkapitän mit Familie.
Eines schönen Tages würde er vielleicht irgendwo eine bezaubernde Frau treffen und mit ihr ein weniger unruhiges Schicksal teilen. Und vielleicht würde auch Celeste eines Tages einem ehrlichen Mann begegnen, der ihr das Glück schenken konnte, das sie so sehr verdiente.
Sein Vater, jener unglückliche Mann, der Jahre damit verbracht hatte, am Rand des Wahnsinns an Bord Macheten zu schleifen, könnte dann einen friedvollen Lebensabend im Kreis seiner Enkelkinder verbringen. Mit etwas Glück würden auch die alten Wunden verheilen und das Bild von Emiliana Matamoros würde endgültig in seiner Erinnerung verblassen.
Keine Sekunde verschwendete Sebastian bei dieser Gelegenheit an seine Mutter. Lieber dachte er genüßlich daran, wie wohl die Zukunft von Don Hernando Pedrárias aussehen mochte. Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, wenn er daran dachte, daß dieser mit etwas Glück in einem feuchten Kerker der Casa für seine Verbrechen büßte.
Was für ein Gesicht mochte er wohl gemacht haben, als er entdecken mußte, daß sein Perlenfäßchen verschwunden war?
Und wie mochte er reagiert haben, als er erfahren hatte, daß sich seine geliebte Kutsche in ein Häufchen Asche verwandelt hatte?
Und was mochte er in seinem Innersten empfunden haben, als ihm klar wurde, daß er das aufregende junge Mädchen, das er hatte verderben wollen, niemals wiedersehen würde?
Rache, süße Rache: Das war ein Leckerbissen, den man wirklich auf dem Achterkastell eines in einer stillen Bucht ankernden Schiffs genießen konnte, mit einem Glas Rum in der Hand, während der Mond aufging.
»Kann ich an Land gehen, Kapitän?«
Er sah den dienstfertigen Koch an, der ihm die Frage gestellt hatte, und nickte zustimmend.
»Natürlich! Aber denk an den Befehl.«
»Ich werde daran denken, Kapitän«, sagte der kleine Filipino. »Der alte Kapitän ist verrückt geworden und will nicht, daß man ihn besucht.«
»So ist es! Amüsier dich!«
»Darauf könnt Ihr Gift nehmen!«
Überrascht sah Sebastian mit an, wie der Koch einfach über Bord sprang und wie ein Fisch auf die Lichter einer Stadt zuschwamm, in der ihn alle Zerstreuungen erwarteten, von denen ein Mann, der bei klarem Verstand war, nur träumen konnte. Einige Augenblicke lang verspürte Sebastian den drängenden Wunsch, es dem Koch gleichzutun, doch hielt er sich zurück. Er wußte, wenn er es täte, würde er zur Schenke der Tausend Jakobiner marschieren, die rote Astrid an der Hand nehmen und zum Strand schleppen, um sie dort bis zum Morgengrauen auf dem Sand zu lieben.
So beließ er es dabei, einige Minuten an die genußvolle vergangene Nacht zu denken, und ging anschließend jedes Detail seines Plans noch einmal durch. Er würde alles Glück der Welt brauchen, um ihn zu einem guten Ende zu bringen.
Drei Stunden später nahm Lucas Castano, der nach Rum und billigem Parfüm roch, neben ihm Platz und grinste von einem Ohr zum anderen.
»Ich habe sie gesehen. Und wir haben geredet. Du hattest recht: Man kriegt Lust, sie aufzufressen.«
Sein Kapitän warf ihm einen undefinierbaren Blick zu. Lucas lächelte nur und machte eine abwehrende Handbewegung.
»Mach dir keine Sorgen. Ich hab sie nicht angerührt. Ich hab’s mit einer Chinesin gemacht. Bei Chinesinnen werde ich immer schwach.« Er schlug ihm kräftig auf die Schulter. »Und ich hab gemerkt, daß du ihr gefällst! Verdammt gut gefällst! Als ich ihr erzählt habe, daß ich auf der Jacare fahre, hat sie ganz leuchtende Augen gekriegt, und sie war ganz enttäuscht, daß du nicht kommen kannst, weil du Wachdienst hast.« Er lehnte sich zurück. »Wahrscheinlich habe ich mich deshalb für die Chinesin entschieden.«
»Was hat sie dich noch gefragt?«
»Ob ich gern eine andere Arbeit hätte, aber natürlich wollte sie mich über das Schiff und den alten Kapitän aushorchen.«
»Also hat sie den Haken geschluckt.«
»Mit allem, was dazugehört. Jetzt kommt es darauf an, daß Mombars ihn ebenfalls schluckt.«
»Und wenn er das tut, aber sich dazu entschließt, an Bord zu stürmen und sich die Routenbücher mit Gewalt zu holen?«
»Mitten in der Bucht von Port-Royal?« fragte der Panamese ungläubig zurück. »Vergiß es! Das traut sich nicht einmal der Todesengel. Dieser Ort ist für alle Piraten, Korsaren, Freibeuter und Bukaniere der Welt heilig. Die einzige echte heilige Stätte, die es auf Erden noch gibt.«
»Schon merkwürdig, nicht?« bemerkte der Kapitän. »Hier versammeln sich so viele Verbrecher wie nirgendwo sonst, und doch ist das hier der einzige Ort, in dem ein ehrbarer Mensch sich sicher fühlen kann.«
Lucas Castano ließ ein rumseliges Lachen hören.
»Du kannst sicher sein, daß es in dieser wunderbaren Stadt zur Zeit keinen einzigen ehrlichen Menschen gibt. Der würde uns schließlich alle ausrauben. Ich leg mich schlafen. Der Köder ist ausgelegt, jetzt müssen wir Geduld haben.«
»Geduld« war ein Wort, das im Vokabular eines kaum Vierundzwanzigjährigen nicht vorgesehen war, und Sebastián Heredia machte da keine Ausnahme, auch wenn die Zeit an Bord der Jacare ihn gelehrt hatte, Stunden und Tage damit zu verbringen, den Horizont nach einer Beute abzusuchen.
Piraten und Korsaren waren im Prinzip nur Fischer, die Schiffe angelten und ständig auf ihre Opfer lauerten, doch in diesem Fall wußte der Margariteno schon im voraus, daß das Opfer ein harter Brocken sein würde. Nicht nur, weil es sich um eines der mächtigsten Schiffe der Karibik handelte, sondern weil der Kapitän als bestialischster aller Verbrecher galt.







