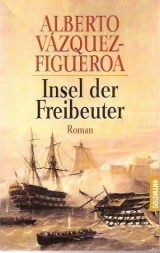
Текст книги "Insel der Freibeuter"
Автор книги: Alberto Vazquez-Figueroa
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
»Und was ist mit der Besatzung?«
»Um die kümmere ich mich.«
»Nimm an, einer deiner Männer entschließt sich, zu desertieren und für immer an Land zu bleiben. Was dann?« fragte sein Vater.
»Das wird nicht passieren!« lautete die entschlossene Antwort. »Und wenn doch, werde ich entsprechende Maßnahmen treffen.«
»Und wenn doch?« beharrte der andere. »Heißt das, daß wir das Haus niemals mehr verlassen können?«
»Hör zu!« rief Sebastian ungeduldig. »Ich sage dir doch, du mußt dir um keinen meiner Männer Sorgen machen. Zwing mich nicht, noch deutlicher zu werden!«
»Soll das etwa heißen, daß du jeden umbringst, der auf der Insel bleiben will?« mischte sich Celeste etwas fassungslos ein. »Das scheint mir doch ein allzu hoher Preis für unsere Sicherheit zu sein.«
»Ich muß ihn ja nicht gleich umbringen«, stellte ihr Bruder klar. »Ich brauche ihn nur mitzunehmen, ob er will oder nicht, und ihn auf einer einsamen Insel aussetzen. Ein Piratenkapitän muß blinden Gehorsam erwarten können, und wer einen Befehl nicht ausführt, weiß, was er riskiert. Und ich werde befehlen, daß an dem Tag, an dem wir die Anker lichten, alle Männer an Bord sein müssen.«
»Ich vertraue darauf, daß sie dir gehorchen.«
»Sie setzen ihr Leben aufs Spiel.«
Sebastian war so entschlossen und kurz angebunden, daß ihn selbst sein eigener Vater streng ansah.
»Oft erkenne ich dich nicht wieder. Langsam führst du dich auf wie ein richtiger Pirat.«
»Ich bin ein Pirat, Vater!« erwiderte der Kapitän der Jacare unwirsch. »Als ich mir dieses Schiff aufgeladen habe, wußte ich sehr gut, auf was ich mich einließ, und ich bin zu dem Entschluß gekommen, daß es in meinem Leben kein Hin und Her gibt. Wenn ich eines Tages ein spanisches Schiff versenken oder einen meiner Männer aufhängen muß, wird mir die Hand nicht zittern, denn an dem Tag, an dem das passiert, werde ich meine Befehlsgewalt unverzüglich aufgeben.«
»Wäre das nicht ohnehin das Beste?«
»Das haben wir schon diskutiert. Nein, das wäre es nicht. Wie Celeste schon gesagt hat, bin auch ich ein Kind meiner Zeit.«
Als die Sonne die Wipfel der Palmen im Westen der Bucht streichelte und eine leichte Brise die schlaffen Fahnen fächelte, da erschien es, als hätte dieser Wind die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. In den Straßen regte sich plötzlich Leben, die Freudenmädchen machten sich hübsch, die Händler öffneten ihre Läden, und die Wirte wischten die Tische ab und füllten die Krüge mit Rum.
Port-Royal machte sich zu einer neuen Nacht der Sünde bereit, in der alles, außer Raub, erlaubt schien.
Bei Anbruch der Dunkelheit sprangen die Besatzungen der großen Schiffe in die Beiboote, um ohne Hast zum Strand zu rudern. Bald näherte sich eine Schaluppe der Jacare, und ein kleiner Mann mit riesigem Schnurrbart und rumseliger Stimme rief nach oben:
»Ahoi Jacare! Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Wo bist du, verfluchter schottischer Rotschopf? Seit Jahren hab ich dich nicht mehr gesehen.«
Lucas Castano lehnte sich rasch über die Reling, um den Neuankömmling lächelnd zu begrüßen.
»Guten Abend, Kapitän Scott! Tut mir leid, aber der Kapitän fühlt sich nicht wohl und hat befohlen, daß ihn keiner stört.«
»Hab mich schon gewundert, warum er so ohne Grund hier auftaucht!« schluckte der andere die Lüge. »Was ist los mit ihm?«
»Das Fieber, Senor. Ihr wißt ja! Der Arzt sagt, nach einigen Tagen Ruhe ist er wieder wie neu.«
»Ach was, alt ist er«, lästerte Kapitän Scott und bedeutete seinen Männern, ihn an Land zurückzurudern, während er ausrief: »Hast du mich gehört, verfluchter schottischer Saufkopf? Alt bist du und traust dich nicht mehr zu den Huren von Port-Royal!«
Er verschwand in der Dunkelheit, während er sich auf die Schenkel klatschte, als hätte er niemals etwas Spaßigeres gesagt.
Erst jetzt ließ Lucas Castano die Mannschaft vor dem Achterkastell versammeln und befahl in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete:
»Alle, die keinen Wachdienst haben, können an Land gehen und saufen, was das Zeug hält, aber denkt daran: Der >alte Kapitän< bleibt weiterhin mit Fieber an Bord und will nicht gestört werden.« Drohend richtete er den Finger auf sie und fügte hinzu: »Morgen um zehn seid ihr wieder an Bord, oder ihr bekommt die Peitsche zu schmecken.«
»Um zehn!« protestierte eine anonyme Stimme.
»Morgens um zehn schließen die Bordelle und die Schenken, also habt ihr um diese Zeit nichts an Land verloren. Wer das letzte Boot verpaßt, darf schwimmen und wird sich damit abfinden müssen, daß ich ihm ein kariertes Hemd auf den Rücken zeichne.«
Das unzufriedene Gemurmel war schon nach einigen Augenblicken verschwunden, denn die Gewißheit, vierzehn Stunden der Zerstreuung vor sich zu haben, entschädigte für jede Auflage, und bereits wenige Minuten später waren nur noch die drei Männer an Bord der Jacare, die für den Wachdienst der ersten Nacht eingeteilt worden waren, sowie der philippinische Koch, Lucas Castano und die drei Mitglieder der Familie Heredia.
Letztere vier nahmen auf dem Achterkastell ein üppiges Abendessen ein und genossen die angenehme Seebrise, die ihnen die Moskitos vom Hals hielt, während das Lärmen und Lachen aus der Stadt zu ihnen hinüberwehte. Die Lichter der Stadt spiegelten sich in dem stillen Wasser der Bucht, in der sich die Silhouetten der küstennäher vor Anker gegangenen Schiffe abzeichneten.
Seit langem hatten sie keinen so angenehmen Abend mehr verbracht, denn vom riesigen Nachbarschiff wehte bald eine hinreißende Melodie herüber, und wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellten, konnten sie acht Musiker in schönen Uniformen ausmachen, die vor einem Dutzend Gäste auf ihren Saiteninstrumenten spielten.
»Das muß das neue Schiff von Laurent de Graaf sein«, bemerkte Lucas Castano. »Immer hat er ein Orchester an Bord, das sogar im Schlachtgetümmel spielt.«
»Das machen sie wirklich gut!« sagte Celeste anerkennend.
»Natürlich!« versetzte der Panamese. »Aber da er so nah ist, empfehle ich dir, daß du dich nicht sehen läßt. Es heißt, daß keine Frau De Graaf widerstehen kann, weil er der attraktivste Pirat der Karibik ist, mit den erlesensten Manieren.«
»Hast du Angst um meine Tugend?« wollte sie belustigt wissen.
»Ich habe eher Angst vor einem Kanonenduell mit diesem Monstrum, ohne daß wir Platz zum Navigieren haben«, stellte der Panamese klar. »Wenn sich eine Frau an Bord von einem Mann eines anderen Schiffs verführen läßt, ist es Brauch, daß die Ehre der Besatzung mit Blut und Feuer reingewaschen wird, und in diesem Fall verlieren wir.«
»Ich werde mir das hinter die Ohren schreiben!« sagte das kecke Mädchen reichlich verschmitzt. »Meine Tugend, so sehr ich sie schätze, ist sicher kein Schiff wie die Jacare samt Besatzung wert.«
Ihr Bruder musterte sie, als hätte er sich immer noch nicht an ihr lockeres Mundwerk und ihr Benehmen gewöhnt.
»Du erstaunst mich immer wieder!«
»Wart’s ab. Aber mach dir keine Sorgen«, fügte sie lächelnd hinzu. »Ein Pirat in der Familie reicht.«
Sebastián wandte sich seinem Vater zu:
»Versprich mir, daß du ihr eine Begleiterin suchst, die ihr beibringt, wie sich eine richtige Senorita benimmt! Sie macht mich verrückt!«
»Ach komm!« rief Celeste aus und tätschelte ihm zärtlich die Wange. »Im Grund gefällt es dir doch, daß ich so bin. Dein Gesicht hätte ich sehen mögen, wenn du festgestellt hättest, daß du eine affektierte und scheinheilige Schwester hast.«
»Übertreiben mußt du es aber auch wieder nicht. Und jetzt schaue ich mir dieses berühmte Port-Royal mal näher an, von dem sie alle soviel reden.«
Kaum hatte Sebastián Heredia seinen Fuß in den Sand des Strands gesetzt, fühlte er sich wie auf einem verrückten Karussell. Eine neue Erfahrung jagte die andere. Die verschwenderische Zurschaustellung von Luxus, die oft zwischen Extravaganz und schlechtem Geschmack pendelte, überstieg in dieser von allen guten Geistern verlassenen Stadt alles, was ihm seine Gefährten an Bord während der vielen Jahre langweiliger Wachdienste an Deck hatten erzählen können.
Eine Tür führte in eine Würfelbude, die nächste in eine Schenke oder in ein Bordell. Schwere Kaleschen, von Pferden mit kostbarem Geschirr gezogen, fuhren die einzige Hauptstraße dieser chaotischen Stadt auf und ab, während schöne Frauen jeglicher Herkunft und allen Alters schamlos ihre Reize zur Schau stellten und sich von jedem potentiellen Klienten begrapschen ließen, der seine appetitliche »Ware« prüfen wollte, bevor er sie kaufte.
Von den weiten Baikonen forderten halbnackte Mädchen zischelnd die Passanten auf, über kurze Treppen zu ihnen hinaufzusteigen, und an den Türen der Spielhöllen priesen schwarze Sklaven mit riesigen Körben und schallenden Stimmen die besten Würfelpartien der gesamten Insel an.
Auf halber Höhe der Straße stieß Sebastián auf das riesige Schild, das die weltberühmte Schenke der»Tausend Jakobiner« ankündigte. Neugierig beschloß er, einen Blick auf den später nie mehr benutzten Tisch zu werfen, auf dem die Würfel gerollt worden waren, die in einer einzigen Nacht den unglücklichen Vent en Panne steinreich und bettelarm gemacht hatten.
Da stand er, stattlich und robust, auf einem kleinen Podest aus dunklem Mahagoni: ein absurdes und sehr eigenwilliges Denkmal, das die Seeräuberei in ihrer reinsten Form zu verkörpern schien. Dieses kleine Möbelstück symbolisierte alle Niedertracht und Größe in den Herzen der Menschen, die sich dem gefährlichsten und verrufensten Handwerk auf Erden verschrieben hatten.
Mehr als jede Kanone, jeder Säbel oder jede schwarze Totenkopfflagge machte dieser historische Tisch deutlich, was es hieß, ein Pirat zu sein: genügend Mumm zu haben, um alles bis auf den letzten Maravedi oder den letzten Tropfen Blut in einem schlichten Spiel zu riskieren.
Mit dem Vermögen, das der Pechvogel Vent de Panne in einer einzigen Nacht gewonnen und verloren hatte, hätten zwanzig Männer hundert Jahre lang in Luxus leben können. Augenzeugen erzählten jedoch, daß der gleichmütige Franzose, nachdem er schließlich auch noch seinen Stock mit Goldknauf, sein besticktes Hemd und seine Uniformjacke verspielt hatte, lediglich mit einem fröhlichen Lächeln auf den Lippen gemurmelt hatte:
»Was für eine beschissene Nacht!«
Zweifellos war das der Grund, warum die Männer von Port-Royal nicht den gerissenen Francis Drake, den tapferen Sir Walter Raleigh, den brutalen L’Olonnois, den galanten Chevalier de Grammont oder den unbesiegbaren Henry Morgan als größten ihrer Helden in den Himmel hoben, sondern den glücklosen Vent en Panne. Er stand für alles, was sie in ihrem Leben hatten sein wollen.
Sebastian streckte die Hand nach dem Tisch aus, als ihn eine Rothaarige, die sich den Ausschnitt von einem sehr erregten Freier küssen ließ, geradezu hysterisch warnte:
»Rühr ihn nicht an! Rühr ihn nicht an, wenn du nicht willst, daß dich das Pech bis zum Galgen verfolgt.«
»Gott bewahre mich davor!« entgegnete er und zog hastig die Hand zurück. »Ist das wahr?«
»Und ob!« erwiderte die attraktive Hure. »Aber wenn du willst, daß dir das Glück treu bleibt, gieß einige Tropfen vom besten Rum darauf und schenk dem Großen Spieler einen freundlichen Gedanken.«
Sebastian bestellte einen Krug vom besten Rum und ließ einige Tropfen auf den Tisch fallen. Anschließend nahm er in der entlegensten Ecke des großen Saals Platz und beobachtete das Kommen und Gehen der Huren und Betrunkenen, die das Vergnügen, das man hier kaufen und mieten konnte, voll auskosten wollten, als wären die meisten von ihnen überzeugt, daß dies vielleicht die letzte Nacht ihres Lebens sein könnte.
Bei der Gelegenheit entdeckte er ein dickes Seil mit Galgenschlinge, das in dieser Ecke der Schenke von einem Stützbalken hing. Daher nahm er das fleißige Mädchen, das mit Krügen an ihm vorbeilief, am Handgelenk:
»Was soll das bedeuten?«
»Laß den Rum lieber heute in Strömen durch die Kehle fließen, denn schon morgen kann dir eine Schlinge wie diese die Gurgel endgültig abschnüren.«
»Etwas makaber, findest du nicht?«
Das Mädchen deutete auf den mürrisch dreinblickenden Wirt, der hinter der Theke Gläser spülte.
»Erzähl das dem Hinkebein! Aber ich warne dich, den letzten, der sich beschwert hat, hat er bis zum Morgen an einem Bein aufgehängt.«
Sie eilte weiter, und Sebastian beließ es dabei, schweigend weiterzutrinken, bis die ausgelassene Rothaarige, die der wenig einträglichen Zuwendungen ihres begeisterten Bewunderers offensichtlich müde war, ihm gegenüber Platz nahm.
»Hallo!« begrüßte sie ihn mit einem Lächeln. »Ich heiße Astrid, und du?«
»Sebastián.«
»Ich bin eine Hure. Und du?«
»Navigator.«
»Navigator?« wiederholte das Mädchen und beugte sich vor, vielleicht um ihre schönen Brüste besser zur Geltung zu bringen, vielleicht weil sie diese Mitteilung wirklich interessierte. »Tatsächlich ein Navigator?«
»Tatsächlich.«
»Spanier?«
»Zur Hälfte Spanier.« Der Margariteno lächelte und senkte seine Stimme, als wolle er ein Geheimnis verraten. »Aber auf diese Hälfte habe ich schon vor Jahren verzichtet.«
»Bist du in die Navigatorenschule der Casa gegangen?«
»Nein.«
»Schade!« bedauerte die Dirne. »Wenn du in der Schule der Casa studiert hättest, dann hätte ich dir die beste Arbeit der Welt anbieten können.«
»Die habe ich schon.«
Die rothaarige Astrid lehnte sich zurück und sah ihm direkt in die Augen, während sie überzeugt mit dem Kopf schüttelte.
»So eine nicht! Ich kenne einen Kapitän, der einem abtrünnigen Navigator fünftausend Pfund Heuer und ein Fünftel der Beute bietet.«
Jacare Jack ließ einen Pfiff der Bewunderung hören.
»Verdammt! Das ist wirklich sehr viel Geld. Aber ich sag dir was: Kein Kapitän auf der ganzen Welt gibt seinem Navigator ein Fünftel seiner Beute ab, nicht einmal einem abtrünnigen Spanier.«
»Dieser schon.«
»Wahrscheinlich, weil er nichts zu verteilen hat. Und ein Fünftel von nichts ist nichts.«
Von neuem beugte sich die Rothaarige vor, und das Schauspiel, das sie bot, ließ einen Mann nicht gleichgültig, der seit Monaten nichts Vergleichbares genossen hatte.
»Dieser hat eine Menge zu verteilen«, säuselte sie. »Mehr als nichts, und wenn du wirklich ein guter Navigator bist, solltest du darüber nachdenken…« Wieder sah sie ihm direkt in die Augen. »Wollen wir darüber im Bett weiterdiskutieren?«
»Warum nicht?«
Die rothaarige Astrid wohnte in einer einladenden Hütte fast unmittelbar hinter der Schenke der »Tausend Jakobiner« und direkt am Meer. Manchmal umspülten die sanften Wellen, die über das Riff schwappten, sogar die Pfähle der Hütte.
Da Astrid eine wunderbare »Professionelle« war, reinlich, erfahren und sehr amüsant, verbrachte der Margariteno bei ihr eine überaus beneidenswerte Nacht. Dann servierte sie ihm ein großzügiges Glas Rum und fragte ihn weiter aus:
»Bist du wirklich ein guter Navigator?«
»Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich halte mich wirklich für einen guten Navigator, aber ich habe nicht das geringste Interesse, das Schiff zu wechseln. Man bezahlt mich sehr gut.«
Sie blickte ihm fest in die Augen, fuhr sich über die Nase, und schließlich murmelte sie etwas spröde:
»Ich weiß nicht, aber ich habe den Eindruck, daß du wirklich gut bist.« Sie blinzelte ihm zu. »Wenn auch nicht besser als im Bett, und wenn du mit dem Kapitän redest, bin ich sicher, daß er deine Heuer vielleicht sogar verdoppelt.«
»Hör mal zu, Kleine!« sagte Sebastian, während er mit der Zungenspitze über ihre rosigen Brustwarzen fuhr. »Ich gehe davon aus, daß du in guter Absicht handelst, doch ich kenne das Gewerbe und weiß, daß kein Kapitän so verrückt ist, einem einfachen Navigator zehntausend Pfund Heuer und ein Fünftel der Beute anzubieten. Da will dich einer betrügen.«
Astrid nahm ihn am Kinn, hob sein Gesicht und näherte sich ihm, bis ihre Lippen fast seine Nase streiften und schüttelte ein ums andere Mal den Kopf, während sie flüsterte:
»Mombars betrügt niemals. Er raubt, brandschatzt, foltert und mordet, aber niemals betrügt er.«
Sebastián Heredia sprang auf, als hätte ihn eine giftige Schlange gebissen.
»Mombars, der Todesengel!« rief er entsetzt aus. »Gütiger Gott! Bist du verrückt geworden? Dieser Kerl ist ein Sadist.«
»Nicht bei seinen Leuten«, tönte es seelenruhig zurück. »Seine Männer verehren ihn.«
»Wilde, die ihn für einen Gott halten!« entgegnete der Margariteno, ging auf eine winzige Balustrade hinaus und betrachtete das Meer, in dem sich die Mondsichel spiegelte. »Außerdem soll er sich schon vor Jahren zurückgezogen haben. Einige sagen sogar, daß er tot ist.«
»Er ist quicklebendig, kehrt aufs Meer zurück und wird bald kommen, auch wenn er sein Schiff niemals in der Bucht ankern läßt. Soll ich ein Treffen mit ihm arrangieren?«
»Mit Mombars?« empörte sich Sebastián Heredia. »Ich müßte verrückt sein!«
Bei der Eroberung Jamaikas leisteten sich die Engländer eine Reihe kapitaler Irrtümer, die es durchaus mit der stellenweise geradezu stümperhaften Vorgehensweise aufnehmen konnten, mit der sich die Spanier in der Neuen Welt etablierten.
Als Oliver Cromwell den Zeitpunkt für gekommen sah, seinen schlimmsten Feind im Herzen des spanischen Weltreichs zu bekämpfen, ernannte er William Penn – den Vater des Mannes, der das spätere Pennsylvania kolonisierte – zum Kommandanten einer 38 Schiffe zählenden Flotte. Auf dieser sollten sich Soldaten unter dem Oberbefehl von General Robert Venables einschiffen, um die Insel Santo Domingo oder Hispaniola zu erobern, die zu dieser Zeit entvölkert und weitgehend ohne Verteidigung war.
Nach kurzem Aufenthalt auf Barbados gingen knapp 7000 Männer an der Küste von Santo Domingo an Land. Sie wußten, daß der spanische Gouverneur, der Conde de Pefialva, lediglich auf etwas über hundert Veteranen zählen konnte.
Die Schlacht zwischen zwei so ungleichen Gegnern hätte man getrost als Fußnote der Geschichte abhaken können, wäre Robert Venables nicht einer der unfähigsten Strategen in einer langen Kette unfähiger Generäle gewesen. Statt die Hauptstadt im. Sturm zu nehmen, landete er weit entfernt an einer unwirtlichen Küste und zwang seine Männer, tagelang in brütender Hitze vorzurücken. Wie die Fliegen sanken die bedauernswerten Soldaten zu Boden, die an ein wesentlich milderes Klima gewohnt waren.
Admiral Penn, der den General verachtete und haßte, ließ ihn voller Schadenfreude an Land herumirren und wartete in aller Seelenruhe darauf, daß Venables ihn schließlich um Hilfe anflehen würde, um ihn aus der grausamen Falle zu befreien, die er sich selbst gestellt hatte. Eine kleine, aber kampferprobte Schar spanischer Soldaten des Conde de Penalva wandte nämlich eine schlaue Guerilla-Taktik an, mit der sie die blauäugigen Engländer unbarmherzig dezimierte.
Als es Penn schließlich dämmerte, daß eine spanische Hundertschaft ausreichte, das starke Expeditionskorps zu vernichten, war es bereits zu spät: Die meisten Männer waren tot oder desertiert, und diejenigen, die es schafften, an Bord der Schiffe zurückzukehren, boten ein Bild des Jammers.
Angesichts eines so kapitalen Fehlschlags, für den sich beide in gleicher Weise verantwortlich fühlten, kamen William Penn und Robert Venables überein, die Anker zu lichten und die Nachbarinsel Jamaika zu »erobern«. Dort, davon waren sie überzeugt, gab es keine gefürchteten spanischen Soldaten. Sie nahmen die Insel in Besitz, pflanzten ihre Fahne auf, gründeten Port-Royal und hinterließen dort eine große Garnison. Anschließend kehrten sie nach London zurück, um Oliver Cromwell zu berichten, daß sie statt des »dürren« Santo Domingo lieber das fruchtbare Jamaika erobert hatten.
Als Lohn für ihre Mühe warf sie der Lord Protector von England in den Tower von London, netterweise immerhin in benachbarte Verliese. So konnten sie sich zu jeder Tages– und Nachtzeit Beleidigungen an den Kopf werfen.
Selbst Cromwell mußte aber einräumen, daß er endlich einen Brückenkopf in den Antillen hatte, auch wenn es nur das wilde Jamaika war. Doch um sich dort zu halten, mußte er die Insel mit englischen Bürgern bevölkern.
Die englischen Bürger teilten jedoch seine Begeisterung für das heiße Moskitoreich überhaupt nicht. Auf die patriotischen Aufrufe antworteten sie, wenn Cromwell von Engländern verlangte, sich von Moskitos auffressen zu lassen, sollte er gefälligst selbst fahren.
Weil sich die Engländer stur stellten, ließ Oliver Cromwell seinen Sohn Henry, den er zum General der in Irland stationierten Truppen ernannt hatte, gesunde junge Männer und Frauen einfangen, um Jamaika zu bevölkern. Er selbst verfrachtete alle Schotten, die in diesem Augenblick im Gefängnis saßen, in die Karibik.
Auf diese Weise schickte Großbritannien in nicht einmal vier Jahren über siebentausend weiße Sklaven nach Jamaika. Diese mußten auf ihre klingenden Nachnamen schottischer oder irischer Herkunft verzichten und solche annehmen, die dem Lord Protector besser gefielen und von Städten, Farben, Blumen oder Berufen hergeleitet wurden.
Auf Jamaika zahlten die Zuckerpflanzer 1500 Pfund für jeden dieser Sklaven, und bis zu zweitausend, wenn es sich um ein schönes Mädchen handelte.
Mit dem steigenden Rumkonsum wurden aber auch die Plantagen immer größer, was den Bedarf an Arbeitern in die Höhe schnellen ließ. So entwickelte sich in England ein regelrechter Handel mit geraubten Kindern niedriger Herkunft, die man als Schmuggelware in die Kolonien schickte. Gleichzeitig stand auf das lächerlichste Delikt, das noch nicht einmal bewiesen sein mußte, eine Mindeststrafe von vier Jahren Zwangsarbeit auf den Zuckerplantagen.
Natürlich kassierte die Krone einen saftigen Anteil an dem Preis, den die »Importeure« für diese menschliche Fracht bezahlten. Dann entschlossen sich die Königin, der Herzog von York und Prinz Rupert dazu, die Royal African Company zu gründen, die Sklaven auf dem schwarzen Kontinent einfing. Es hatte sich nämlich erwiesen, daß Afrikaner die harte Arbeit in drückender Hitze eher aushielten als Weiße.
In einem Zeitraum von etwas über zwanzig Jahren führte das königliche Unternehmen an die 80 000 schwarze Sklaven zum durchschnittlichen Preis von 17 Pfund pro Kopf ein. Der Handel war allgemein soweit akzeptiert und einträglich, daß sich sogar Lloyds einschaltete, die menschliche Fracht versicherte und zehn Pfund für jeden Kranken zahlte, der »ins Meer zu werfen war, damit er die übrige Ladung nicht anstecken konnte«.
Der grausame Menschenhandel wäre auf diese Weise wohl noch lange weitergegangen, hätte nicht ein Jahrhundert später ein gewisser Kapitän Collingwood aus Liverpool nahezu tausend Männer, Frauen und Kinder ins Meer werfen lassen. Das war der Mehrheit des bis dahin »verständnisvollen« Parlaments dann doch zu viel.
Als Sebastián Heredia bei Tagesanbruch fast widerstrebend das warme Bett der feurigen Astrid verließ, war er überrascht, daß es in den Straßen von Port-Royal trotz der frühen Morgenstunde vor Leuten geradezu wimmelte. Jetzt waren es aber keine Huren und Betrunkene mehr, sondern Geschäftsleute, die in der Morgenkühle ihre Transaktionen abwickelten, bevor sie vor der Tropenhitze in ihre vornehmen Häuser flüchteten.
England war zwar mit anderthalb Jahrhunderten Verspätung in der Neuen Welt gelandet, das aber mit der Geschäftstüchtigkeit eines Privatunternehmens, dessen Aktivitäten nicht ständig von bürokratischen Blutsaugern der Casa de Contratación von Sevilla abgewürgt wurden.
Während man in der übrigen Karibik zur höheren Ehre Gottes und der Krone eher schlecht als recht lebte, machte man auf Jamaika und Barbados lieber Geschäfte zur höheren Ehre der Menschen. Das »weiße Gold«, der Zucker, versetzte Berge, während die Seeräuberei inzwischen die Meere zum Kochen brachte.
Das Geld wechselte mit faszinierender Geschwindigkeit den Besitzer, und der Geruch des schnöden Mammons zog Menschen aus allen möglichen Ländern an. Denen ging es nicht mehr so sehr um das schnelle Geld mit Seeräuberei, Glücksspiel oder Prostitution: Sie wollten lieber auf »ehrlichere« Weise reich werden, auch wenn das länger dauerte.
»Ein kühles Herrenhaus mit Gärten, Meerseite und weit weg von indiskreten Blicken?«‘ wiederholte der beflissene kleine Mann mit strohgelbem Spitzbart und kreisrunden Brillengläsern die Frage von Sebastian Heredia. »Ihr seid an die richtige Adresse geraten, Senor. Wir sind auf solche Aufträge spezialisiert. Übrigens war Seine Exzellenz, Kapitän Henry Morgan, einer unserer besten Kunden.«
»Das wußte ich«, entgegnete der Margariteno, dem das große, dunkel getäfelte Büro, das man offenbar Tisch für Tisch und Stuhl für Stuhl vom Themseufer hierher versetzt hatte, befremdlich schien. »Darum bin ich hier. Man hat mir versichert, daß Ihr alles, was Ihr nicht habt, bauen lassen könnt. Ist das wahr?«
»So wahr wie eine gerechte Sonne auf uns scheint. Unsere Architekten sind ohne Zweifel die besten der Insel. An welche Summe hattet Ihr gedacht?«
»Was nötig ist.«
»Was nötig ist?« wiederholte das Männchen mit breitem Grinsen und lächelte ihm verschwörerisch zu. »Eure Geschäfte gehen sicher blendend.« Er rieb sich ein ums andere Mal die Hände, was ihn zutiefst glücklich zu machen schien. »Sehr gut! Wollen mal sehen! Im Augenblick verfüge ich über eine Villa bei Caballos Blancos, die meiner Meinung nach perfekt geeignet wäre.« Er lächelte wieder. »Eine schöne Dame kann sich dort sehr angenehm die Zeit vertreiben, während sie auf die Rückkehr ihres Geliebten wartet.«
»Wann könnte ich sie besichtigen?«
Mister Cook, dessen Nachname, Spitzbart und gepflegte Jacke die übrige Inselbevölkerung darauf hinwies, daß er einer der zahllosen Iren war, die vor Jahren zwangsweise in die Kolonie hatten auswandern und dabei Name und Kleidungsgewohnheiten hatten ändern müssen, blickte auf seine Taschenuhr, dann durch das große Fenster auf den Himmel, dann entgegnete er mit eher mäßiger Begeisterung:
»Wir kommen zwar noch in der Morgenkühle hin, aber die Rückfahrt wird sehr stickig sein.«
»Die Hitze macht mir nichts aus.«
»Ich dagegen finde sie gräßlich. Zwar bin ich dem Land sehr dankbar, daß es mir meinen Wohlstand ermöglicht hat, aber an zwei Dinge werde ich mich nie gewöhnen: die Hitze und die Moskitos.« Er lächelte belustigt. »Wißt Ihr, daß Kolumbus einmal gesagt hat, daß die schlimmsten Feinde, mit denen er es in seinem Leben zu tun gehabt hatte, die Moskitos der Nordküste Jamaikas waren?«
»Nein«, gab der Margariteno zu. »Das wußte ich nicht.«
»Aber so ist es. Laßt Euch also niemals an der Nordküste nieder. Hier treibt der Südwind die Moskitos ins Landesinnere, doch dort oben ist es umgekehrt, und ich garantiere Euch: Das haltet Ihr nicht aus.«
Mister Cook erzählte weiter von seiner Insel und ihren Eigenarten, während sie in einer kleinen Kutsche, die von einem schweißglänzenden Pferd gezogen wurde, auf einem breiten und gepflegten Weg entlangfuhren. Er führte an der Küste entlang, an der immer wieder Fischerhütten auftauchten, während sich weiter landeinwärts luxuriöse Herrenhäuser erhoben, umgeben von ausgedehnten Zuckerrohrplantagen, auf denen Dutzende von Sklaven schufteten.
»Meiner Meinung nach macht man in Caballos Blancos den besten Rum«, kommentierte der Ire. »Die Fabrik gehört einem Schotten, der in nur wenigen Jahren damit steinreich geworden ist. Mir ist zu Ohren gekommen, daß er davon träumt, in seine Heimat zurückzukehren, um dort eine große Whiskybrennerei aufzubauen.« Er wandte sich Sebastian zu, ohne die Zügel schleifen zu lassen. »Vielleicht wollt Ihr Euch in den Rumhandel begeben? Diese Fabrik wäre eine großartige Investition und vielleicht könnten wir…«
Kapitän Jacare Jack unterbrach ihn und deutete auf die verkohlten Ruinen eines riesigen Hauses auf einem wunderschönen Landvorsprung, das von hohen Palmen, schattigen Bäumen und zahlreichen farbenprächtigen Blumenbeeten umgeben war. Über einem blauen, kristallklaren Korallenmeer zeichneten sich schwarze Balustraden und Balken ab.
»Was ist das?« fragte er.
»Ruinen!« erwiderte der andere mürrisch.
»Das sehe ich. Aber die Lage ist hinreißend. Wem gehören sie?«
»Heute niemandem mehr. Einmal war das die luxuriöseste Villa der Insel. Kapitän Bardinet hat sie erbaut.«
»Was ist passiert?«
»Das ist eine traurige Geschichte.«
»Die würde ich gern hören.«
Sein Gegenüber blickte ihn mit Befremden von der Seite an. Er schien zu zögern, doch schließlich zuckte er mit den Schultern und fing an zu erzählen, ohne das abgebrannte Haus zu seiner Rechten aus den Augen zu lassen:
»Kapitän Bardinet lebte nicht nur vom Rum, sondern auch von Schiffen… Ihr wißt, was ich meine. Eines Tages lernte er in London ein wunderschönes und zartes Fräulein von hohem Stand kennen, heiratete sie, brachte sie auf die Insel und baute ihr diese Villa. Jahrelang waren sie das glücklichste Paar auf Jamaika, obwohl der Kapitän als einer der Stellvertreter Morgans oft auf See war. Als er nach der Eroberung Panamas mit seinem Anteil an der riesigen Beute zurückkehrte, lief er schnurstracks zu seinem Haus, weil seine Frau kurz vor der Niederkunft ihres ersten Kindes war. Leider starb sie während der Geburt, was den Kapitän in tiefste Verzweiflung stürzte. Die ging allerdings in schäumende Wut über, als ihm die Hebamme die Schuldige am Tod seiner über alles geliebten Frau brachte: ein schwarzes Mädchen.«
»Ein schwarzes Mädchen?« wiederholte Sebastian überrascht.
»Genau! Offensichtlich hatte sich das Früchtchen, wenn ihr Gatte verreist war, so ziemlich mit jedem Sklaven der Plantage verlustiert.«
»Potz Blitz!«
»Ihr sagt es! Blitz und Donner! Kapitän Bardinet stürmte in die Baracke der Sklaven, kastrierte sie bei lebendigem Leib und schlug ihnen anschließend persönlich der Reihe nach den Kopf ab. Zu guter Letzt steckte er das Haus in Brand, ging an Bord seines Schiffs und verschwand.«
»Eine traurige Geschichte!«
»Sehr traurig, Senor. Vor allem, wenn man bedenkt, daß dieses Fräulein aussah, als könne es kein Wässerchen trüben. Stille Wasser sind tief!«
Schweigend fuhren sie weiter, bis sie zwanzig Minuten später die gesuchte Hacienda erreichten: in der Tat ein verschwiegenes, kühles und angenehmes Haus, bemerkenswert gut möbliert und nicht einmal dreihundert Meter von einem breiten Strand entfernt, an den sanft die Wellen spülten.
Sebastián Heredia sah sich jedes Zimmer an, dann nahm er unter dem Portal Platz. Der Ire sah ihn aufmerksam an, bis Sebastian schließlich nickte.







