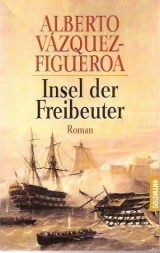
Текст книги "Insel der Freibeuter"
Автор книги: Alberto Vazquez-Figueroa
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Sebastian Heredia Matamoros erblickte das Licht der Welt an der Costa del Crepúsculo. Die friedliche Meeresbucht mit den weiß getünchten Hütten des Fischerdörfchens Juan Griego, über dem die düstere Festung La Galera aufstieg, wurde damals wegen ihrer herrlichen Sonnenuntergänge so genannt. Die Bucht lag im Nordosten der kleinen Insel Marga-rita, die schon zu Zeiten von Kolumbus berühmt war, da man hier die schönsten Perlen der Welt aus dem kristallklaren Wasser holte.
Wie fast alle Dorfbewohner, so tauchte auch Sebastiáns Vater Miguel Heredia Ximénez in die schwindelnden Tiefen hinab, um nach Austern zu suchen. Abend für Abend ruinierte sich dann seine Frau Emiliana Matamoros die Hände dabei, wenn sie die rauhen Muschelschalen in der Hoffnung knackte, darin einen perlmuttschimmernden Schatz zu finden, der die Not der Familie lindern würde.
Von seinem achten Geburtstag an begleitete Sebastian Heredia Matamoros seinen Vater aufs Meer hinaus. Seine Hauptaufgabe bestand darin, etwas zum Abendessen zu angeln und gleichzeitig aufzupassen, daß sich keine Haie anpirschten, die seit jeher die schlimmsten Feinde der rastlosen Taucher waren.
Nach der Heimkehr durfte er mit seinen Freunden am Strand spielen, doch kaum war das unvergleichlich flammende Abendrot Margaritas in tiefes Schwarz übergegangen, setzte er sich an einen grob gehauenen Tisch, um beim Schein einer Kerze aus Schildkrötenwachs zu lernen und dabei sanft die Wiege seiner Schwester Celeste zu schaukeln.
So prägte das Meer und das eine oder andere Buch das Leben des jungen Sebastián Heredia Matamoros. Darüber hinaus prägte ihn sowohl sein Vater, dessen unglaubliche Opferbereitschaft er bewunderte, wenn dieser tagtäglich seine Haut an den Felsen und Korallen ließ, als auch die unvergleichliche Schönheit seiner Mutter. Ihr Antlitz glich einem Madonnenbild, und ihr reizvoll gerundeter Körper blieb auch nach zwei Geburten und der täglichen Arbeit in der Sonne makellos wie eh und je.
Der Alltag der Heredia Matamoros war zwar voller Entbehrungen, doch tröstete man sich damit, ab und an die eine oder andere wertvolle erbsengroße Perle zu finden, die einem der alte Omar Bocanegra zu einem guten Preis abkaufte. Außerdem gab es stets die Hoffnung, eines Tages eine riesige Perle zu finden, das Tor zu einer Zukunft in Wohlstand.
Einige fahre später, als Sebastian schon fast zwölf Jahre alt war, landete jedoch ein neuer Abgesandter der Casa de Contratación von Sevilla auf der Insel, mit dem alle Hoffnungen auf eine bessere Zukunft zerstoben.
Bis zu diesem rabenschwarzen Tag war Margarita von den strengen Handelsbestimmungen, die im übrigen Westindien herrschten, weitgehend verschont geblieben. Dann aber schlug Hernando Pedrárias Gotarredona im prunkvollen Palais der Hauptstadt La Asunción sein Quartier auf und ließ unverzüglich einen Erlaß verkünden. Darin drohte er jedem seiner Untertanen sechs Jahre Kerker an, der es wagen sollte, sich über die Anweisungen der allmächtigen Casa de Contratación hinwegzusetzen. Die bescheidenen Hoffnungen der Margaritenos lösten sich auf wie Salz im Meer.
Die von allen verfluchte Casa de Contratación zahlte nämlich gewöhnlich für Perlen nur ein Zehntel des tatsächlichen Werts. Außerdem erhielt man dafür nicht einmal Geld, sondern nur Naturalien, auf deren Import aus Spanien die Casa ein Monopol hatte.
Zölle und Transportkosten verteuerten diese Waren zudem um das Vierzigfache. Das führte zur absurden Situation, daß man für drei wunderschöne Perlen von makelloser Reinheit gerade mal einen Hammer oder zwei Meter gröbsten Stoff eintauschen konnte.
Wer sich mit einer solchen Ungerechtigkeit nicht abfinden wollte, dem blieb nichts anderes übrig, als die Perlenfischerei aufzugeben, denn die Casa de Contratación hatte schon seit Anno 1503 das Monopol auf den Perlenhandel, wie übrigens auf alle übrigen Schätze inklusive derer, die im Westen des großen finsteren Ozeans noch auf ihre Entdeckung warteten. Zudem waltete die Casa als Mentor des Obersten Indienrats, der wiederum dafür zu sorgen hatte, daß man in der Neuen Welt die spanischen Gesetze auch wirklich befolgte.
Aus der würdevollen, von Hoffnung erfüllten Armut der Heredia Matamoros war auf diese Weise hoffnungsloses Elend geworden. Der kleine Sebastian spürte als erster, wie tiefe Mutlosigkeit seinen bis dahin unbeugsamen Vater befiel.
Zwar fuhren die beiden nach wie vor jeden Morgen aufs Meer hinaus, doch statt unverzüglich die gefährlichen Abgründe anzusteuern, in denen ein mutiger Taucher zwischen Felsen und Algen die »Mutter aller Austern« finden konnte, kreuzten sie schweigend und ziellos auf dem Wasser. Denn was für einen Sinn hatte ihre Arbeit noch, wenn selbst der größte Erfolg stets zum bitteren Fehlschlag wurde?
Als sich dann noch eines Tages herumsprach, daß ein Taucher aus Boca del Pozo für eine fast makellose Perle, so groß wie eine Wachtel, lediglich zwei zerbeulte Kochtöpfe und ein verrostetes Messer erhalten hatte, entschied die Mehrheit der Margaritenos, daß ein so läppischer Lohn das Risiko nicht lohnte, sich von einem Hai das Bein abreißen zu lassen. Und bald fuhren sie nur noch hinaus, um Fische und Langusten für das Abendessen zu fangen.
Trotz alledem fiel es dem anmaßenden Hernando Pedrárias Gotarredona nicht im Traum ein, den Grund für den starken Rückgang in der Perlenproduktion bei den ruinösen Preisen zu suchen, die er selbst festgelegt hatte. Vielmehr lud er alle Schuld auf den müden Schultern des armen Omar Bocanegra ab, dem er vorwarf, weiterhin heimlich Perlen anzukaufen, und wenn er ihn schon nicht aufhängen ließ, dann nur deshalb, um ihn in den modrigsten und tiefsten Kerker zu werfen und nicht eher freizulassen, bis er »das Geraubte ausgespuckt habe«.
Aus schier unerfindlichen Gründen machten die Fischerboote jedoch nach wie vor einen Bogen um die vielgerühmten Perlengründe, bis der frischgebackene Vertreter der Casa de Contratación sich allmählich den Kopf darüber zerbrach, was ihm wohl blühen würde, sollte es eines schönen Tages seinen Vorgesetzten – den König eingeschlossen – auffallen, daß ab dem Tag, an dem er, Hernando Pedrárias Gotarredona, sein Amt angetreten hatte, Margarita aufgehört hatte, eine der wertvollsten »Juwelen der Krone« zu sein.
Alle Jahre wieder wartete der spanische Hof nämlich gespannt auf die Ankunft der Indienflotte mit ihren fabelhaften Schätzen: Gold aus Peru, Silber aus Mexiko, Smaragde aus Neu-Granada, Diamanten aus Caroni und eben Perlen aus Margarita. Nun hätte der Gesandte der Casa in Potosá gut und gerne behaupten können, tut uns leid, Majestät, die dortigen Goldminen sind erschöpft, doch wer hätte Don Hernando schon abgenommen, daß sämtliche Austern der Karibik über Nacht beschlossen hätten, keine Perlen mehr zu produzieren?
Also grübelte Don Hernando wochenlang über sein Problem nach, doch als guter Beamter und Absolvent der Verwaltungsschule der Casa kam er auf alles, nur nicht auf das Naheliegende: schlicht und einfach einen gerechten Preis für die Perlen zu zahlen. Seitdem Don Hernando seinen Verstand gebrauchen konnte, hatte man ihm nämlich eingebleut, daß auf dieser Welt nur zählte, für jedes Schwert, jeden Meter Stoff, ja für jeden Nagel, der den Ozean überquerte, den maximalen Profit einzustreichen.
Das absolute und aberwitzige Monopol, das die Katholischen Könige der Casa de Contratación verliehen hatten, hatte diese in ein so kompliziertes Paragraphennetz eingesponnen, daß sich die spanischen Kolonien trotz der mannigfaltigen Reichtümer der Neuen Welt fast drei Jahrhunderte lang nie wirklich entfalten konnten.
Die Idee des sevillanischen Kirchenmannes Rodriguez de Fonseca, der seinerzeit die höchste Autorität des Westindienhandels war und das uneingeschränkte Vertrauen von Isabella der Katholischen genoß, war anfänglich ja so abwegig nicht gewesen. Die Beziehungen mit den von Kolumbus gerade erst entdeckten Ländern hatten wohl tatsächlich eine wirtschaftliche und juristische Instanz nötig, die Unternehmungen in geordnete Bahnen lenken und Banditen und Abenteurer daran hindern konnte, anarchische Zustände herzustellen.
Doch obwohl Rodriguez de Fonseca sich so weit wie möglich an das erfolgreiche Vorbild der portugiesischen Casa de Guinea anzulehnen gedachte, nahmen seine grandiosen Fehlentscheidungen geradezu historisch fatale Ausmaße an.
Schon die Bestimmung seiner Heimatstadt zum Sitz der Casa war ein kapitaler Mißgriff. Das landeinwärts gelegene Sevilla war in jeder Hinsicht mit der Abwicklung des Schiffsverkehrs überfordert, den die Entwicklung eines so großen Kontinents mit sich brachte. Die meisten schweren Galeonen mußten bei den Sandbänken der Flußmündung des Guadalquivir vor Anker gehen. Dort schaffte man die Ladung auf riesige Flöße, die dann in endlosen Konvois flußaufwärts zogen, wobei man Unmengen Ware, Zeit und Geld verlor.
Obwohl jedes Kind die Absurdität dieser Fehlentscheidung hätte erkennen können, ließ sich die Casa sage und schreibe 217 Jahre Zeit, um diesen Unfug zu korrigieren und ihren Sitz in den benachbarten und perfekten Naturhafen Cádiz zu verlegen.
Der zweite und wahrscheinlich noch schlimmere Irrtum des Kanonikers Fonseca war sein frommer Glaube, unter den Legionen von Gesandten, Richtern, Ratgebern, Inspektoren und Unterinspektoren, die im Laufe der Zeit den unübersichtlichen Verwaltungsapparat der Casa aufblähten, würde es niemals einen korrupten Beamten geben. Dabei hatte doch die Geschichte schon gelehrt, daß man in Wahrheit unter den Tausenden, die unter Freunden und Verwandten ausgewählt worden waren, wohl schwerlich eine einzige absolut ehrliche Haut finden konnte.
Die logische Folge war, daß nur wenige Jahre später ein Kolonist in Peru, Mexiko oder Santo Domingo, der einen Antrag auf Gründung einer Zuckermühle oder Betreiben einer Silbermine stellte, sechs bis zehn Jahre lang warten mußte, bis man ihm die entsprechende Genehmigung erteilte und das erforderliche Werkzeug zur Verfügung stellte.
Da man, um besagte Genehmigung zu erhalten, vorher unzählige Leute schmieren, außerdem das Werkzeug im voraus bestellen und in Gold aufwiegen mußte, ist leicht zu verstehen, warum die Träume der meisten »Unternehmer« des neuen Kontinents nur Schäume blieben.
Den Bewohnern von Margarita ging es von nun an auch nicht anders. Bald saßen die Perlentaucher nur noch am Strand und blickten müßig auf den ruhigen unerschöpflichen Ozean hinaus, in dessen Tiefen märchenhafte Schätze schlummerten.
Als die Perlentaucher geschlagene drei Monate lang die Hände in den Schoß gelegt hatten, traf Don Hernando Pedrárias eine folgenschwere Entscheidung, die seinem Charakter und seinem Gerechtigkeitssinn voll entsprach: Wenn die Fischer die Perlen nicht freiwillig suchen wollten, dann mußte man sie eben dazu zwingen. Flugs unterzeichnete Don Hernando den Erlaß, der jede Stadt und jedes Dorf, ja jede Hütte an der Küste dazu verpflichtete, eine Steuer zu bezahlen, und zwar in Perlen. Säumigen Zahlern würde die Casa de Contratación das Land konfiszieren. Dieses gehörte letzten Endes ja der Krone, und deren Besitz verwaltete nun einmal niemand anderer als die Casa selbst.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Empörung auf der Insel. Und selbst Hauptmann Sancho Mendana, Festungskommandant von La Galera, den ansonsten nichts aus der Ruhe bringen konnte, geriet in Rage und schwor, diesem kapitalen »Hurensohn« irgendwann die Ohren abzuschneiden, der die Laster der verfluchten Casa geradezu zu verkörpern schien, dieser »Casa de Castración«, wie man in ganz Westindien die allmächtige Behörde beschimpfte, die sich vom Schweiß und dem Blut so vieler ausgebeuteter Kolonisten ernährte.
Tatsächlich hatten viele Soldaten, die meisten Dorfpfarrer und so gut wie alle Siedler die Nase gestrichen voll, daß sich wahre Heerscharen unfähiger Beamte ständig in alle nur denkbaren Angelegenheiten einmischten. Da die Casa de Contratación jedoch schon immer alle Briefe aus der Neuen Welt öffnete, las und zensieren durfte, wenn sie in ihnen »aufrührerischen Inhalt« vermutete, gab es nur wenige, die ihr Mißfallen offen zum Ausdruck brachten. Schließlich konnte der Zensor unbequeme Briefeschreiber mit einem einzigen Federstrich ins hungrige Europa zurückschicken.
Um die Wahrheit zu sagen, aus der Organisation des seligen Kanonikers Rodriguez de Fonseca war ein feines Spinnennetz geworden, in dem keiner wagte, einen Mucks zu machen, um nur ja keinen Blutsauger anzulocken. In gewissem Sinne hatte sich die Casa de Contratación zu einer weltlichen Inquisition entwickelt.
Drei Wochen nach Verkündigung des ungerechten Erlasses beschloß Don Hernando Pedrárias Gotarredona, Juan Griego ohne Vorwarnung höchstpersönlich mit seinem Besuch zu beehren, um die Steuer einzufordern, die er nach eigenem Gutdünken für die Einwohner festgelegt hatte.
An einem heißen Nachmittag rollte seine prunkvolle vergoldete Kutsche, von zwei stolzen Hengsten gezogen, in Juan Griego ein. Angesichts der vielen bewaffneten Reiter, die Don Hernando bewachten, hätte man glauben können, statt eines einfachen Handelsgesandten der Casa den Vizekönig höchstpersönlich vor sich zu haben.
Sechs Stunden zuvor waren schon zwei schwer beladene Kutschen nach Juan Griego gekommen. Eine Heerschar von Lakaien hatte ein riesiges Zelt abgeladen und am Strand unter den Palmen aufgebaut: mit Tischen, Stühlen und einem luxuriösen Himmelbett. Sprachlos schauten die Dorfbewohner dieser verschwenderischen Demonstration von Reichtum zu, die einen arabischen Scheich vor Neid hätte erblassen lassen.
Sebastián Heredia Matamoros, der sich an die Hand seines Vaters klammerte, wollte seinen Augen nicht trauen. Endgültig die Fassung verlor er, als er entdeckte, daß sogar ein schlichtes Handwaschbecken aus Silber gefertigt war.
»Wie kann jemand nur so reich sein?« wollte er wissen.
»Er raubt es sich zusammen«, entgegnete sein Vater bitter, drehte sich um und verschwand am Horizont des Strandes. Ein gemurmeltes »Verdammter Hurensohn« war das letzte, was man von ihm hören konnte.
Bei Anbruch der Nacht ließ sich Don Pedrárias Gotarredona, ein blonder Mann von kräftiger, untersetzter Statur, mit strengen, sehr grünen Augen, in einem ausladenden Sessel nieder, um den berühmten Sonnenuntergang von Juan Griego zu genießen. Anschließend nahm er im flackernden Schein der Fak-keln sein Abendessen auf goldenen Tabletts ein und lauschte abwesend bis gleichgültig einem kurzen Konzert, das ihm die drei einzigen einheimischen »Musiker« darbrachten.
Schließlich zog er sich zur Nachtruhe zurück, denn bei Sonnenaufgang hatten sich alle Einwohner des Dorfes vor seinem Zelt zu versammeln, Kinder, Alte und Kranke eingeschlossen. Nur Schwerkranke waren von diesem Befehl ausgenommen.
Alle fanden sich zur festgelegten Stunde ein.
Alle außer Don Hernando, der in aller Seelenruhe weiterschlief – oder zumindest so tat –, während die Geladenen am Strand oder im Schatten der Palmen warteten und Hauptmann Sancho Mendana auf– und abmarschierte und sich in den Schnurrbart biß. Denn eigentlich hatte er große Lust, auf die höchste Zinne seiner Festung zu klettern, die Kanonen um 180 Grad drehen zu lassen und das provozierende Symbol einer so schreienden menschlichen Ungerechtigkeit in Schutt und Asche zu legen.
»Und dafür habe ich mein Leben im Kampf gegen die Piraten riskiert«, grollte er immer wieder vor sich hin. »Verfluchter Hurensohn!«
Nachdem Don Hernando dann schließlich doch aufgestanden war, gefrühstückt und mit gesammelter Inbrunst seine Morgengebete verrichtet hatte, nahm er im großen Thronsessel Platz und ließ sich vor seinem Tisch schweigend jede einzelne Familie von Juan Griego vorführen.
Er musterte sie alle mit strengem Blick und blätterte immer wieder im Bericht, den ihm ein Gehilfe reichte. Wenn sich die Dinge nicht binnen eines Monats bessern würden, schärfte er allen, die nicht auf der Insel geboren waren, mit ernster Stimme ein, sähe er sich gezwungen, ihre Aufenthaltsgenehmigung für die Kolonien zu widerrufen und sie mit dem nächsten Schiff zurück nach Zamora, Sevilla oder Badajoz zu schicken.
»Der Krone liegt nicht daran, daß sich die Neue Welt in eine Zuflucht für Vagabunden und Taugenichtse verwandelt«, schärfte er ihnen mit leicht ironischem Unterton ein. »Daher bin ich entschlossen, mit aller mir übertragenen Autorität die Kolonien ein für allemal von allen unnützen Schmarotzern zu befreien.«
Alle Bewohner Margaritas, die auf der Insel zur Welt gekommen waren, erinnerte er daran, daß die Strafe für säumige Steuerzahler sechs Jahre Kerker lautete, und »riet« ihnen daher, so schnell wie möglich mit ihren Booten in See zu stechen.
»Die Geduld der Krone hat ihre Grenzen«, schloß er unmißverständlich. »Und diese Grenzen sind nunmehr erreicht.«
Don Hernandos hochmütige Haltung wandelte sich jedoch urplötzlich, als man ihm die bescheidene Familie Heredia vorstellte. Denn kaum hatte der scheinbar gefühllose Generalbevollmächtigte der Casa de Contratación von Sevilla auf Margarita seine Augen auf Emiliana Matamoros gerichtet, verliebte er sich unsterblich in sie.
Aus heiterem Himmel schien ihn der Blitz getroffen zu haben: Seine Stimme versagte, die Hände zitterten, als ihm sein Schreiber das Schriftstück reichte, und kaum wagte er den Blick zu heben, aus Furcht, seine Augen könnten das Feuer verraten, das in seinem Herzen zu lodern begann.
Doch auch ohne diesen Blick wußte das Objekt seiner Begierde, was geschehen war, denn seit Emiliana bis drei zählen konnte, hatte es Männern bei ihrem Anblick die Sprache verschlagen.
Der einzige, der dagegen gefeit war – er sprach ohnehin nicht viel – war ihr Ehemann, und vielleicht hatte sie ihn gerade deshalb geheiratet.
Doch an diesem heißen Septembermorgen begriff Emiliana Matamoros, daß sie, barfuß und lediglich in ein grobes Kattunkleid gehüllt, zur absoluten Herrscherin über die Träume und den Willen eines Mannes geworden war, den man zu diesem Zeitpunkt als unbeschränkten Machthaber der Insel bezeichnen konnte.
Über zwanzig Jahre grübelte Sebastián Heredia Matamoros darüber nach, wie geschehen konnte, was er im Inneren seines Herzens niemals akzeptieren sollte: Seine Mutter hatte sich mit Leib und Seele an einen Menschen verkauft, der ihre eigenen Leute ausplünderte. Als Don Hernando Pedrárias Gotarredona fünf Tage später in seinen Palast nach La Asunción zurückkehrte, nahm Emiliana Matamoros neben ihm Platz, und ihnen gegenüber eine rebellische und empörte Celeste.
Sebastián aber rannte fort, um sich im Dickicht von Cabo Negro zu verstecken, und schwor sich immer wieder, lieber mit einem Stein um den Hals ins Meer zu springen, als auch nur einen Fuß in jene Kutsche zu setzen. Inzwischen schmachtete sein Vater als angeblicher Anstifter des »Streiks« der Perlenfischer auf der Insel in einem Verlies der Festung La Galera.
Eine Woche später, als Sebastián auf der Schwelle seines Hauses saß und mit bereits tränenlosen Augen zusah, wie die Sonne am Horizont verschwand, ließ sich Hauptmann Sancho Mendana neben ihm nieder und legte nach langem Schweigen seine riesige schwielige Hand auf den braunen Schenkel des Jungen.
»Ich hab in meinem Leben ja schon viel gesehen«, flüsterte er schließlich mit rauher Stimme. »Wirklich eine Menge! Monatelang war ich hinter Mombars, dem Todesengel, her, und habe seine unglaublichen Grausamkeiten mit eigenen Augen gesehen. Da hab ich nun geglaubt, mich könnte nichts mehr erschüttern.« Er schüttelte den Kopf, und ein aufmerksamer Beobachter hätte ein feuchtes Schimmern in seinen Augen bemerkt. »Aber so was hätte ich mir bei Gott nicht träumen lassen.«
In seinem Kummer wußte der Junge nicht, was er erwidern sollte. Die Worte waren ihm ebenso versiegt wie die Tränen. Nach einigen Augenblicken fuhr Hauptmann Mendana deshalb fort, als hätte das Gesagte nichts mit ihm zu tun: »Mach das Boot deines Vaters flott und kümmere dich um Proviant, Wasser und Ersatzsegel. Die Leute im Dorf werden dich mit allem versorgen, was du brauchst, ohne Fragen zu stellen. Die Kosten übernehme ich.«
»Warum tust du das?« wollte der Junge wissen.
»Weil Samstag nacht ein Posten Wache steht, der bisweilen seltsame Anfälle bekommt«, entgegnete sein Gegenüber, als hätte er die Frage nicht richtig verstanden. »Kurz vor elf wird er herauskommen, um frische Luft zu schnappen, und wie vom Blitz getroffen neben der Seitentür umfallen.« Wieder blickte er dem Jungen fest in die Augen. »Hol deinen Vater raus und sag ihm, er soll nach Kuba, Puerto Rico oder Panama gehen. Wohin er will, nur nicht aufs Festland.« Seine Hand drückte den Schenkel des Jungen noch fester. »Und auf keinen Fall darf er nach Margarita zurückkehren. Das ist meine einzige Bedingung, denn sonst muß ich ihn verhaften.«
»Aber warum machst du das alles?« beharrte der Junge auf seiner Frage.
»Mein Gott, stell dich doch nicht dümmer als du bist«, erregte sich der andere. »Was glaubst du wohl, warum? Ich war bei deiner Geburt dabei, und dein Vater ist stets mein einziger Freund gewesen. Glaubst du vielleicht, ich lasse ihn im Kerker vermodern, nur damit sich dieser Hurensohn ohne Furcht mit seiner Dirne amüsieren kann?« Dann schien im klar zu werden, was er da eben gesagt hatte, und er räumte ein: »Entschuldige bitte. Ist ja immer noch deine Mutter.«
»Jetzt nicht mehr«, gab der Junge trocken zurück, um kurz darauf doch das zu fragen, worauf er niemals eine Antwort zu finden glaubte: »Warum hat sie das gemacht? Gut, mein Vater ist arm, doch er hat sie über alle Maßen geliebt, und wir sind doch glücklich gewesen.«
Während die Sonne endgültig am Horizont verschwand, dachte Hauptmann Sancho Mendana darüber nach. Er wußte, wie wichtig seine Antwort für diesen Jungen mit den großen fragenden Augen sein würde.
»Die Not gibt meist schlechte Ratschläge«, murmelte er schließlich. »Vielleicht hat deine Mutter ja mehr an die Zukunft ihrer Kinder als an ihren Ehemann gedacht, und vielleicht sorgt sie dafür, daß euch dieses Schwein eine angenehme Lebensstellung verschafft.«
»Ohne mich«, gab der Junge entschieden zurück.
»Überleg’s dir lieber noch mal.«
»Da gibt’s nichts zu überlegen«, kam es wie aus der Pistole geschossen. »Ich geh mit meinem Vater.«
In tiefer Zuneigung strich ihm Hauptmann Mendana über die Wange und sah ihm direkt in die Augen.
»Ich wußte, daß du das sagen würdest. Bei Männern irre ich mich selten, und du bist bereits ein Mann.« Er lächelte, als wollte er sich über sich selbst lustig machen. »Mit den Frauen ist das was anderes. Da treffe ich selten ins Schwarze.«
In den folgenden Tagen kamen die meisten Einwohner von Juan Griego zum Haus der Heredias und brachten alles mit, was für eine lange Überfahrt nach Puerto Rico oder Hispaniola nötig war. Die meisten legten ihren Beitrag wortlos auf die Türschwelle, um den Schmerz des Empfängers durch das, was sie sagen würden, nicht noch zu vergrößern.
Der Zimmermann und sein Gehilfe dichteten den Bootsrumpf mit Pech ab und richteten einen neuen Mast auf, während Meister Amador großzügig ein neues Segel opferte, das seine Töchter in monatelanger Arbeit gewebt hatten.
Am Samstag abend gingen die Lichter des Dorfes früher aus als gewöhnlich. Nur im Turm der Festung La Galera, in der Kammer von Hauptmann Sancho Mendana, flackerte noch eine einsame Kerze.
Um viertel vor elf verlosch auch diese.
Fünf Minuten später öffnete ein Wachposten die kleine Seitenpforte der Verliese, atmete tief die warme Nachtluft ein, sah zum schwarzen Himmel hinauf und brach wie vom Blitz getroffen zusammen. Ein schwerer Schlüssel klirrte auf das Pflaster.
Ein Schatten löste sich aus den anderen Schatten, ergriff den Schlüssel und verschwand in den mächtigen Kasematten. Wenig später tauchte er wieder auf, mit einem Schlafwandler an der Hand, der nicht zu wissen schien, wie ihm geschah und wohin man ihn führte.
Sebastián mußte seinen Vater bis zur Anlegestelle schleifen, denn der arme Miguel Heredia hatte in seiner Verwirrung nur einen Wunsch: nämlich schnurstracks nach Hause zu Frau und Tochter zu marschieren.
»Aber wohin bringst du mich denn?« flüsterte er ein ums andere Mal fassungslos. »Wohin bringst du mich?«
Hundert Augenpaare verfolgten in ihren Häusern eingeschlossen den Weg der unglücklichen, von Schande und Schmerz geschlagenen Flüchtlinge. Und die meisten Kinder, die mit Sebastián gespielt hatten – und viele ihrer Mütter – konnten die Tränen nicht zurückhalten, als die beiden ins Boot stiegen.
Drei Gestalten tauchten aus dem Dickicht auf, um das Boot aufs Meer hinaus zu schieben. Der Junge brachte seinen Vater auf dem Vorderdeck unter, hißte das Segel und steuerte das kleine Segelboot direkt aufs offene Meer hinaus.







