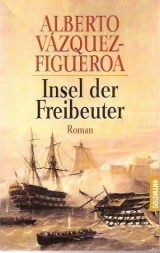
Текст книги "Insel der Freibeuter"
Автор книги: Alberto Vazquez-Figueroa
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Mombars – seinen richtigen Namen kannte niemand – hatte den größten Teil seines Lebens damit verbracht, den Spaniern die Eingeweide herauszureißen, nur weil es ihm Spaß machte oder weil ihn die unausgewogenen Berichte eines erleuchteten Geistlichen so verwirrt hatten, bis aus ihm ein blutrünstiger Fanatiker geworden war.
Als der junge Mombars Bartolome de Las Casas las, hätte er wissen sollen, daß dieser, bevor er sich zum Schutzpatron der Indios und zum unseligen Urheber der zu trauriger Berühmtheit gelangten »Schwarzen Legende« wandelte, der größte Sklavenhändler auf Hispaniola gewesen war und maßgeblich am ungerechten und grausamen Kommendengesetz beteiligt war, das sein guter Freund und Gouverneur Ovando eingeführt hatte. Hätte Mombars begriffen, daß man die Berichte von Las Casas als tätige Reue eines Missetäters auffassen mußte, dann hätte er vielleicht seinen blutigen Kreuzzug nie begonnen.
Der ehrgeizige Bartolome de Las Casas, ein Spieler, Schürzenjäger, Säufer und Raufbold, war einer der unangenehmsten Zeitgenossen Westindiens, bis zu dem unseligen Tag, an dem er an einem strengen Gottesdienst teilnahm, in dem man ihm öffentlich seine Laster und Ausschweifungen vorhielt. In diesem Augenblick beschloß er, sein Leben zu ändern, die Kutte anzuziehen und es den vielen verführerischen Frauen gleichzutun, die nach der Heirat die größten Puritanerinnen werden.
Wenige Menschen haben im Lauf der Geschichte so vielen Menschen Schaden zugefügt wie Bartolome de Las Casas: Durch seine Schuld wurden Millionen von Indios versklavt, und durch seine Schuld wurde eine große Anzahl Menschen, die ihn bei der Durchsetzung dieser Sklaverei niemals unterstützt hatten, in der Geschichte als schlimme Unterdrücker abgestempelt.
Das alles konnte jedoch das kränkliche Hirn eines leicht zu beeindruckenden jungen Franzosen nicht wissen. Vielmehr kam Mombars zu der Überzeugung, daß alle Spanier Verbrecher sein mußten. Daher schwor er sich, jeden Mann, der im Nachbarland geboren worden war, auf grausamste Weise zu vernichten.
Im Prinzip war dieser Haß wohl nur der Firnis, der andere, wesentlich tiefere Haßgefühle verdeckte. Im Lauf der Jahre war es dem sadistischen Mombars nämlich herzlich egal geworden, ob der Mann, dem er die Eingeweide herausriß, nun Spanier, Engländer oder Holländer war.
Mombars war der uneingeschränkte Bewunderer und Schüler seines Landsmannes L’Olonnois, dessen größtes Vergnügen darin bestand, seinem Opfer das Herz auszureißen und es vor den Augen des Sterbenden zu verschlingen. Zusammen bildeten die beiden das makabre Duo, das die Seeräuberei in den schlimmsten Verruf brachte.
Die erfolgreichsten Korsaren der Antillen waren zweifellos die Engländer Drake, Raleigh und Morgan, die meistgehaßten Piraten die Franzosen Mombars und L’Olonnois. Allerdings waren auch die zwei am meisten »bewunderten« Seeräuber, Vent en Panne und Chevalier de Grammont, ebenfalls Franzosen.
Von diesen großen Namen war inzwischen nur noch der blutrünstige Todesengel am Leben, vielleicht auch noch der elegante Chevalier de Grammont, der sich wie Mombars angeblich unwiderruflich in sein Winterquartier zurückgezogen hatte.
Kein Wunder also, daß Sebastián das Herz bis zum Hals schlug, als ihn am folgenden Samstag abend die Rothaarige in ihre Hütte führte und dort ein Riese auf ihn wartete, der ihn mit dämonischen Augen, die sich unter buschigen Augenbrauen verbargen, fixierte.
»Also du bist der Navigator der Jacare?« fragte er mit kellertiefer Stimme. »Ich bin Mombars, der Todesengel.«
Er sprach sehr langsam, im Pidgin-Englisch, das alle einfachen Seeleute der Antillen verwendeten: eine bunte Mischung aus englischen, französischen, spanischen, portugiesischen und holländischen Wörtern, wobei Mombars aber auch immer wieder Wörter aus dem karibischen Dialekt einstreute, den die Mehrheit seiner indianischen Besatzung sprach.
Der Margariteno wandte sich sofort der Rothaarigen zu, als wolle er ihr seine Empörung darüber ins Gesicht schleudern, daß sie ihm eine so schmutzige Falle gestellt hatte:
»Warum hast du mir das angetan? Ich hab dir doch gesagt, daß ich das Schiff nicht wechseln will.«
Der haarige Gorilla, den die Last der Jahre gebeugt hatte und dessen weiße Löwenmähne zu winzigen Ringellocken geflochten war, was ihm ein wirklich bizarres Aussehen gab, beschränkte sich darauf, seine riesigen nackten Füße auf den Tisch zu legen, während der Korbstuhl, in dem er saß, fast unter seinem Gewicht zusammenbrach. Mit der gleichen tiefen Stimme fuhr er fort:
»Ich will ja nur mit dir reden. Ich werde dich schon nicht fressen.« Er sah ihn so an, als könne ihn niemand anlügen, ohne daß er es bemerkte. »Bist du ein Spanier?«
»Margariteno der dritten Generation. Ist schon lange her, daß ich alles aufgegeben habe, was mit Spanien zu tun hat.«
»Renegat?«
»Einfach aufgegeben. Punktum.«
»Na schön«, versetzte der Todesengel, als genügte ihm diese Erklärung. »Du hast Spanien also aufgegeben. Warum hängst du so an diesem alten Säufer Jacare Jack?«
»Weil er immer gerecht gewesen ist, gut bezahlt und ein großartiger Kapitän ist.«
»Ich bin auch ein gerechter Mann, biete dir das Zwanzigfache dessen, was er dir bezahlt, und als guter Kapitän gelte ich auch. Was ist der Unterschied?«
»Sein Schiff ist sicherer.«
»Woher weißt du das?«
Sebastian machte nur eine vielsagende Geste.
»Ich weiß es eben!«
»Verstehe!« murmelte der andere. »Ist das wegen dieser berühmten Routenbücher? Sind die so wichtig?«
Sebastián hatte am Fußende des riesigen Betts der Rothaarigen Platz genommen, die sich diskret nach draußen an den Strand verdrückt hatte, als ginge sie das alles nichts an. Er nickte entschlossen.
»Ich habe viel von deinem Schiff gehört. Von seiner gewaltigen Feuerkraft und seinen märchenhaften Schätzen, aber ich garantiere dir, nicht mit allem Gold Perus könntest du bezahlen, was der Alte hat.«
»Du übertreibst.«
»Keineswegs! Wie viele Schiffe voller Schätze ruhen auf dem Grund der Karibik…? Dutzende? Vielleicht Hunderte? Mit den Routenbüchern des Kapitäns wären die meisten von ihnen niemals untergegangen.«
»Bis du sicher?«
»So sicher, wie ich hier bin. Und so sicher, wie ich in zwei Jahren die Bücher auswendig kann, wie heute der Alte.« Er beugte sich vor. »Dann werde ich dir von Nutzen sein. Heute, ohne diese Routenbücher, wird dein Schiff auf Grund laufen, und folglich wirst du mir die Gedärme herausreißen. Wozu dienen mir zehntausend Pfund, wenn mir keine Zeit bleibt, sie auszugeben?«
Mombars nahm die Füße vom Tisch, stützte sich mit den Ellenbogen darauf und fuhr sich mit beiden Händen durch die weiße Mähne, als könne er damit die Gedanken vertreiben, die ihm durch den Kopf gingen.
Er schien viel zu müde oder zu alt, um das Piratenleben wieder aufzunehmen. In seinem gelblichen Gesicht waren tiefe Falten zu sehen, und der mächtige Rumpf wurde schon schlaff, doch noch immer flößte allein seine Anwesenheit Furcht ein, nicht nur, weil er so wild aussah, sondern vor allem seines Rufes wegen. Dieser eilte ihm nicht unbedingt voraus, sondern umgab ihn wie ein böser Heiligenschein.
Und Mombars, der Todesengel, strömte mit jeder Pore seines Körpers Gewalt aus.
»Es fällt mir schwer, aber ich glaube dir«, murmelte er schließlich. »Niemand, der bei klarem Verstand ist, schlägt zehntausend Pfund aus, wenn er nicht sehr triftige Gründe dafür hat, und deine scheinen triftig zu sein.« Er sah ihn an: »Und was machen wir jetzt?«
»In Cumaná gibt es einen Navigator, Martin Prieto. Vielleicht…« begann Sebastian schüchtern, brach aber angesichts der unwirschen Geste seines Gegenübers sofort ab.
»Hör auf! Wer denkt an Martin Prieto? Ich weiß, daß alle Kapitäne einen Arm dafür hergeben würden, um auf ihn zählen zu können, aber dieser Spanier ist seinem König so verdammt ergeben, daß er in der Lage wäre, ein Piratenschiff auf Grund zu setzen, nur damit es eines weniger gäbe. Reden wir von dir.« Er musterte ihn aufmerksam. »Wenn du die Routenbücher des alten Jacare Jack hättest, würdest du dann mein Angebot annehmen?«
»Mit dem Archiv des Alten? Natürlich! Wie ich dir doch schon sagte, wenn man weiß, wie man die Bücher lesen muß, kommt man mit verbundenen Augen überall hin. Und der Kapitän hat mir gezeigt, wie das geht.«
»In diesem Fall«, befand der Riese und legte seine riesigen nackten Füße wieder auf den Tisch, »müssen wir sie uns eben holen… Oder nicht?«
Jetzt dachte Sebastián über das nach, was er eben gehört hatte, dann stand er auf, ging zur Tür und betrachtete die Rothaarige, deren Silhouette sich gegen den rötlichen aufgehenden Mond abzeichnete.
Ohne sich umzudrehen, erwiderte er:
»Glaub nicht, daß ich daran nicht auch schon gedacht habe.« Seine Stimme klang so dünn, daß sein Gegenüber die Ohren spitzen mußte. »Eine Million Mal!« beharrte er. »Aber wie?« Jetzt wandte er sich erneut um und sah ihn an. »Wie?«
»Eine Möglichkeit muß es doch geben.«
»Ich kenne keine«, entgegnete der Margariteno. »Der Kapitän bewahrt alles in einer Kiste auf, die er binnen Sekunden ins Meer werfen kann. Und wenn die Bücher ins Wasser fallen, verläuft die Tinte, und alles ist verloren.« Er zuckte mit den Schultern, als wolle er seine Ohnmacht einräumen. »Ihm ist das egal, denn er hat die Bücher im Kopf. Aber ich noch nicht. Tut mir leid, aber so ist es!«
»Wir werden einen Weg finden, ihn zu überraschen!« rief der Franzose irritiert aus. »Er wird nicht ständig auf dieser verdammten Kiste sitzen.«
»In Port-Royal schon. Solange wir im Hafen sind, verläßt er seine Kajüte kaum und schließt sich dort ein, weil er niemandem vertraut. Auf offener See oder im Quartier sieht das anders aus, doch dann kann ich nichts machen, wie du verstehen wirst. Ich bin allein!«
»Niemand würde dir helfen?«
»Wer? Und wobei? Eine Rebellion anzuzetteln? Und warum? Um den Kapitän zu wechseln? Sie sind mit dem zufrieden, den sie haben.« Er winkte ab. »Nein! Wie ich gesagt habe. Man kann nichts tun.« Er machte einen zaghaften Versuch, sich nach draußen zu dem Mädchen zu begeben, doch zwei aus der Dunkelheit auftauchende Wilde versperrten ihm drohend den Weg und bedeuteten ihm, in die Hütte zurückzukehren. Er gehorchte und sah Mombars an, der in der Zwischenzeit keinen Mucks gemacht hatte. »Was soll das?« rief er aus. »Wirst du mir jetzt die Gedärme herausreißen, nur weil ich dir die Wahrheit gesagt habe? Ich wäre der erste, der sich diesen Schatz holen würde, denn ich gehöre zu den wenigen, die damit etwas anfangen können, aber was nicht geht, geht nicht.«
»Sei ruhig und laß mich nachdenken!« grunzte der menschliche Gorilla, dem das Hirn zu rauchen schien. »Wo ist euer Quartier?«
»Wir haben zwei: eins in den Jardines de la Reina für kurze Aufenthalte und das andere in den südlichen Grenadinen, wo wir den Sommer verbringen.«
»Wann werdet ihr euch in eins der beiden zurückziehen?«
»Ich denke, in ein paar Tagen, denn dem Alten steht Port-Royal bis hierher. Wahrscheinlich werden wir zu den Jardines de la Reina segeln, um das Schiff unterhalb der Wasserlinie zu reinigen und damit sich die Besatzung vom Suff und den Huren erholen kann.«
»Wie lange werdet ihr dort bleiben?«
»Höchstens zwei Wochen!«
»Setz dich!«
Sein autoritärer Ton duldete wie üblich keinen Widerspruch, daher setzte sich Sebastian in den klapprigen Stuhl am anderen Ende des Tisches.
»Was nun?« fragte er mißmutig.
»Wir müssen nachdenken. Und zwei Köpfen fällt mehr ein als einem allein.«
»Und worüber willst du nachdenken?«
»Wie wir deinem Kapitän das Spielzeug abnehmen.«
»Aha!«
»Sei nicht so pessimistisch«, tadelte ihn der Todesengel, der verblüfft, irritiert oder in seinem Ego verletzt schien, nur weil jemand so offen an seinem Erfolg zweifelte. »Du hast gesagt, daß er in dem Quartier und auf See nicht mehr so wachsam ist, stimmt’s?«
»Natürlich. In dieser Zeit kann ich die Dokumente studieren, wann immer ich will, solange ich keine Kopien mache.«
»Gut! Das ist die Gelegenheit, sie sich anzueignen.«
Sebastián sah ihn wie einen Geisteskranken an.
»Und was mache ich dann? Soll ich mit einer Kiste auf den Schultern über die Wellen laufen oder mich auf einer Insel verstecken, die so kahl ist, daß sogar die Kaninchen Sonnenschirme tragen?«
»Wie ist die Insel?«
»Welche?«
»Die im Jardin de la Reina.«
»Nur eine Sandbank mit einer tiefen Bucht.«
»Ihre maximale Höhe?«
»Über Meeresspiegel? Etwa zehn Meter. Aber der Jacare reicht das, denn wenn sie ihre Masten kappt, ist sie nicht höher als die Dünen, und niemand, der in der Umgebung segelt, würde vermuten, daß sich an einem solchen Ort ein Schiff verbirgt.«
»Er war schon immer ein schlauer Fuchs, dieser verdammte Schotte!« rief Mombars aus. »Wirklich verdammt gerissen! Aber ich denke, diesmal können wir ihn reinlegen.« Er beugte sich vor und legte seine schwere Pranke auf den Unterarm des Margariteno. »Hör mal!« fügte er mit seiner rauhen, jetzt etwas aufgeregt klingenden Stimme hinzu. »Mir fällt da ein Plan ein, der funktionieren könnte.«
»Ich kann nicht glauben, daß jemand ein so hohes Risiko eingeht, nur um sich eine Handvoll Papiere zu holen«, sagte Celeste mit ungewöhnlichem Ernst. »Und ich mache mir Sorgen, daß du in deine eigene Falle tappst.«
Die Geschwister aßen zusammen mit ihrem Vater unter einer schattigen westindischen Kastanie, die das stolze Kap beherrschte, zu Mittag, zur einen Seite das kristallklare blaue Meer, zur anderen die Ruinen der alten Villa von Kapitän Bardinet.
Die zahlreichen Arbeiter – fast alles Sklaven –, die mit dem Abriß beschäftigt waren, nutzten die heißen Stunden der Siesta, um sich im nahen Meer zu erfrischen. Fröhlich planschten, spielten und tollten sie im Wasser.
Allein die Tatsache, daß sie jetzt kein Zuckerrohr mehr schneiden mußten, sondern ein Haus abreißen konnten, eine wesentlich angenehmere Arbeit, schien Grund genug für ihre Begeisterung zu sein. Mit gewisser Bewunderung schaute Sebastian sie an, dann wandte er sich seiner Schwester zu, um ihr mit liebevoller Geduld zu antworten:
»Für deine >Papiere< würde sich jeder gute Seemann ein Bein ausreißen. Kolumbus ist fast zwei Jahre zwischen dem Golf von Honduras und Panama herumgeirrt, bis er schließlich hier, in Jamaika, auf Grund lief, und anderthalb Jahrhunderte später hielten Gegenwinde und gefährliche Strömungen die Flotte von L’Olonnois, Van Klijn und Pierre de Picard am gleichen Ort über ein Jahr lang fest. Vierhundert ihrer siebenhundert Männer haben dieses unselige Abenteuer nicht überlebt.« Er nahm sich einen Hähnchenschenkel und biß hinein, ohne Celeste auch nur einen Augenblick aus den Augen zu lassen: »Glaubst du, daß es jemandem gefällt, Jahre seines Lebens damit zu vergeuden, blind auf unbekannten Meeren herumzuirren und dabei zu riskieren, jede Minute an der Küste oder an einem Riff zu zerschellen?«
»Nein. Natürlich nicht«, räumte das Mädchen ein.
»Dann wirst du auch verstehen, daß Leute, die Zeit, Schiffe, Geld und Freunde verloren haben, nur weil ihnen einige schlichte >Papiere< gefehlt haben, alles daransetzen, sie zu bekommen. Denk daran, wer an Land den Weg nicht kennt, verirrt sich nur, aber wer ihn auf See nicht kennt, der geht unter.«
»Aber das Risiko, das du mit Mombars eingehst, scheint mir allzu groß«, beklagte sich das Mädchen. »Was passiert, wenn die Sache schiefgeht?«
»Dann sehen wir uns niemals wieder«, lautete die ehrliche Antwort. »Aber wenn alles gutgeht, dann werden wir den besten Rum der Karibik brennen, bis wir alt sind.«
»Versprichst du das?« fragte sein Vater.
Wie zum Schwur hob Sebastián die Hand.
»Wenn der Ballast der Ira de Dios, wie behauptet wird, tatsächlich aus Silberbarren besteht, dann kehre ich niemals mehr auf See zurück.« Er lachte amüsiert. »Meine Karriere wird die kürzeste und einträglichste in der Geschichte der Seeräuberei sein.«
»Wann willst du aufbrechen?«
»Morgen, und wenn es soweit ist, wird Astrid eine grüne Laterne an die Tür ihrer Hütte hängen, damit Mombars Bescheid weiß, daß wir zum Jardin de la Reina segeln. Das Weitere wird sich finden.«
»Hast du Angst?«
Der Margariteno ließ sich mit der Antwort Zeit und betrachtete die Sklaven bei ihrer Herumtollerei, bevor er nickte, ohne dabei auch nur ein bißchen rot zu werden.
»Wenn man Mombars kennt, wäre es unsinnig, keine Angst zu haben. Er hat schon etwas Beeindruckendes an sich, und ich schwöre dir, wenn sich der Teufel dazu entschließt, Mensch zu werden, dann würde er diesen Mann auswählen. Sein unerschütterlicher Glaube an die eigene Kraft ist aber auch seine Schwäche. Er ist davon überzeugt, daß er uns versenken würde, weil die meisten seiner neunzig Kanonen Sechsunddreißigpfünder sind, während wir davon nur zwanzig haben.«
»Und trotzdem willst du es mit ihm aufnehmen?«
Der junge Kapitän lächelte recht geheimnisvoll:
»Weißt du was? Die Indios auf dem Festland schwören, daß die gefährlichsten Kaimane nicht im Wasser, sondern an Land leben.«
Den Rest des Nachmittags verbrachten sie im Schatten der Kastanien und schauten den Arbeitern zu, die lachend mit schweren Hämmern die Ruinen der Negrita von Bardinet einrissen. Bei Anbruch der Nacht verabschiedeten sie sich mit einer festen Umarmung. Vielleicht würden sie sich niemals wiedersehen.
Celeste und ihr Vater kehrten in der Kutsche zu ihrem Haus in Caballos Blancos zurück, währen Sebastian ohne Hast den Weg nach Port-Royal einschlug, das nach der langen Tagesruhe allmählich wieder munter wurde.
Er lud die verführerische Rothaarige ins eleganteste Restaurant der Stadt ein. Dort lernten sie persönlich den stolzen Laurent de Graaf mit seinen erlesenen Manieren kennen. Nach einer langen Liebesnacht begab er sich auf sein Schiff, wo die gesamte Mannschaft auf ihn wartete, bereit, das Manöver auszuführen, das sie aus dem stillen Wasser einer Bucht führen würde, die tatsächlich die sicherste geheiligte Zuflucht auf Erden war.
Das Meer war ruhig, und von Land wehte eine sanfte Brise. Sie hißten die meisten Segel und setzten Kurs Südwest, um die Insel in westlicher Richtung zu umsegeln und danach direkt nach Norden zu fahren, bis drei Tage später die ersten kleinen Inseln des Jardin de la Reina auftauchen würden.
Sebastian Heredia nutzte die Gelegenheit, seine Besatzung zu versammeln und ihr seine Pläne zu erläutern.
Sie hörten ihm schweigend zu. Erstaunen, ja Ungläubigkeit breitete sich aus. Schließlich ergriff wieder einmal Zafiro Burman als erster das Wort.
»Sollen wir glauben, daß der Todesengel lebt und du ihn persönlich getroffen hast? Nicht möglich!«
»O doch, und in einer guten Woche wirst du ihn auf der Brücke der Ira de Dios sehen, wenn du nicht lieber auf den Cayman-Inseln an Land gehen willst, gemeinsam mit allen anderen, die Angst haben.«
»Teufel noch mal…!« rief der erste Steuermann entrüstet aus. »Hast du dir wirklich in den Kopf gesetzt, dich mit der Ira de Dios anzulegen? Nicht einmal der Alte hätte sich das getraut.«
Der Margariteno, der neben dem Steuermann stand und die übrigen Männer um einen Meter überragte, sah sich alle der Reihe nach an, bemerkte ihre ernsten Gesichter und gab schließlich zu bedenken:
»Stets habt ihr euch beklagt, daß ihr nichts zu tun habt und die Beute so armselig ist.« Vielsagend breitete er die Arme aus. »Jetzt biete ich euch endlich alle Aktion der Welt und die größte Beute, von der ihr je geträumt habt. Was wollt ihr noch?«
»Nichts weiter. Der Plan ist großartig, aber Mombars ist nun mal Mombars«, mischte sich ein zerknirschter Nick Cararrota ein. »Ich sehe mich schon mit offenen Gedärmen laufen.«
»In dieser Hinsicht brauchst du dir keine Sorgen zu machen«, versetzte Kapitän Jack mit Humor. »Auf der Insel, die wir ausgesucht haben, gibt es keine Bäume, an die sie die Gedärme nageln können.«
»Schöner Trost!«
»Die Entscheidung liegt bei euch«, fuhr Sebastián Heredia fort und bemühte sich, gleichgültig zu wirken. »Wer Schiß hat, kann auf den Cayman-Inseln bleiben, denn ich komme mit zwanzig Männern aus, und für die wird der Anteil um so phantastischer ausfallen.«
»Können wir darüber nachdenken?« wollte ein langer dünner holländischer Kanonier wissen. »So eine Entscheidung sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
»Nur diese Nacht. Morgen früh will ich wissen, wer mit mir kommt und wer nicht.« Er bedeutete Lucas Castano, ihm in die Kajüte zu folgen, und als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, nahm er Platz und fragte: »Was meinst du?«
»Wie der Malteser so schön gesagt hat: >Mombars ist nun mal Mombars<. Bei seinem Namen allein gefriert einem das Blut in den Adern.«
»Meine Güte!« beklagte sich der Kapitän bitter. »Sind sie nun Piraten oder nicht? Ich bin auf diesem Schiff aufgewachsen. Jahrelang sind sie mir mit ihren früheren Heldentaten in den Ohren gelegen und daß sie in der Lage seien, San Juan, Cartagena oder sogar die Flotte selbst anzugreifen, und jetzt, in der Stunde der Wahrheit, jagt ihnen ein einziger Name Angst ein.« Er sah ihm in die Augen. »Dir auch?«
Der Panamese, der auf dem Fensterbrett des Achterfensters Platz genommen hatte, von dem er bei einem plötzlichen Schlingern des Schiffs ins Wasser gefallen wäre, schüttelte leicht den Kopf.
»Erinnere dich daran, daß ich dich erst auf die Idee gebracht habe, diesen Hurensohn reinzulegen. Er beschäftigt mich, aber Angst jagt er mir keine ein. Trotzdem mußt du akzeptieren, daß es Leute gibt, die sich bei dem Gedanken nicht wohl fühlen, es mit neunzig Kanonen und über zweihundert Wilden aufzunehmen, die Menschenfresser sein sollen.«
»Verstehe! Ich mache auch keine Freudensprünge, aber jetzt sind die Würfel nun mal gefallen.«
Der Margariteno aß allein zu Abend, versuchte im unergründlichen Gesicht des Kochs, der das Essen servierte, zu lesen, wie die Entscheidung seiner Besatzung ausfallen würde, doch ganz offensichtlich hatte der Filipino auch keine Ahnung, was in diesen Augenblicken auf dem unteren Vorderdeck passierte. Und so beschränkte er sich darauf, Sebastian weiter zu bedienen, wie er es immer getan hatte, seit der Kapitän sein Amt angetreten hatte.
»Und du?« fragte Sebastian, als der Koch das Geschirr abräumte. »Bleibst du auf den Caymans oder kommst du mit?«
Mit unbeweglichem olivenfarbenen Gesicht entgegnete der kleine Mann fatalistisch:
»Ich habe immer Angst gehabt, am Galgen zu enden, Kapitän, aber wenn wir gewinnen, eröffne ich in Port-Royal ein gutes Wirtshaus. Und sollten wir verlieren, werde ich mich mit einem Stein um den Hals ins Meer stürzen, um nicht in die Hände von Mombars zu fallen.«
Er verließ die Kajüte, was Sebastian die Möglichkeit gab, über einen riskanten Plan nachzudenken, in dem es nur zwei Möglichkeiten gab: Sieg oder Tod. Am folgenden Morgen, als die Glocke den Wachwechsel ankündigte, versammelte Sebastian erneut seine Mannschaft an Deck und kam ohne Umschweife zur Sache.
»Alle, die auf den Caymans bleiben wollen, versammeln sich an der Backbordseite«, befahl er. »Alle, die mitkommen wollen, an der Steuerbordseite.«
Zafiro Burman hob die Hand.
»Mach dir keine Umstände! Wir alle wollen lieber als Piraten sterben statt als Bettler leben. Hiß die schwarze Flagge!«
»Die schwarze Flagge?« fragte der Kapitän überrascht.
»Genau!«
»Hier und jetzt?«
»Hier und jetzt!« lautete die entschlossene Antwort. »Wir haben beschlossen, daß wir von diesem Augenblick an in den Kampf ziehen.«
Sebastián Heredia Matamoros wandte sich Lucas Castano zu und befahl ihm mit einem Lächeln:
»Einverstanden! Hol die Flagge. Klar zum Gefecht!«
Das schien der magische Satz zu sein, auf den fünfzig Seewölfe monatelang gewartet hatten. »Klar zum Gefecht!« hieß soviel wie »Beute in Sicht!«, und diese zwei Wörter, »Gefecht« und »Beute«, verstand jeder an Bord am besten.
Die Waffen, die so lange Zeit geruht hatten, blitzten in der Mittagssonne; die Kanonen, die so lange stumm geblieben waren, krachten, damit man ihren Zustand prüfen konnte, und das Pulver, das so lange in der untersten Pulverkammer geschlummert hatte, wurde auf Deck ausgestreut, um sicherzugehen, daß es nicht feucht und damit nutzlos geworden war.
Der Vorabend der Schlacht ist für die Beteiligten wesentlich aufregender als der Kampf selbst, und die Besatzung der Jacare wußte, daß ihr eine brutale, blutige und erbitterte Schlacht bevorstand.
Als Sebastián Heredia sie so vom Achterkastell aus betrachtete, hatte er das Gefühl, zum ersten Mal so richtig mitzuerleben, wie es auf einem Piratenschiff zuging, und zum ersten Mal wurde ihm die wahre Persönlichkeit der Männer bewußt, die ihre Heimat und ihre Familien verlassen hatten, um sich dem riskanten Gewerbe zu widmen, auf unbekannten Meeren herumzuirren und nach einer wertvollen Beute zu suchen.
Die Jacare roch geradezu nach Gewalt, und während Sebastián die Gesichter der Mannschaft betrachtete, kam er zu dem Schluß, daß jeder einzelne der zerlumpten Verbrecher bereit war, den letzten Tropfen Blut für den Sieg zu opfern.
Er blickte zur riesigen Flagge mit Totenkopf und Krokodil hinauf, die vom höchsten Mast flatterte. Er fühlte eine Gänsehaut, weil diese Flagge jetzt nicht als Symbol eines einfachen Beutezugs, sondern als Zeichen der Freiheit schlechthin flatterte.
Zum gegebenen Zeitpunkt kletterte Zafiro Burman auf den Großbaum, rief seine Gefährten zusammen und verkündete der enthusiastischen Menge:
»Mombars ist ein Riese, und mit seiner Mähne im Wind sieht er wie ein Ungeheuer aus. Aber wenn er tot ist, dann ist es auch mit seiner Tollwut vorbei, und ohne ihn sind seine Männer nur noch ein Haufen Wilder.« Er zeigte seine Kette, die er um den Hals trug und von der er sich niemals trennte: »Wer Mombars in Stücke schießt, dem schenke ich meinen Saphir.«
Zwei Tage später zeichneten sich die ersten Umrisse der Inseln und Riffe ab, die Kolumbus zu Recht »Garten der Königin« oder »Labyrinth« getauft hatte. Das Archipel war wahrscheinlich eines der schönsten, für die Seefahrer gleichzeitig auch das gefährlichste der Antillen.
Bei Anbruch der Nacht ankerten sie im Schutz des Cayo del Rabihorcado, bis sie es wagen konnten, im ersten Morgenlicht weiter in das Archipel vorzudringen, ohne Angst zu haben, auf einen Felsen zu laufen. Sebastián befahl, kein Licht an Bord zu entzünden, ließ die Wachen verdoppeln und ordnete absolutes Schweigen an, obwohl es wenig wahrscheinlich war, daß jemand im Dunkeln das im Schutz der gefährlichen Riffe liegende Schiff angreifen würde.
»Bei Mombars kann man nicht vorsichtig genug sein«, schloß er. »Und sollte er uns überholt haben, könnte er uns mitten in der Nacht überraschen.«
Alles blieb jedoch ruhig. Zehn Minuten, bevor die Sonne über der fernen kubanischen Küste aufging, hatte man bereits damit begonnen, die Segel zu setzen, und das Schiff war bereit, seine schwierige Fahrt fortzusetzen, sobald man die trügerischen Untiefen im Tageslicht klar erkennen konnte.
Drei Männer kletterten auf die Masten, damit ihnen nichts entgehen konnte, was sich vor ihrem Bug abspielte. Zafiro Burman stand am Steuerrad, und selbst der letzte Marsgast paßte wie ein Luchs auf. So wagten sie sich in das gefährliche Labyrinth aus Wasser und Korallen, das schon so viele Schiffe und Menschenleben gefordert hatte.
Zum Glück kannten die meisten Männer diese Gewässer aus lange vergangenen Zeiten, in denen sie unter dem alten Kapitän hier gesegelt waren, und so konnten sie nach zehn nervenaufreibend langen Stunden die Anker an der tiefsten Stelle einer stillen Bucht einer winzigen Insel werfen, auf der nur einige wenige krumme Kokospalmen etwas Schutz vor der brennenden Sonne boten.
Nachdem man die Masten auf die Hälfte gekappt hatte, ragten sie nicht einmal mehr über die kleinen Dünen. Außer von der engen Einfahrt in die Bucht war die Jacare daher von keinem Punkt aus zu sehen: ein perfekter Aufenthaltsort, der aber aufgrund der sehr kahlen Landschaft als Winterquartier völlig ungeeignet war.
Wer von Bord ging, konnte lediglich auf die Dünen steigen oder Spaziergänge über den endlosen Strand unternehmen, um sich schließlich unter eine der kühnen Palmen zu setzen, deren Anwesenheit die Naturgesetze zu widerlegen schien. Immerhin gab es Schildkrötennester in Hülle und Fülle, und die Bucht war so fischreich, daß der Filipino nur eine Angel auswerfen mußte, um die Speisekammern zu füllen.
Die Sandinsel war von gefährlichen Korallenriffen umgeben, daß man sich selbst mit einem Ruderboot nicht hätte nähern können, ohne auf Grund zu laufen. Nur die weite Bucht besaß eine sechzig Meter enge Einfahrt, die so tief war, daß jedes Schiff sie ohne Furcht, zu stranden oder beschossen zu werden, befahren konnte, denn die flache Sandküste bot nicht die geringste Möglichkeit, eine Festung oder auch nur eine schlichte Geschützstellung zu errichten.
Der Platz war also ein idealer Zufluchtsort vor den Naturgewalten, gleichzeitig aber auch eine tödliche Falle, wenn es darum ging, einen Feind abzuwehren.
Die Männer waren sich dieser Gefahr wohl bewußt. Kaum hatte man Anker geworfen und die Segel gerefft, brach an Bord hektische Aktivität aus. Nach Anbruch der Nacht arbeiteten die Männer im Schein aller Laternen, derer sie habhaft werden konnten, und der Fackeln weiter, die man alle fünf Meter in den Sand des Strands steckte.
Alle wußten, daß die Ira de Dios jeden Augenblick auftauchen konnte, und wenn sie zu früh kam, würden die Gedärme eines jeden einzelnen die Dünen der Insel bedecken.
Am nächsten Vormittag konnte sich kaum ein Mann an Bord noch auf den Beinen halten, aber sowohl Sebastián Heredia als auch Lucas Castano waren mit dem Ergebnis zufrieden.
»Gut!« seufzte der Panamese erleichtert. »Jetzt müssen wir nur wieder zu Atem kommen und abwarten.«
»Wie lange?«
»Ein, zwei, drei Tage. Wer weiß. Vielleicht kommen sie gar nicht.«
»Die kommen!«
»Das hoffe ich auch. Nach so viel Mühe wären die Männer fürchterlich enttäuscht.«
»Aber vielleicht kommen sie dann mit dem Leben davon«, gab Sebastian zu bedenken.
»Manchmal sind andere Dinge wichtiger als das Leben«, entgegnete sein Stellvertreter unbefangen. »Und das ist so eine Gelegenheit. Und jetzt leg ich mich schlafen. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste.«
Es wurde Nacht, und die Nacht war voller Spannung.
Für die meisten Männer der Jacare war es zugleich die kürzeste und längste Nacht ihres Lebens. Zwar schliefen sie, weil sie wirklich erschöpft waren, doch in ihrem tiefsten Inneren wollte etwas wach bleiben, denn die Angst ist ein Gefühl, das niemals müde wird und in der größten Dunkelheit wie der Docht einer Kerze brennt.







