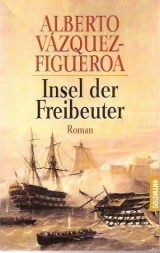
Текст книги "Insel der Freibeuter"
Автор книги: Alberto Vazquez-Figueroa
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Und Mombars war nahe.
Der Todesengel lauerte auf sie.
Zweihundert Wilde, direkte Nachfahren der gefürchteten karibischen Kannibalen, die einst die gesamte Karibik in Angst und Schrecken versetzten, wetzten ihre Messer, um ihnen die Eingeweide herauszureißen.
Wer konnte mit so einem Damoklesschwert über dem Kopf schlafen?
Zwei Stunden vor Sonnenaufgang waren alle Männer bereits wieder auf den Beinen, und nach einem kargen und schweigsamen Frühstück nahm jeder seinen Gefechtsposten ein.
Die Morgenröte ließ auf sich warten, und als sie schließlich kam, waren ihre Hände leer.
Keine Menschenseele war am Horizont zu sehen.
Drei Männer standen Wache auf den Dünen, die übrigen kehrten an Bord zurück, teils erleichtert, teils aber auch frustriert, daß die nervenaufreibende Warterei weiterging.
Da Sebastian wußte, daß Untätigkeit zum schlimmsten Feind seiner Besatzung werden konnte, befahl er ein Floß mit quadratischem Segel zu bauen, das er in der Mitte der Buchteinfahrt postieren ließ.
Dann gab er den Kanonieren den Befehl, auf die Mitte dieses Segels zu zielen, und ließ sie feuern, bis sie es genau trafen. Auf diesen exakten Punkt ließ er die Kanonen fixieren.
Schließlich richteten sie sich auf eine weitere Nacht der Angst ein.
Und auf einen weiteren Morgen ohne Feinde.
Und so vergingen fünf Nächte.
Doch am Morgen des sechsten Tags durchbrach eine Stimme die Stille der ruhigen Bucht:
»Schiff in Sicht!«
Bei Gott! Da war sie!
Sie stiegen auf die Düne und sahen zu, wie das stolze, mächtige Schiff gemächlich zwischen Inseln, Untiefen und Riffen dahinglitt. Es war schon schwer zu glauben, daß ein trauriger Küstensegler mit kaum dreißig Kanonen es wagte, sich mit einer der eindrucksvollsten Kriegsmaschinen anzulegen, die in jenen Zeiten durch die Karibik segelten.
»Ist er das?«
Sebastian reichte Lucas Castano, der gefragt hatte, das schwere Fernrohr.
»Wer sonst?«
Der Zweite an Bord schaute lange hindurch, bis er schließlich die riesige Flagge mit dem unverzierten Totenkopf einwandfrei ausmachen konnte, und nickte überzeugt:
»Das Wappen von Mombars, kein Zweifel.«
»Jeder auf seinen Posten.«
Jeder Mann nahm schweigend und ohne Hast seinen ihm vorher zugewiesenen Posten ein. Nur der junge Kapitän und sein Adjutant blieben zwischen den Dünen und ließen das Schiff nicht aus den Augen, das jetzt direkt auf die Insel zusteuerte.
Im Sand ausgestreckt und ein Auge am riesigen Fernglas, konzentrierte sich Sebastián auf den riesigen Mann mit der weißen Mähne, der seinerseits die Insel von seinem Befehlsposten aus musterte, und murmelte:
»Schön. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Er oder wir!«
Keiner hätte genau sagen können, wieviel Zeit verging, bis der Bug der Ira de Dios eine gute halbe Meile vor der Buchteinfahrt verharrte.
Einigen erschien es wie eine Ewigkeit.
Anderen nur wie wenige Minuten.
Das eindrucksvolle Schlachtschiff hatte alle Segel mit Ausnahme der Focksegel gerefft und glitt daher sehr langsam voran, während es die Kanonenschächte öffnete. Drei Kanonenreihen zeigten ihre Mündungsrohre, die bereit waren, bei dem geringsten Anlaß Eisen und Feuer regnen zu lassen.
Der Todesengel stand neben dem Steuermann und betrachtete ein letztes Mal den eleganten Küstensegler, der am Ende der Bucht vor Anker lag, und obwohl ihm die Jacare ihre Steuerbordseite zuwandte, an der die Klappen ihrer Kanonen klar auszumachen waren, schien Mombars zum Schluß zu kommen, daß er wenig zu fürchten hatte, wenn er frontal auf das bewegungslose Schiff zusteuerte.
Mit seinem Fernglas suchte er die flachen Sandbänke auf beiden Seiten des Kanals ab. Erst als er keine Kanone zwischen den kleinen Dünen und den einzelnen Palmen entdecken konnte, befahl er vorzurücken.
Schließlich schaute er auf den Mann, der sich auf die höchste Erhebung der Insel gestellt hatte und wiederholt ein rotes Tuch schwenkte.
Das war das Zeichen, das bestätigte, daß der spanische Navigator und Renegat Seekarten und Routenbücher in Sicherheit gebracht hatte.
Er blickte zu den Wachen im Mastkorb hinauf, die ihm mit einer Geste bestätigten, daß auch von dort oben keinerlei Gefahr zu erkennen war.
Mit einer Handbewegung befahl er, die Focksegel weiter zu verkleinern, und das Schiff setzte seine langsame Fahrt fort.
Kurze Zeit darauf gab die Jacare einen zaghaften Warnschuß ab, der an die hundert Meter vor dem Bug der Ira de Dios ins Wasser klatschte, doch diese hielt eine Erwiderung nicht für nötig. Zum einen war die Drohung sehr verhalten, zum anderen hätte man im Augenblick nur mit der kleinen Bugkanone auf den Angreifer feuern können.
Mit stummer Geste ließ Mombars die schwarze Flagge einholen: ein unmißverständlicher Hinweis auf seine friedliche Absicht. Er wollte kein ungleiches und absurdes Kanonenduell beginnen, sondern längsseits der Jacare gehen und ihr seine Feuerkraft demonstrieren. So gedachte er die Herausgabe ihrer Seekarten und Routenbücher zu erzwingen. Im Gegenzug würde er das Schiff verschonen.
Mombars sah keinen Grund, das Schiff eines Kollegen zu versenken, denn sein wahres Interesse war es nach wie vor, den Spaniern die Gurgel durchzuschneiden. Noch in seinem hohen Alter war er nach wie vor davon überzeugt, daß dies der Grund sei, warum ihn sein Schöpfer auf die Welt geschickt hatte.
Seine gefürchtete Flagge einzuholen und feindliches Feuer nicht zu erwidern schien seiner Ansicht nach Beweis genug für seinen guten Willen zu sein. So beschränkte er sich darauf, weiter durch die Einfahrt vorzudringen, und konzentrierte sich mehr auf das, was sich die Männer an den Bleiloten zuriefen, als auf einen neuen Angriff seitens der Jacare.
»Zwölf Faden und Sand!«
»Zwölf Faden und Sand!«
»Elf Faden und Sand!«
»Elf Faden und Sand!«
Nur das war im Augenblick wirklich wichtig, denn solange seine Kanonen geladen und seine Männer auf ihren Posten waren, mußte er sich nur Sorgen machen, ob er auch genügend Wasser unter dem Kiel hatte.
An Land verfolgten Sebastián und sein Adjutant den langsamen Vorstoß des Schiffs, das ihnen nunmehr wie eine riesige Todesmaschine vorkam, in deren Takelwerk über zweihundert Wilde hingen, die bereit waren, sie zu entern. Und als sie die zerbrechliche Silhouette der entblößten Jacare betrachteten, tauschten sie einen sorgenvollen Blick aus.
»Wenn es ihm gelingt, seine Kanonen in Stellung zu bringen, schießt er sie mit einer einzigen Breitseite in Stücke.«
Schon fuhr die Ira de Dios durch die Einfahrt der Bucht und machte sich bereit, allmählich nach Steuerbord zu drehen. Langsam passierte ihr Bug den Punkt, an dem die Mannschaft der Jacare vorher das Floß für ihre Schießübungen hatten ankern lassen.
Ein Meter, zwei Meter, drei Meter.
Sebastian Heredia richtete eine schwere Pistole in die Höhe und feuerte einen Schuß in die Luft ab.
Sofort antworteten ihm drei Kanonenschüsse von der Jacare. Das war das Signal für die 22 Kanonen, die sich unter der Sandbank an der Leeseite der Ira de Dios verbargen. Alle feuerten zur gleichen Zeit auf einen Zielpunkt von nur zwei Metern Durchmesser an der Backbordseite des Bugs, unmittelbar über der Wasserlinie.
Das riesige Schiff erzitterte vom Bug– bis zum Achtersteven und kam sofort zum Stehen.
Mombars’ Schiff war absichtlich mit den härtesten Edelhölzern Westindiens gebaut worden und hätte jeden feindlichen Treffer weggesteckt, aber niemand hatte an die Möglichkeit gedacht, daß man auf so kleinem Raum 22 sechsunddreißigpfündige Kanonenkugeln abbekommen konnte, die aus nur gut hundert Metern Entfernung abgefeuert worden waren.
Die Planken zersplitterten, die dicken Spanten brachen, das zweite Deck brach und riß die schweren Kanonen mit sich. Durch das riesige Leck strömte sofort das Wasser ein, wodurch die Ira de Dios in die für ein Segelschiff gefährlichste Schlagseite geriet: an der Leeseite des Bugs.
Dutzende Männer fielen von den Masten und Wanten auf das Deck, und wer nicht stürzte, konnte sich nur an irgend etwas klammern, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden.
Das Schiff bebte, die Mannschaft an der Steuerbordseite rutschte nach Backbord, wo sie über die Reling fiel, und als ein Dutzend Kanonen losgingen, feuerten die der einen Seite in die Luft, die der anderen ins Wasser.
Der noch immer ungläubige Todesengel rappelte sich auf und klammerte sich an das nutzlos gewordene Steuerrad, um zuzusehen, wie etwa dreißig Männer aus großen, tiefen Schanzgräben im Sand auftauchten und das grobe Segeltuch entfernten, unter dem sie ihre Kanonen versteckt hatten. Sie luden sie jetzt mit so atemberaubender Geschwindigkeit, daß Mombars kaum Zeit blieb, seine Männer vor einer neuen Breitseite zu warnen, als diese auch schon mit einer Rauchwolke einschlug.
Die zweite Breitseite war noch verheerender als die erste, denn sie traf ein bereits tödlich verwundetes Schiff und schlug eine neue Bresche, die den Hauptmast unmittelbar unter Deck zersplitterte, so daß dieser bei seinem Sturz das Freibord und alle, die sich darauf befanden, fünf Meter hoch in die Luft schleuderte.
Es war ein Massaker.
An Bord der Ira de Dios zeigten alle Götter die Größe ihres Zorns. Während die meisten Besatzungsmitglieder sich an irgend etwas klammerten, entschloß sich der Rest, ins Wasser zu springen und zur Küste zu schwimmen.
Jetzt spuckten die Kanonen kleine Säcke mit Pistolenkugeln aus, die einen tödlichen Regen über die an Deck gebliebenen Männer ausschütteten, und unter Jammern, Todesschreien und Flüchen streckte die gefürchtetste Besatzung der Karibik ihre Waffen, hob die Hände und flehte um Gnade.
Ächzend und knirschend wie eine sterbende Bestie streckte die Ira de Dios ihre Steuerbordseite in die Höhe und begann langsam zu sinken.
Sebastián Heredia, der seinen Blick nicht von dem Riesen mit der langen weißen Mähne gelassen hatte, sah, daß dieser sich bis zur Tür seiner Kajüte vorkämpfte und sich darin einsperrte, entschlossen, lieber mit seinem Schiff unterzugehen als in feindliche Hände zu fallen.
Niemals sah man ihn lebend wieder.
Die Wilden, die am Strand angelangt waren, wurden von den Männern der Jacare sofort in Ketten gelegt, und wer auch nur den geringsten Widerstand zeigte, bekam eine Kugel in den Kopf.
Eine Stunde nach dem Kampfgetümmel waren nur noch knapp dreißig Gefangene übrig, davon einige, die mit dem Tod rangen, und das Wrack eines Schiffs, das sanft auf dem sandigen Grund der Bucht ruhte, wobei die Masten und ein kleiner Teil des Achterdecks noch über Wasser ragten.
Sie blieben noch drei weitere Wochen auf der kleinen Insel und widmeten sich ganz der Aufgabe, die Ira de Dios zu zerlegen und von ihren unendlichen Schätzen zu »befreien«. Freudestrahlend sah die Mannschaft der Jacare dabei zu, wie sich diese Schätze allmählich auf dem Strand aufhäuften.
Vier der Wilden ertranken im Inneren des Wracks, das einmal ihr Schiff gewesen war, nachdem man sie gezwungen hatte, nach den Silberbarren, die als Ballast dienten, zu tauchen. Wie Zafiro Burman so schön sagte: »Sie haben sie dorthin gelegt, also sollen sie gefälligst ihr Leben riskieren, um sie zu holen.«
Da man den Gefangenen nur die Wahl gelassen hatte, entweder aufgeknüpft zu werden oder zu tauchen, hatten sie keinen Augenblick gezögert, sich für die zweite Möglichkeit zu entscheiden, um so mehr, da Sebastián ihnen feierlich versprochen hatte, daß er die Überlebenden auf der Insel mit Wasser, Lebensmitteln und Werkzeug zurücklassen würde, mit dem sie die Beiboote der Ira de Dios reparieren konnten, die während der Schlacht nicht in Stücke geschossen worden waren.
Wären die Männer von Kapitän Jack die Verlierer gewesen, hätte sie ein wesentlich schlimmeres Schicksal erwartet. Als die Taucher am fünften Tag die bereits verwesende Leiche ihres langjährigen und fast als »lebendige Gottheit« verehrten Kapitäns entdeckten, ergaben sie sich ihrem Los. Das nackte Leben zu retten lohnte allein die ganzen Mühen.
Auf diese Weise stapelten sich schließlich in den Laderäumen der Jacare 314 Silberbarren, 22 schwere Boiler, neun schöne Türgriffe und erlesenes Tafelgeschirr aus purem Gold, dazu eine riesige Kiste voller Perlen und Smaragde, die allein als Beute ausgereicht hätte.
Natürlich jubelten die Männer vor Begeisterung.
Jede Nacht legten sie die Gefangenen in Ketten, und mit Ausnahme der Wachen becherte, sang und würfelte die gesamte Mannschaft. Unablässig redete man davon, was man tun würde, sobald man wieder in Port-Royal an Land ging.
»An eines müßt ihr stets denken«, ermahnte sie Sebastián. »Wer den Schnabel nicht halten kann und herumerzählt, daß wir die Ira de Dios versenkt und geplündert haben, den lasse ich kielholen. Mombars war ein verdammter Hurensohn, den sie alle gehaßt haben, aber viele werden es nicht hinnehmen, daß man ungestraft einen Piraten beraubt, denn das nächste Mal könnten sie selbst dran sein.«
Die Gesetze der Bruderschaft der Küste von Tortuga – die in gewisser Weise auf Jamaika noch in Kraft waren – sahen ein Verbot, sich gegenseitig zu plündern, zwar nicht ausdrücklich vor, das hieß aber nicht, daß ein Mitglied des »Gremiums« ein anderes einfach massakrieren und berauben konnte.
Man schwor sich also eisernes Schweigen, und nachdem man drei Tage das Ende eines tobenden Sturms abgewartet hatte, der die kleine Insel mit wahren Sturzbächen überschüttete, ließ der Margariteno die Anker lichten und wieder Südkurs steuern.
Als sie eine Woche später wieder in der stets gastfreundlichen Bucht von Port-Royal vor Anker gingen, hatten Laurent de Graaf und weitere vier Schiffe den Hafen verlassen. Andere hatten ihre Stelle eingenommen, darunter eine wegen ihrer Feuerkraft besonders auffallende stolze portugiesische Brigg, die bis dahin noch niemand in der Karibik gesehen hatte.
Sie trug den merkwürdigen Namen Botafumeiro.
Als es dunkel wurde, ging Sebastian Heredia mit seinem gesamten Anteil an der gerecht verteilten Beute an Land und schlug den Weg zur kleinen Villa in Caballos Blancos ein, die er eine gute Stunde später erreichte.
Sein Vater und seine Schwester wollten ihren Augen kaum trauen, als sie die Schätze sahen, die Sebastian vor ihnen ausbreitete.
»Gütiger Gott! Was willst du denn damit alles anstellen?« wollte schließlich eine geradezu betäubte Celeste wissen.
»Zunächst einmal die Negrita komplett wieder aufbauen und dann die Rumbrennerei von Caballos Blancos kaufen. Dann sehen wir weiter.«
»Und was passiert mit dem Schiff?«
Sebastian zuckte mit den Schultern.
»Das habe ich noch nicht entschieden, denn die meisten meiner Leute wollen sich zur Ruhe setzen.«
»Mir kommt das seltsam vor, daß eine ganze Verbrecherbande plötzlich ehrbar werden will«, murmelte ein ungläubiger Miguel Heredia. »Ich verwette meinen Schnurrbart darauf, daß sie binnen eines Jahres ihren Anteil verschleudert haben.«
»Die wollen nicht ehrbare Leute werden«, stellte sein Sohn mit gewissem Humor klar. »Die haben einfach nur eingesehen, daß sie so eine Beute nie wieder kriegen werden, und sie sind es leid, auf der Suche nach einer armseligen Prise weiter über die Meere zu irren. Du weißt es besser als jeder andere, was für ein schweres Leben das ist.«
»Ihnen gefällt es.«
»Rum, Glücksspiel und Frauen sind ihnen noch lieber. Die Seeräuberei ist kein Priesteramt. Damit verdient man Geld.«
»Und wie lange wird es dauern, bis sie ihren Anteil verschleudert haben?«
»Das ist nicht mein Problem. Und wer kein Geld mehr hat, kann jederzeit auf einem anderen Schiff anheuern. Aber für die Jacare, so wie sie jetzt ist, war das die letzte Fahrt, und ihre Flagge bleibt für immer eingeholt.«
Anschließend mußte er in allen Details berichten, was seit dem Augenblick ihrer Trennung geschehen war, und als sein Vater und seine Schwester schließlich schlafen gingen, machte der Margariteno einen langen Spaziergang am Strand, um sich auszumalen, wie nach so vielen aufregenden Jahren auf See sein Leben an Land aussehen konnte.
Immer wieder kam es ihm seltsam vor, keine schwankenden Schiffsplanken mehr unter den Füßen zu haben und nicht jeden Augenblick vor einem Mast oder einer Schiffswand zu stehen.
Wenn er mitten in der Nacht aufwachte, ohne das Knarren der Jacare zu hören, befiel ihn eine seltsame Unruhe, und wenn ihm der Duft der feuchten Erde und der dichten Vegetation des fruchtbaren Jamaika in die Nase stieg, vermißte er sein Schiff, das nach Teer und feuchtem Holz roch.
Er würde noch lange brauchen, bis er kein echter Seemann mehr war, doch das Meer bot ihm keine Zukunft mehr. Schließlich sah er sich nicht als Kapitän eines Handelsschiffs, und ebenso absurd war die Vorstellung, daß ihm Engländer, Franzosen oder Spanier je ein Kommando über ein Kriegsschiff anvertrauen würden.
Ob er wollte oder nicht, seine Zukunft lag an Land.
Er setzte sich unter eine hohe Kokospalme und schaute zu, wie sich der Mond in den breiten, von Korallenriffen gebildeten Lagunen spiegelte, als ihn plötzlich eine seltsame Unruhe befiel, eine düstere Vorahnung, daß etwas Schreckliches passieren würde, ohne daß er hätte sagen können, woher die undefinierbare Gefahr kam, die all seine Bewegungen mit tausend Augen hinter seinem Rücken aus dem Dickicht der Zuckerrohrfelder zu verfolgen schien.
Er bemühte sich, seine Sorgen zu verscheuchen und sich selbst davon zu überzeugen, daß seine Familie und seine überaus wertvolle Beute in Sicherheit waren. Er hatte also nichts zu fürchten, wenn er sich dazu entschloß, auf der Insel zu bleiben. Diese würde stets eine Zuflucht für alle Menschen sein, die ihr von Plünderung und Gewalt bestimmtes Leben für immer ändern wollten.
Man mußte nicht besonders aufgeweckt sein, um zu begreifen, daß sich die Zeiten änderten und sich die glorreichen Zeiten der Seeräuberei allmählich ihrem Ende zuneigten. Die meisten ehrbaren Menschen der Region waren der Ansicht, daß mit Anbruch des schon so nahen neuen Jahrhunderts die Antillen nicht mehr die Jagdgründe der Seewölfe, sondern Teil einer zivilisierteren Welt sein würden, in der die Probleme nicht ausschließlich mit Plünderungen und Kanonenschüssen gelöst wurden.
Die Spanier schienen inzwischen akzeptiert zu haben, daß andere Mächte sich auf einigen Inseln der Karibik festgesetzt hatten, und früher oder später würden die Regierungen dieser Nationen zur Überzeugung gelangen, daß friedliche Handelsbeziehungen wesentlich einträglicher waren als ein Schiff nach dem anderen zu schicken, um andere Schiffe zu zerstören.
Mit dem Korsarenleben würde es an dem Tag vorbei sein, an dem ihnen ihre jeweiligen Souveräne den Schutz entzogen, und sobald keiner mehr die Korsaren brauchte, waren auch die Seeräuber und Freibeuter der Küste zu raschem Niedergang verurteilt. Der Fortschritt in der Neuen Welt würde sie von der Landkarte fegen.
In dieser unruhigen Nacht voller finsterer Gedanken kam Sebastián Heredia zu dem bitteren Schluß, daß ihm nichts anderes übrigblieb, als sein Leben zu ändern, auch wenn das Leben an Land für ihn ein kleiner Tod war.
Er schlief schlecht, und als er aufwachte, waren seine düsteren Gedanken noch immer nicht verschwunden. Als er jedoch die große Seeterrasse betrat, auf der seine Schwester lächelnd mit dem Frühstück auf ihn wartete, kam ihm im Licht des neuen Tages die Zukunft wieder wunderbar und vielversprechend vor.
»Mir ist etwas eingefallen!« rief Celeste aus, während sie ihm Eier mit Schinken und eine Tasse Kaffee servierte. »Jetzt weiß ich, was wir mit der Jacare machen können!«
»Na, da fällt mir ja ein großer Stein vom Herzen«, gab Sebastián im gleichen Tonfall zurück. »Und was können wir deiner Meinung nach machen?«
»Mit ihr Sklaven befreien«, erwiderte das Mädchen, als wäre das die normalste und einleuchtendste Sache der Welt. »Die Geschichte der Four Roses und wie du die Schwarzen an der Küste Venezuelas ausgesetzt hast, hat mich immer fasziniert.« Sie beugte sich vor und packte ihn ungewohnt fest am Arm. »Warum wiederholen wir das nicht?«
»Wiederholen?« wollte ihr Bruder verwundert wissen. »Es war reiner Zufall, daß ich auf die Four Roses gestoßen bin.«
»Ich weiß. Aber ich weiß auch, daß jedes Jahr Dutzende dieser Sklavenschiffe von den Küsten Senegals nach Brasilien und Westindien fahren. Und wenn ein so schnelles Schiff wie die Jacare diese Gewässer patrouilliert, dann können wir sie uns der Reihe nach vorknöpfen.«
»Und was fällt dabei für uns ab?«
»Nichts.«
»Nicht gerade viel.«
»Oh doch!« entgegnete das Mädchen überzeugt.
»Das mußt du mir erklären.«
»Doch nicht dir. Wenn du das schon getan hast, als du nichts hattest, um deine Mannschaft zu bezahlen, die dich jeden Augenblick über Bord hätte werfen können, dann hast du jetzt, wo du ein steinreicher Mann bist, doch noch weit mehr Grund dazu.«
»Und ist dir nie durch dein hübsches Köpfchen gegangen, daß ein steinreicher Mann seinen Wohlstand in Ruhe genießen will?«
»Jeder andere Mann, ja. Du nicht.«
»Also hör mal! Und warum?«
»Weil ich dich kenne und ich sicher bin, daß dir in ein paar Monaten die Zuckerplantagen und Rumbrennereien bis hierher stehen. Du gehörst aufs Meer…« Sie machte eine bedeutungsvolle Pause und sah ihm direkt in die Augen. »Und ich ebenfalls.«
»Was willst du damit sagen?« regte sich der frisch pensionierte Kapitän Jack auf. »Soll das heißen, daß du dein Leben auf einem Schiff verbringen willst?«
»Und warum nicht? Mir ist klargeworden, daß mir das wirklich gefällt, und wenn ich schon akzeptiert habe, daß es nicht vernünftig war, an Bord eines Piratenschiffs zu bleiben, dann mußt du deinerseits akzeptieren, daß ich sehr wohl an Bord eines anderen Schiffs leben kann, dessen Besatzung normale Leute sind, die nur für eine edle Sache kämpfen.«
»Und wo finden wir diese normalen Leute?«
»Natürlich nicht in Port-Royal. Aber in jedem anderen Hafen, wenn wir sie gut bezahlen…«
»Eine Schnapsidee!«
»Mir gefällt sie…«
In diesem Augenblick erschien Miguel Heredia in der Tür und fragte spöttisch:
»Und was ist das für eine neue Schnapsidee?«
»Deine Tochter möchte, daß ich mit der Jacare Sklavenschiffe überfalle und die Schwarzen befreie.«
Sein Vater nahm Platz, goß sich eine Tasse Kaffee ein, dachte einige Augenblicke nach und nickte schließlich überzeugt.
»Die erste vernünftige Sache, die ich seit langem gehört habe.«
»Ist das dein Ernst?«
»Mein völliger Ernst. Du hast sehr viel Geld, ein prächtiges Schiff und wenigstens ein halbes Dutzend Männer, Lucas Castano eingeschlossen, die sich nur zu gern in dieses Abenteuer stürzen werden. Wir suchen uns eine neue Besatzung und werden den Rest unseres Lebens damit verbringen, etwas Edelmütiges für die Ärmsten der Armen zu tun. Das gefällt mir! Diese Schnapsidee gefällt mir sehr!«
Den ganzen Morgen über diskutierten sie dieses Thema weiter, und obwohl es seit Wochen Sebastians innigster Wunsch gewesen war, eine ganze Nacht in Gesellschaft der rothaarigen Astrid zu verbringen, beschloß er dennoch am Abend, nicht nach Port-Royal zurückzukehren, sondern im Haus zu bleiben. Vielleicht glaubte er, daß die unbestimmte Gefahr, die er fühlte, konkrete Gestalt annehmen würde und seine Familie Schutz nötig hatte.
Aber er täuschte sich. Nicht seine Familie hatte Schutz nötig. Denn als sich am gleichen Tag die Schatten der Nacht über die stille Bucht von Port-Royal ausbreitete, ließ die Botafumeiro zwei große Schaluppen mit bewaffneten Männern zu Wasser. Unweit der Jacare ließen sich diese ins Wasser gleiten, schwammen leise zum Schiff hinüber, das fast verlassen dalag, und kletterten ohne jegliches Geräusch an Bord.
Den drei gelangweilten Wachposten, dem philippinischen Koch und dem Küchenjungen, die gerade ihre Tagesarbeit beendet hatten, schnitt man einfach die Gurgel durch.
Kurz darauf nahmen Don Hernando Pedrárias Gotarredona und Kapitän Tiradentes das Schiff in Besitz. Maßlos verblüfft betrachteten sie die immensen Schätze in den Lagerräumen.
»Meine Güte!« rief Don Hernando aus. »Ich hätte nie gedacht, daß die Seeräuberei so einträglich ist.«
»Normal ist das aber nicht!« erwiderte der Portugiese sofort. »Die müssen gerade einen phantastischen Fang gemacht haben.«
»Wo?«
»Keine Ahnung.«
Der Ex-Gesandte der Casa de Contratación von Sevilla betrachtete noch einmal die unzähligen Silberbarren, die in endlos langen Reihen aufgestapelt waren, und schüttelte noch immer ungläubig mehrmals den Kopf.
»Wie konnten sie das alles nur an Bord lassen, nur bewacht von drei Idioten, einem Küchenjungen und einem Koch?«
»Weil es bisher noch niemand gewagt hat, mitten in der Bucht von Port-Royal ein Schiff zu entern«, erwiderte einer der Männer, die sie auf Tortuga angeheuert hatten. »Wenn sie uns schnappen, dann graben sie uns am Strand bis zum Hals in den Sand ein, damit uns die Krebse bei lebendigem Leibe fressen. Und ich versichere Euch, das ist die schlimmste Folter, die sich jemals ein Menschenhirn ausgedacht hat.« Er schüttelte immer wieder den Kopf. »Gefällt mir nicht! Gefällt mir überhaupt nicht.«
»Es wird dir schon gefallen, wenn du erst mal einen dieser Silberbarren mit nach Hause nimmst«, entgegnete Joáo de Oliveira abschätzig und spuckte wieder einmal aus. »Und jetzt schneidest du diesen Mistkerlen die Köpfe ab und legst sie in Salz ein.«
»Was habt Ihr da gesagt?« entsetzte sich der andere.
»Ich habe gesagt, daß wir gekommen sind, um uns die Köpfe der Besatzung der Jacare zu holen, und genau das werden wir jetzt tun.« Er spuckte erneut auf den Silberhaufen. »Das übrige ist ein Geschenk. Ein sehr angenehmes Geschenk, aber letzten Endes nur ein Geschenk.«
»Wollt Ihr jedem den Kopf abschneiden, der an Bord kommt?« wollte ein anderer der Männer wissen.
»Einem nach dem anderen.«
Einer nach dem anderen, zu dritt oder zu fünft kehrte die Besatzung der Jacare an Bord zurück, die meisten völlig betrunken. Dort wurden sie vom Tod überrascht und ohne Ansehen der Person in die Lagerräume geworfen. Heimtückisch ermordet sanken Justo Figueroa, Nick Cararrota, Mubarak el Moro und sogar Zafiro Burman zu Boden, der einzige, dem etwas Zeit blieb, schwachen Widerstand zu leisten, bevor man ihm die Kehle durchschnitt. Lucas Castano bemerkte dagegen nicht einmal, was auf dem Schiff vor sich ging, obwohl er als einer der letzten fast schon bei vollem Tageslicht an Bord kletterte.
Nur der schläfrige Mann, der mit einem Boot zwischen Schiff und Strand hin und her ruderte, ohne zu bemerken, was an Bord geschah, blieb verschont, denn Don Hernando Pedrárias brauchte ihn, um ihm den riesigen Leichenberg zu zeigen und ihn mit drohender Stimme zu fragen:
»Wer von denen ist Kapitän Jacare Jack?«
Der schreckensstarre Mann brachte kaum ein Wort heraus, während er ein ums andere Mal mit dem Kopf schüttelte:
»Keiner!« versicherte er. »Keiner von ihnen.«
»Wie ist das möglich?« fragte sein Häscher bestürzt. »Wo ist er denn?«
»An Land«, murmelte der andere kaum hörbar. »Bei seinem Vater und seiner Schwester.«
»Seinem Vater und seiner Schwester?« erstaunte sich Kapitän Tiradentes. »Keiner hat je erwähnt, daß dieser verdammte Schotte Familie hat.«
»Der Schotte ist schon vor langer Zeit nach Schottland zurückgekehrt«, stellte das Männchen klar, das sich um jeden Preis die Gunst seiner Häscher erhalten und sein Leben retten wollte. »Der jetzige Kapitän ist ein anderer.«
»Ein anderer? Wer?«
»Ein Margariteno… Sebastián Heredia.«
Jetzt war Don Hernando Pedrárias so perplex, daß er ungläubig auf einem Stapel Silberbarren Platz nahm.
»Sebastián Heredia! Nicht möglich. Wie heißt seine Schwester?«
»Celeste.«
»Celeste…! Jetzt verstehe ich. Damals war dieser Hurensohn noch ein richtiges Kind.« Er griff sich an die Schläfen, als wollten ihm diese gleich platzen. »Er ist das also gewesen. Der Sohn von Emiliana… Ich kann’s nicht glauben!«
»Vielleicht kann mir jemand erklären, was das bedeutet«, versetzte der Portugiese, dessen Gleichmut durch nichts zu erschüttern war. »Was soll das alles heißen, zum Teufel?«
»Das soll heißen, daß das Leben manchmal üble Streiche spielt. Verdammt üble!« lautete die ausweichende Antwort. »Aber jetzt hat ihn das Glück verlassen.« Don Hernando Pedrárias deutete auf den Leichenberg. »Hier liegt seine gesamte Besatzung und sein ganzes Vermögen. Wenn Gott uns weiterhin beisteht, dann werde ich ihm noch heute das Licht ausblasen.« Er wandte sich dem Männchen zu. »Wo wohnt er?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung!« beeilte sich der Angesprochene mit der Antwort, damit man ihm glaubte. »Er hat es vor allen geheimgehalten. Vorgestern nacht hat er seinen Anteil an der Beute in eine Kutsche geladen und ist verschwunden.«
»Wann kehrt er zurück?«
»Er hat dem Koch befohlen, für diese Nacht ein großes Abschiedsessen vorzubereiten, denn die meisten seiner Männer wollen sich zur Ruhe setzen.«
»Das Essen ist ohne Zweifel abgesagt«, kommentierte Kapitän Tiradentes ironisch und wies auf die Leichen. »Und zur Ruhe haben sie sich endgültig gesetzt. Was machen wir jetzt?«
Don Hernando Pedrárias dachte lange nach.
»Warten, bis er zurückkommt.«
Der Portugiese tauschte einen Blick mit seinen Männern aus, um mit beunruhigendem Ernst zu erwidern:
»Bei allem Respekt, Senor. Wenn es dunkel wird, lasse ich die Beute auf die Botafumeiro schaffen und mache mich aus dem Staub, denn jede Minute, die wir länger hierbleiben, bringt uns den Krebsen näher. Und wenn es übel ist, arm zu sterben, dann ist es geradezu idiotisch, zu sterben, wenn man gerade reich geworden ist.«
»Wir sind gekommen, um Kapitän Jack gefangenzunehmen, und genau das werden wir tun«, gab sein Auftraggeber barsch zurück.
»Gestattet, Senor, daß ich Euch widerspreche«, lautete die fast drohende Antwort. »Wir sind gekommen, um die Jacare zu zerstören, und ich garantiere Euch, sobald wir aufgebrochen sind, fliegt sie in die Luft. Wenn Ihr mit zehn Fässern voller eingesalzener Köpfe nach Cumaná zurückkehrt und versichert, daß einer von ihnen der Kopf von Kapitän Jack ist, dürft Ihr Euch wohl als rehabilitiert betrachten. Alles andere wäre nichts weiter als ein idiotischer persönlicher Rachefeldzug, der zu viele Leute in schwerste Lebensgefahr bringt.«
Dem Ex-Gesandten der Casa de Contratación von Sevilla lag eine ärgerliche Antwort auf der Zunge, dann aber blickte er in das strenge Gesicht seines Gegenübers und in die übrige unfreundliche Runde. Auf seiner Forderung zu beharren, das wurde ihm bald klar, hieße lediglich, den Leichenberg in den Lagerräumen zu vergrößern.







